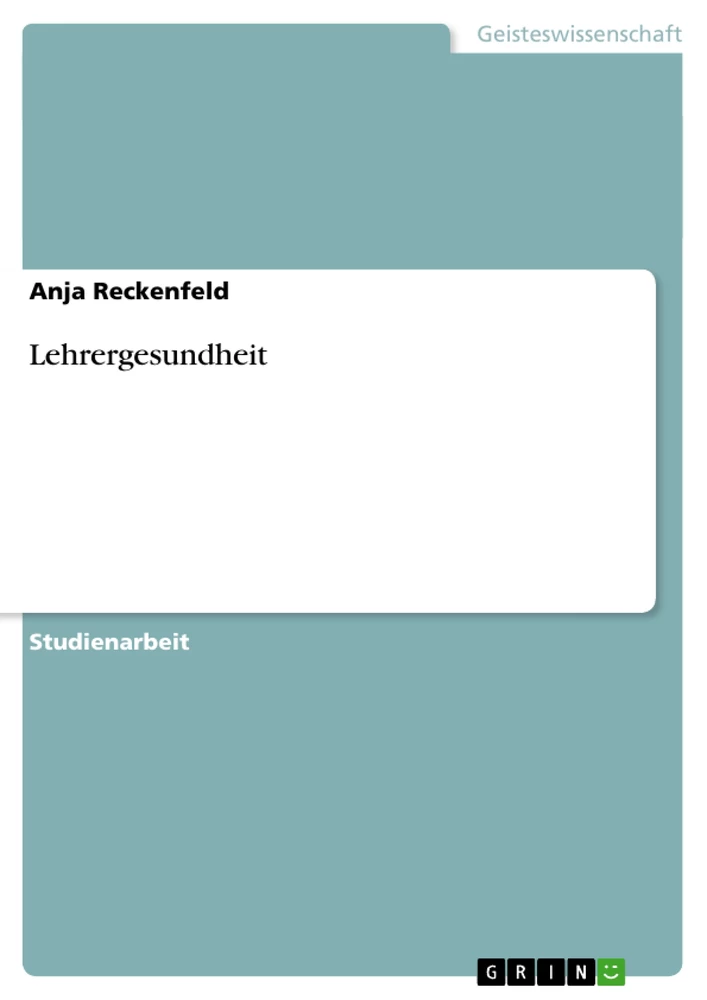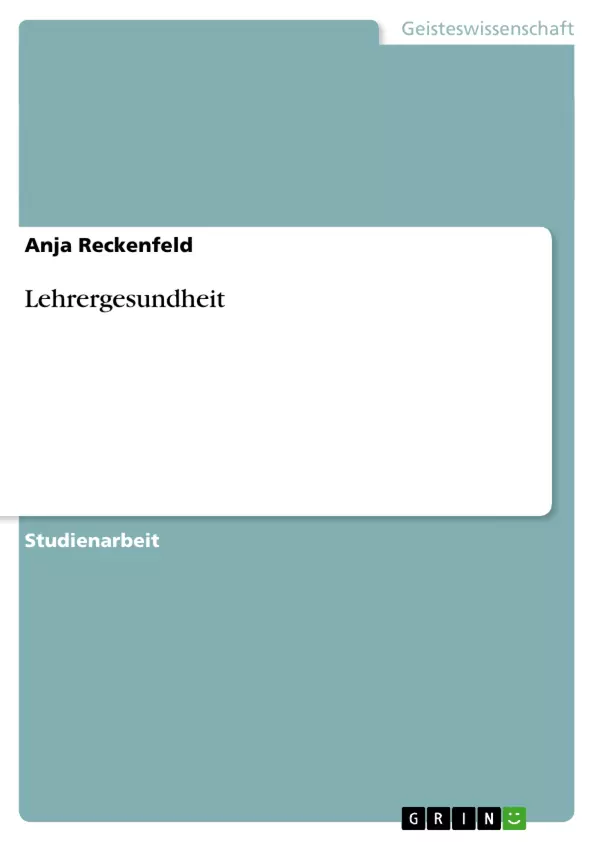Im Rahmen des Seminars: „Die Förderung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen“ stellten wir uns die Frage nach der Lebensqualität von Lehrerinnen und Lehrern. Denn diese erscheint uns als wichtige Voraussetzung dafür, erfolgreich und persönlich zufriedenstellend einen Beruf ausüben zu können, der die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen fördern kann. Daher haben wir uns in einem Referat mit diesem Thema beschäftigt. Aufgrund unseres Studiengangs sind wir persönlich von den Erkenntnissen betroffen. Uns ist daher sehr daran gelegen, zu wissen wie wir uns gesund halten können, um so dazu beizutragen, gut zu unterrichten und Unterrichtsausfall zu vermeiden. Der angestrebte Beruf soll eine Erfüllung sein und nicht zum Horrorjob werden. Beim Thema Lehrergesundheit handelt es sich um ein Thema mit ungelösten Problemen, da es immer wieder im Gespräch ist. Umso dringender wird die Lösung der Probleme.
Die folgende Ausarbeitung orientiert sich inhaltlich an der Struktur des Referates, möchte aber an einigen Stellen weiterführende Informationen bieten.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Anforderungen an Lehrer-/innen
3 Auswirkungen auf die Gesundheit
4 Hauptbelastungsfaktoren
5 Gesundheit- eine Frage von Selbstmanagement
6 Diagnostische Kriterien
7 Prävention und Therapiemöglichkeiten bei psychosomatischen Erkrankungen
8 Fazit
9 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Im Rahmen des Seminars: „Die Förderung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen“ stellten wir uns die Frage nach der Lebensqualität von Lehrerinnen und Lehrern. Denn diese erscheint uns als wichtige Voraussetzung dafür, erfolgreich und persönlich zufriedenstellend einen Beruf ausüben zu können, der die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen fördern kann. Daher haben wir uns in einem Referat mit diesem Thema beschäftigt. Aufgrund unseres Studiengangs sind wir persönlich von den Erkenntnissen betroffen. Uns ist daher sehr daran gelegen, zu wissen wie wir uns gesund halten können, um so dazu beizutragen, gut zu unterrichten und Unterrichtsausfall zu vermeiden. Der angestrebte Beruf soll eine Erfüllung sein und nicht zum Horrorjob werden. Beim Thema Lehrergesundheit handelt es sich um ein Thema mit ungelösten Problemen, da es immer wieder im Gespräch ist. Umso dringender wird die Lösung der Probleme.
Die folgende Ausarbeitung orientiert sich inhaltlich an der Struktur des Referates, möchte aber an einigen Stellen weiterführende Informationen bieten.
2 Anforderungen an Lehrer/-innen
Das Anforderungsprofil eines Lehrers ist hoch. Über die Wissensvermittlung hinaus soll er die Leistungsbereitschaft sowie soziale und emotionale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler[1] fördern.
Es gibt fünf Hauptfunktionen des Lehrerberufes[2]:
1. Lehren
2. Erziehen
3. Beurteilen
4. Beraten
5. Innovieren
Hieraus ergeben sich zahlreiche Konfliktsituationen. So sind beispielsweise die Eltern nicht immer konform mit der Ansicht des Lehrers. Oder Kolleginnen/Kollegen stehen sich kontrovers gegenüber. Der Lehrerberuf ist ein Beziehungsberuf. Gestörte menschliche Beziehungen mit Schülern[3] und Eltern bewirken einen schlechteren Gesundheitszustand der Lehrer.
Der Lehrer[4] kann nicht zugleich die Lebenssituation eines jeden Kindes berücksichtigen, auf der anderen Seite aber als „Richter“ fungieren, der die SuS in ihrer Leistung objektiv beurteilen soll. Um dieser Fülle an Anforderungen nicht zum Opfer zu fallen, ist psychische Gesundheit die Basisvoraussetzung zur Ausübung des Berufes. Kraftlosigkeit oder Mangel an Selbstvertrauen können keinen positiven Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der SuS haben.
Der gesellschaftliche Wandel hat sich auf das Denken über den Lehrerberuf ausgewirkt. Die Erziehungsaufgaben werden immer komplizierter, die Familienstruktur zunehmend instabiler und die Bereitschaft zu Gewalt und Drogen steigt. Auch die Ergebnisse der PISA-Studie haben ihren Anteil an den gestiegenen Anforderungen. Die Gesellschaft macht Lehrer gerne zu Sündenböcken.
Hinzu kommt die tägliche Arbeitszeit von 9,25 Stunden, die sich belastend auf Körper und Psyche auswirken kann. Die Arbeitsplatzregelung von Lehrkräften und ihre Arbeitszeit sind nicht klar definiert. Lehrer arbeiten in Unterrichtsräumen, auf dem Pausenhof, bei Ausflügen und Klassenfahrten, in Sporthallen und Schwimmbädern, aber auch zuhause am Schreibtisch.[5]
3 Auswirkungen auf die Gesundheit
Lehrer zu sein ist ein anstrengender Beruf.[6] Nicht nur Lärm und Konflikte mit den Schülern zehren an den Nerven und haben Auswirkungen auf den Gesundheitszustand. Weitere Ursachen werden auf Seite 5 unter Hauptbelastungsfaktoren aufgeführt. Eine Untersuchung von Schönwälder/Tiesler et al. hat gezeigt, dass die Lehrkraft den allgemeinen Geräuschpegel übertönen muss.[7] Nach § 15 der Arbeitsstättenverordnung liegt ein akustisch optimaler Schallpegel bei bis zu 55 dB. Bei der Untersuchung wurden durchschnittliche Werte von 70 dB festgestellt, teilweise sogar 80 bis 90dB. Dieser Umstand verschlechtert die Lernsituation und verstärkt die stimmlichen Belastungen.
Die Kultusminister geben die Schuld für den enormen Stress dem Lehrer selbst. So heißt es in einem Protokoll[8]: Die psychische Belastung der einzelnen Lehrkraft auch im Unterricht wird maßgebend durch die außerunterrichtliche persönliche Arbeitsorganisation mit gesteuert. Stress entsteht also, wenn die Anforderungen der Umwelt nicht im Gleichgewicht sind mit den persönlichen Ressourcen.[9] Nach Hall, Wooster und Woodhouse ist Stress im Lehrerberuf unvermeidbar.[10]
Im Verhältnis zu anderen Berufsgruppen sind Lehrer nicht öfter krank, sie leiden jedoch häufiger an psychosomatischen Erkrankungen wie Depressionen, Schwindel und Kopfschmerzen. Im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern gehen sie eher in Frührente, so sind 41% aller Lehrer vom Vorruhestand betroffen.[11] 36% beantragen eine Pensionierung zwischen dem 62. und 65. Lebensjahr. Nur 23% werden mit Erreichen der Altersgrenze pensioniert. Die Anzahl der erschöpfungsbedingten Frühpensionierungen ist in Deutschland überdurchschnittlich.[12] Das Phänomen der frühzeitigen Pensionierung hat stark zugenommen. Es bringt individuelles Leiden mit sich, aber auch hohe gesellschaftliche Kosten.[13] Wenn an der aktuellen Situation keine Veränderungen durchgesetzt werden, wird auch die nächste Lehrergeneration „verbraucht“ sein.
[...]
[1] Im Folgenden mit SuS abgekürzt
[2] Vgl. Gudjons, Herbert: Pädagogisches Grundwissen. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt 92006. S. 256. [Im Folgenden zitiert als Gudjons.]
[3] Schüler meint in der gesamten Arbeit immer auch Schülerinnen
[4] Der Lehrer meint in der gesamten Arbeit sowohl Lehrer als auch Lehrerinnen
[5] Vgl. Ulich, Klaus: Beruf Lehrer/in. Arbeitsbelastungen, Beziehungskonflikte, Zufriedenheit. Weinheim und Basel: Beltz 1996. S. 45. [Im Folgenden zitiert als Ulich.]
[6] Vgl. zu folgendem Abschnitt: Wagner, Yvonne: Arbeitsplatz Schule: Lange Lehren ohne Schäden auf: http://www.faz.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09225C1D802785495A.doc (Stand: 11.12.2010).
[7] Vgl. Triebe, Manfred: Arbeitsbelastungen in der Schule auf: http://www.gesundheitberlin.de/index.php4?request=themen&topic=1957&type=infot...(Stand: 11.02.2011). [Im Folgenden zitiert als Triebe.]
[8] Ebd.
[9] Vgl. van Dick, Rolf: Stress und Arbeitszufriedenheit bei Lehrerinnen und Lehrern. Zwischen „Horrorjob“ und Erfüllung. Marburg: Tectum ²2006. S. 31. [Im Folgenden zitiert als van Dick.]
[10] Vgl. ebd. S. 269.
[11] Vgl. ebd. S. 247.
[12] Vgl. Jürgens, Barbara (Hg.): Komponente Lehrer ausbilden – Vernetzung von Universität und Schule in der Lehreraus- und -weiterbildung. Aachen: Shaker 2006. S. 90. [Im Folgenden zitiert als Jürgens.]
[13] Vgl. van Dick. S. 16.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Lehrergesundheit ein wichtiges Thema?
Die Gesundheit von Lehrkräften ist die Voraussetzung für erfolgreichen Unterricht und die Förderung der Lebensqualität von Schülern. Zudem hilft sie, Unterrichtsausfall zu vermeiden.
Was sind die fünf Hauptfunktionen des Lehrerberufes?
Die Hauptfunktionen sind Lehren, Erziehen, Beurteilen, Beraten und Innovieren, was oft zu Rollenkonflikten führt.
Welchen Einfluss hat Lärm auf die Gesundheit von Lehrern?
Untersuchungen zeigen, dass der Schallpegel in Schulen oft bei 70 bis 90 dB liegt, was weit über dem optimalen Wert von 55 dB liegt und zu stimmlichen sowie psychischen Belastungen führt.
An welchen Krankheiten leiden Lehrer besonders häufig?
Lehrer leiden überdurchschnittlich oft an psychosomatischen Erkrankungen wie Depressionen, Schwindel und Kopfschmerzen.
Wie hoch ist die Quote der Frühpensionierungen bei Lehrkräften?
Etwa 41 % aller Lehrer gehen in den Vorruhestand, oft aufgrund von Erschöpfung, während nur 23 % die reguläre Altersgrenze erreichen.
- Quote paper
- Anja Reckenfeld (Author), 2011, Lehrergesundheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268174