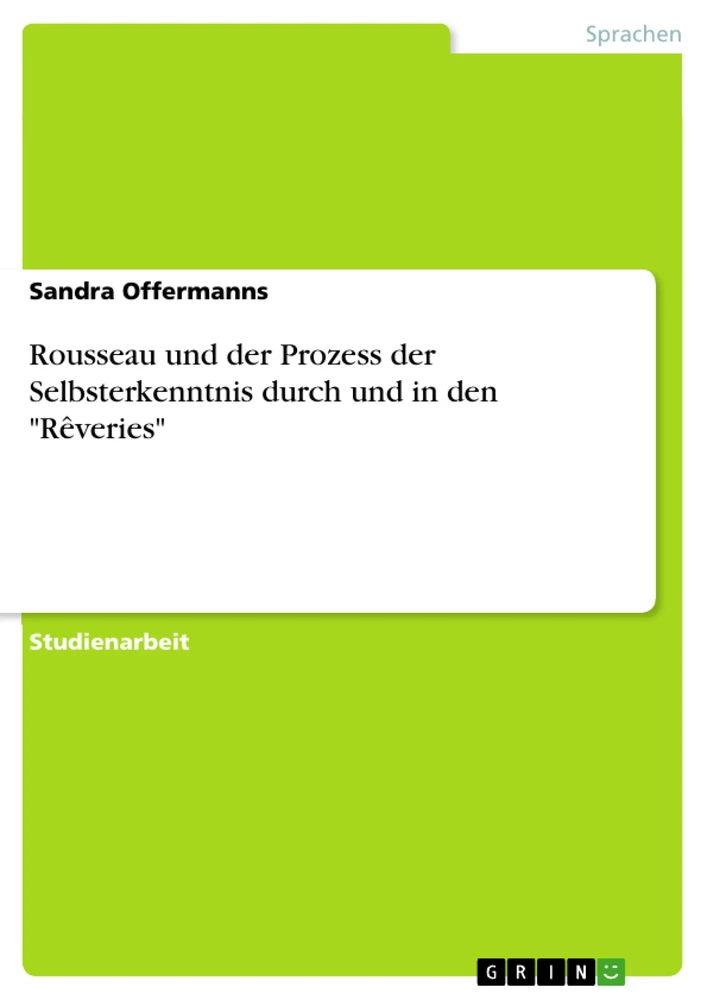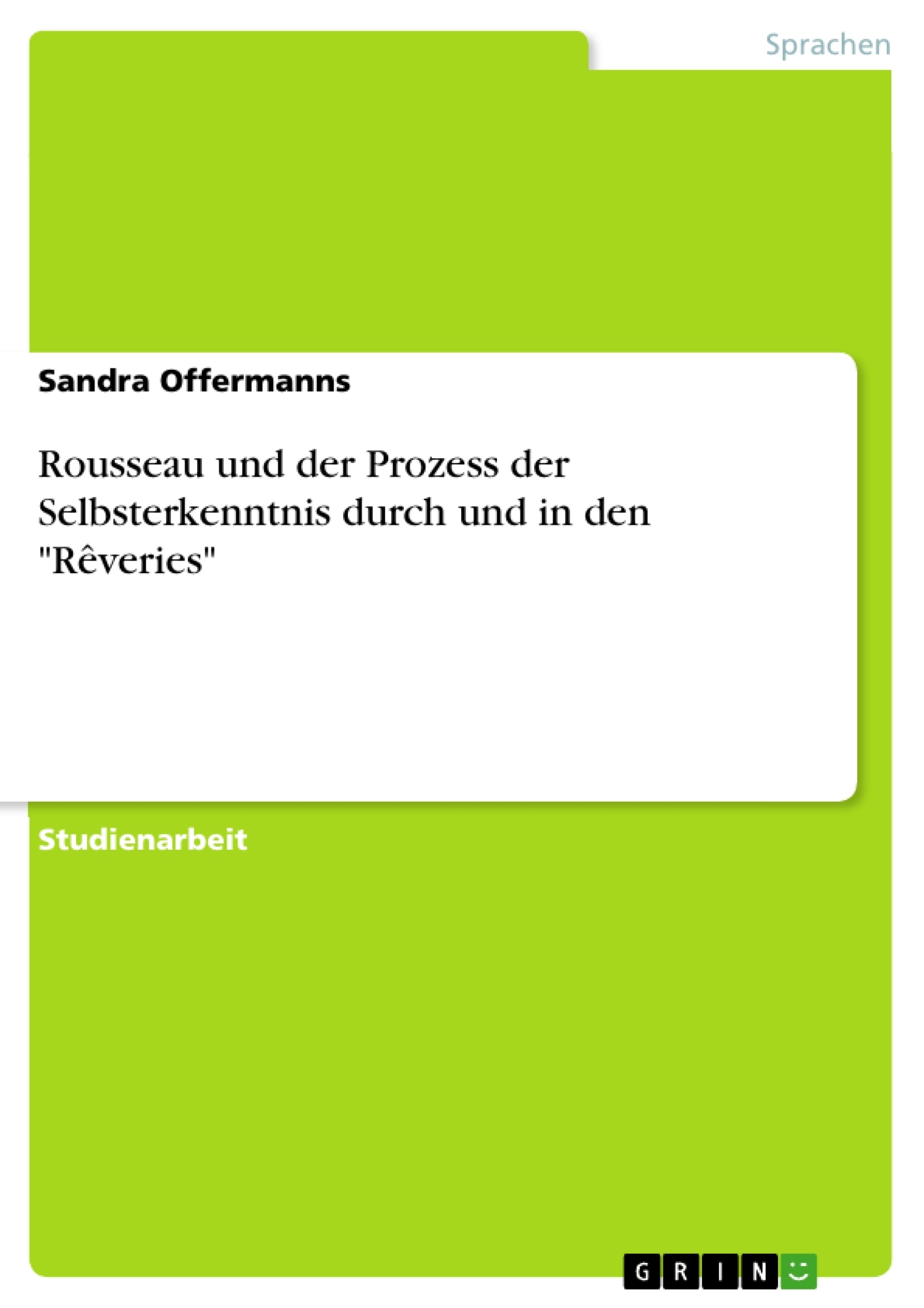In meiner Hausarbeit möchte ich mich mit Rousseaus „Les Rêveries du promeneur solitaire“ befassen.So äußert sich Rousseau in dem ersten Spaziergang der „Rêveries du promeneur solitaire“.
Die Frage, mit der sich diese Arbeit beschäftigen will, ist, für wen und warum hat Rousseau die „Rêveries“ geschrieben, wenn es, wie er selber sagt, niemand mehr gibt, an den er sich richten will? Welchen Nutzen sieht er in der Abfassung der „Rêveries“, wenn nicht um sich an einen Leser zu wenden?
Die These ist, dass Rousseau die „Rêveries“ brauchte um wieder den eigenen Selbsterkenntnisprozess vorantreiben zu können.
Ausgangspunkt für die Untersuchung ist das Buch „Literary Silences in Pascal, Rousseau, and Becket“ von Elisabeth Loevlie, in dem sie der Frage nachgeht, welche Bedeutung die gesellschaftliche Stille, die durch Rousseaus Rückzug entstanden ist, auf seine Selbsterkenntnis und die letztliche Abfassung der „Rêveries“ hatte. Außerdem befasst sie sich mit der Frage, wie er diese Stille in seinen „Rêveries“ literarisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbsterkenntnis in Rousseaus „Rêveries“
- Die Spannung zwischen der inneren und der äußeren Welt in den „Rêveries“
- Die Stille der Einsamkeit: Rousseau schreibt für Rousseau
- Literarisierte Selbsterkenntnis: Auf der Suche nach dem Ursprünglichen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Jean-Jacques Rousseaus „Rêveries du promeneur solitaire“ und untersucht, wie er in diesen autobiografischen Schriften den Prozess der Selbsterkenntnis vorantreibt. Der Fokus liegt auf Rousseaus Motivation, diese Werke zu verfassen, obwohl er selbst betont, dass er keine Leser mehr hat, und auf den Nutzen, den er darin findet, obwohl er sich nicht an ein Publikum richtet.
- Die Spannung zwischen innerer und äußerer Welt in den „Rêveries“
- Rousseaus Umgang mit Einsamkeit und gesellschaftlichem Stillschweigen
- Die Bedeutung des Schreibens als Werkzeug der Selbsterkenntnis
- Die Suche nach dem ursprünglichen Kern der eigenen Identität
- Die Grenzen des Selbsterkenntnisprozesses durch Sprache und Schrift
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die beiden Formen von Einsamkeit, die Rousseau in seinen Werken beschreibt, und zeigt die Spannung zwischen Rousseaus innerem und äußerem Leben auf, die durch die „Rêveries“ entstanden ist. Es wird argumentiert, dass die „Rêveries“ keinen dualistischen Zustand bieten, der für einen Selbsterkenntnisprozess notwendig wäre.
Das zweite Kapitel behandelt die Frage, warum Rousseau trotz seines Gefühls der Isolation wieder mit dem Schreiben beginnt. Es wird herausgearbeitet, dass die „Rêveries“ für Rousseau eine Möglichkeit darstellen, wieder einen reflektierbaren Subjekt-Objekt-Dualismus herzustellen, indem er sich durch die schriftliche Fixierung seiner Gedanken ein externes Objekt schafft.
Das dritte Kapitel untersucht die Entwicklung von Rousseaus Selbsterkenntnis im Verlauf der „Rêveries“ und stellt die Frage, ob er durch die „Rêveries“ tatsächlich auf einen ursprünglichen Kern seines Wesens zugreifen kann. Es wird argumentiert, dass die schriftliche Form von Rousseaus Gedanken nur eine Mimesis seines Selbst darstellt und daher der Selbsterkenntnisprozess an den Grenzen der Sprache scheitert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Selbstfindung und Selbsterkenntnis in Rousseaus „Rêveries“, besonders im Kontext von Einsamkeit, gesellschaftlichem Stillschweigen, dem Prozess des Schreibens als Mittel der Selbsterkenntnis, der Suche nach dem ursprünglichen Selbst und den Grenzen des Selbsterkenntnisprozesses durch Sprache und Schrift. Darüber hinaus werden wichtige Konzepte der Subjekt-Objekt-Dualität und der Mimesis im Bezug auf Rousseaus Selbsterkenntnis untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Warum schrieb Rousseau die „Rêveries“, wenn er keine Leser mehr wollte?
Die These der Arbeit ist, dass Rousseau das Schreiben als Werkzeug für seinen eigenen Selbsterkenntnisprozess benötigte, um einen reflektierbaren Dualismus zwischen sich und seinen Gedanken zu schaffen.
Welche Rolle spielt die Einsamkeit in den „Rêveries“?
Die Einsamkeit ermöglicht Rousseau den Rückzug aus einer feindselig wahrgenommenen Gesellschaft und bietet den Raum für eine tiefe innere Einkehr.
Kann man durch Schreiben wahre Selbsterkenntnis erlangen?
Die Arbeit problematisiert dies: Da Sprache nur eine Mimesis (Nachahmung) des Selbst darstellt, scheitert der Prozess der Selbsterkenntnis letztlich an den Grenzen der Sprache.
Was bedeutet die „Stille der Einsamkeit“ bei Rousseau?
Es beschreibt den Zustand, in dem Rousseau nur noch für sich selbst schreibt, nachdem er sich von der sozialen Welt isoliert fühlt.
Was ist das Ziel des „einsamen Spaziergängers“?
Das Ziel ist die Suche nach dem ursprünglichen Kern der eigenen Identität, befreit von den Verformungen durch die Gesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Sandra Offermanns (Autor:in), 2013, Rousseau und der Prozess der Selbsterkenntnis durch und in den "Rêveries", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268253