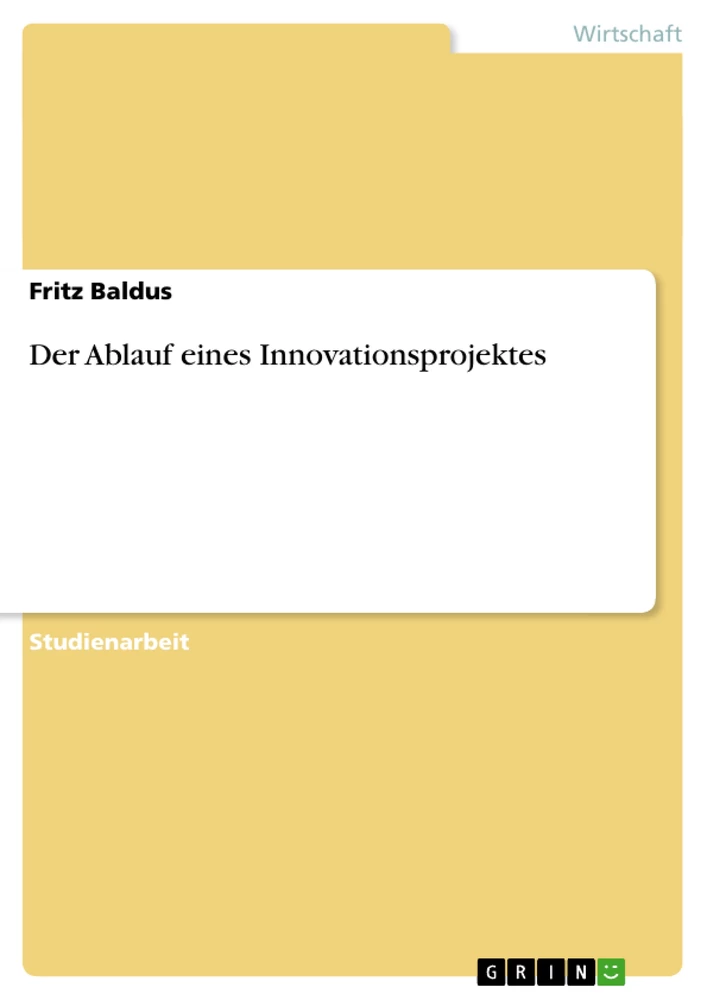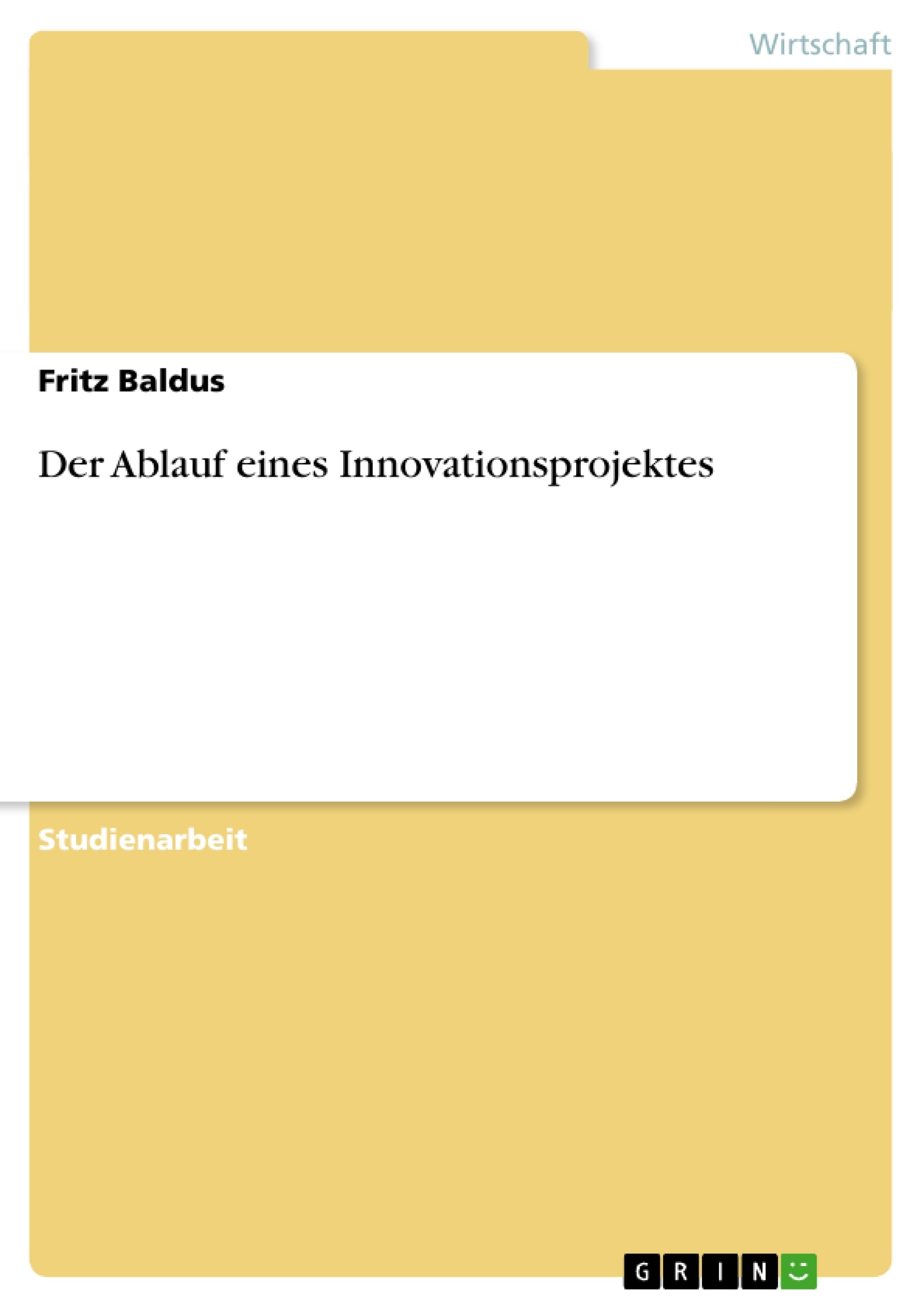Das Phänomen des technologischen Wandels begleitet die ökonomische Forschung
von Anfang an. Seit dem Bestehen von marktwirtschaftlichen Systemen kam es in
mehr oder weniger regelmäßigen Abständen zu technisch-ökonomischen Basisinnovationen, die die „gesellschaftliche Befindlichkeit“ (Neumann, 1990)
nachhaltig beeinflusst haben und lang anhaltende wirtschaftliche Aufschwünge nach
sich zogen. In den letzten 250 Jahren lassen sich nach Nefiodow (1996) fünf solche,
nach dem russischen Ökonomen N. D. Kondratieff benannte „Kondratieff-Zyklen“ feststellen. Der Einfluss technologischer Neuerungen ist aber auch offensichtlich, ohne weit in die Vergangenheit zu blicken. Allein die sukzessiven Verbesserungsinnovationen im IT – Bereich in den letzten 30 Jahren lassen einen die große Wirkung von Neuerungen spüren. Die Frage, wie es zu solchen Neuerungen kommt und unter welchen Bedingungen sie
entstehen, wurde erstaunlicherweise lange Zeit nicht erfolgreich untersucht. Der technologische Fortschritt wurde als empirisch nicht erklärtes Residuum behandelt. Erst J.A. Schumpeter bemühte sich ernsthaft, dies zu beleuchten, und gilt deshalb als Vater der theoretischen wie empirischen Innovationsforschung. In seinem Spätwerk beschrieb Schumpeter (1942) den „Prozess schöpferischer Zerstörung“. Hiernach zerstört der durch Innovationen vorangetriebene Wandel permanent bereits bestehende Strukturen und erschafft parallel neue Strukturen. Die Vorstellung eines solchen dynamischen strukturverändernden Wettbewerbsprozesses regt bis heute die Forschung auf diesem Gebiet an. Wegen der hohen Notwendigkeit von permanentem wirtschaftlichem Fortschritt, um die eigene Wettbewerbsposition zu erhalten, wird im Rahmen der zunehmenden Globalisierungstendenzen unserer Wirtschaft die Innovationsforschung auch in Zukunft von großer Bedeutung sein. Bei der theoretischen und empirischen Untersuchung der Ursachen und Auswirkungen von Innovationstätigkeiten ist als Fixum anzunehmen, dass technologischer Fortschritt das Ergebnis kosten- und zeitintensiver F&E-Projekte von Unternehmen ist (Stadler 1997). Es gilt also zu untersuchen, welches die Bestimmungsgründe für Innovationsaktivitäten sind, und wie diese sich auswirken. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Entwicklung der F&E-Aktivität
- Beschreibung des Modells
- Lösung des Modells
- Ökonomische Analyse
- Empirische Ergebnisse
- Kritische Würdigung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das einzelwirtschaftliche Kontrollproblem eines Innovationsprojektes. Das Ziel ist es, die optimale Strategie zur Finanzierung und Durchführung eines Innovationsprojektes zu identifizieren, wobei die Knappheit der Geldmittel und die Unsicherheit des Erfolgs berücksichtigt werden.
- Die Rolle der F&E-Aktivitäten im Innovationsprozess
- Die optimale zeitliche Gestaltung des Innovationsprojektes
- Die Bedeutung der finanziellen Restriktion
- Die Auswirkungen von Wettbewerb auf die Innovationsentscheidung
- Die Vergleichbarkeit von theoretischen und empirischen Ergebnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema des technologischen Wandels und der Bedeutung von Innovationen ein. Es wird auf die langfristigen Auswirkungen von Basisinnovationen und den Einfluss von technologischen Neuerungen auf die Wirtschaft hingewiesen. Das Kapitel stellt auch die Bedeutung der Forschung von Joseph Alois Schumpeter im Bereich der Innovationstheorie heraus und erläutert das Konzept der „schöpferischen Zerstörung“.
Kapitel 2 widmet sich der Entwicklung der F&E-Aktivität. Es wird das Modell von Kamien und Schwartz (1982) vorgestellt, das die Knappheit der Geldmittel und die Unsicherheit des Innovationsprojekts berücksichtigt. Das Modell wird gelöst und die Ergebnisse ökonomisch interpretiert. Es werden die Auswirkungen verschiedener Einflussgrößen auf den optimalen Innovationszeitpunkt dargestellt. Abschließend werden die theoretischen Ergebnisse mit empirischen Ergebnissen verglichen und das Modell kritisch gewürdigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema des Innovationsprozesses, dem einzelwirtschaftlichen Kontrollproblem, der F&E-Aktivität, dem optimalen Innovationszeitpunkt, der finanziellen Restriktion, der Unsicherheit des Erfolgs und der empirischen Überprüfung von theoretischen Modellen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Schumpeters "schöpferische Zerstörung"?
Es beschreibt einen Prozess, bei dem Innovationen alte Strukturen permanent zerstören und gleichzeitig neue, effizientere Strukturen erschaffen.
Was sind Kondratieff-Zyklen?
Dies sind langwellige Wirtschaftszyklen, die durch technisch-ökonomische Basisinnovationen (wie die Dampfmaschine oder IT) ausgelöst werden.
Wie beeinflusst Finanzknappheit Innovationsprojekte?
Knappe Geldmittel zwingen Unternehmen dazu, den optimalen Zeitpunkt und die effizienteste Strategie für ihre F&E-Aktivitäten genau zu planen.
Warum ist die Unsicherheit des Erfolgs ein zentrales Problem?
Da F&E-Projekte zeit- und kostenintensiv sind, stellt das Risiko des Scheiterns eine große Hürde für einzelwirtschaftliche Investitionsentscheidungen dar.
Welchen Einfluss hat der Wettbewerb auf Innovationen?
Wettbewerb wirkt oft als Katalysator für Innovationsaktivitäten, da Unternehmen gezwungen sind, durch Neuerungen ihre Marktposition zu sichern.
- Quote paper
- Fritz Baldus (Author), 2004, Der Ablauf eines Innovationsprojektes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26826