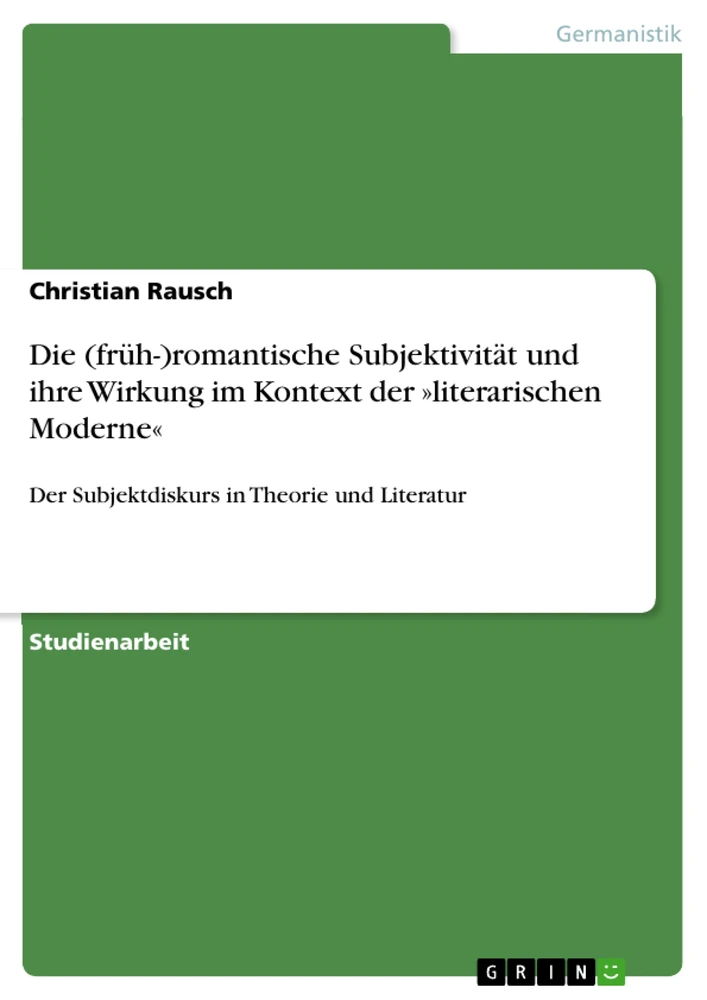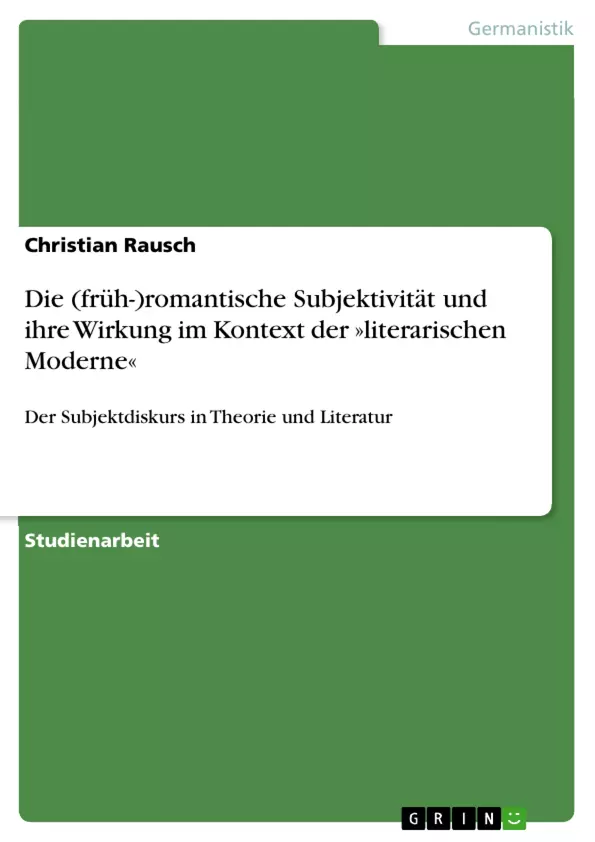Epochenbegriffe sind Verallgemeinerungen und Abstraktionen, die die gesamtkulturellen Einzelerscheinungen eines historischen Abschnittes auf verbindende Merkmale reduzieren und nach typologischen Kriterien ordnen – dem jeweils spezifisch-individuellen Gehalt können und wollen sie nicht gerecht werden. Epochen-Grenzen/ -Übergänge markieren dabei einen signifikanten geistes-geschichtlichen Paradigmenwechsel, der sich als »Um-Denken«, »Neu-Denken« oder »Weiter-Denken« äußern kann. Die Frage nach der Gemeinsamkeit und Differenz von Romantik und literarischer Moderne im Hinblick auf ihren theoretisch-philosophischen und poetologischen, aber auch sozial-politischen, ökonomischen und wissenschafts-geschichtlichen Kontext berührt beides. Einerseits erfordert sie die Erarbeitung jeweils epochen-spezifischer Kennzeichen und Strukturen, die der inneren Heterogenität des Gegenstandes gerecht wird, andererseits verlangt sie eine diachronische und Epochen übergreifende Gesamtansicht, mit der Absicht Zusammenhänge/ Unterschiede/ Modifikationen/ Konfigurationen struktureller und inhaltlicher Art präzise zu erfassen.
Inhaltsverzeichnis
- Methodik und Grundlagenbestimmung
- methodische Vorüberlegungen
- Untersuchungsgegenstand und epochale Abgrenzung
- Die Subjektivität in der europäischen Kulturgeschichte seit der frühen Neuzeit
- Subjektivität seit der frühen Neuzeit bis Descartes
- Kants Subjektbegriff der »prästabilierten« Identität
- Fichtes subjektiver Idealismus
- der (früh-)romantische Subjektdiskurs und seine modernen Ausprägungen
- Spielarten (früh-)romantischer Subjektivität
- Novalis: >>Heinrich von Ofterdingen<<
- Tieck: »William Lovell«
- Resümee: Aspekte (früh-)romantischer Subjektivität im Diskurs der literarischen Moderne
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen der (früh-)romantischen Subjektivität und der literarischen Moderne. Dabei steht der Subjektdiskurs in Theorie und Literatur im Mittelpunkt. Das Ziel ist es, die Relevanz romantischer Impulse für die Entwicklung der literarischen Moderne aufzuzeigen.
- Die Entstehung und Entwicklung des Subjektbegriffs in der europäischen Kulturgeschichte
- Die (früh-)romantische Neuakzentuierung des Subjekts und ihre Auswirkungen auf die Literatur
- Die Korrespondenz von Romantik und literarischer Moderne im Hinblick auf den Subjektdiskurs
- Die Bedeutung der ästhetischen Imagination und des »Nervösen« für die literarische Moderne
- Die Ambivalenz der modernen Kultur: zwischen wissenschaftlicher Objektivität und subjektiver Erfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der methodischen Grundlage der Untersuchung. Hier werden die zentralen Begriffe – Romantik und literarische Moderne – definiert und deren Abgrenzung im Kontext der Kulturgeschichte erläutert.
Das zweite Kapitel verfolgt die Entwicklung des Subjektbegriffs in der europäischen Kulturgeschichte, beginnend mit der frühen Neuzeit bis hin zu Kant, Fichte und den (früh-)romantischen Denkern. Es beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze und Perspektiven auf das Subjekt und zeigt die Bedeutung des (früh-)romantischen Subjektdiskurses für die Moderne auf.
Das dritte Kapitel analysiert zwei exemplarische Werke der (früh-)romantischen Literatur: Novalis' »Heinrich von Ofterdingen« und Tiecks »William Lovell«. Anhand dieser Texte wird die spezifische Ausprägung der (früh-)romantischen Subjektivität veranschaulicht und deren Verbindung zur ästhetischen Imagination und dem »Nervösen« untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: (früh-)romantische Subjektivität, literarische Moderne, Subjektdiskurs, ästhetische Imagination, »Nervöses«, Romantik, Kulturgeschichte, Moderne, Theorie, Literatur, Metaphysik, Rationalismus, Empirismus, Wissenschaft, Kunst, Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter frühromantischer Subjektivität?
Es handelt sich um ein philosophisches und literarisches Konzept, das das individuelle Ich und seine ästhetische Imagination ins Zentrum der Weltwahrnehmung stellt.
Wie beeinflusste die Romantik die literarische Moderne?
Die Romantik legte den Grundstein für moderne Themen wie die Zersplitterung des Ichs, das Nervöse und die Abkehr von rein rationalistischen Weltbildern.
Welche Rolle spielt Fichtes Idealismus für die Romantik?
Fichtes Konzept des "absoluten Ich" war eine zentrale Inspirationsquelle für die Romantiker, um die schöpferische Kraft des Individuums theoretisch zu begründen.
Was symbolisiert Novalis' "Heinrich von Ofterdingen"?
Der Roman gilt als Paradebeispiel für die romantische Suche nach Transzendenz und die Verschmelzung von Traum, Poesie und Wirklichkeit.
Was bedeutet das "Nervöse" im Kontext der Moderne?
Das "Nervöse" beschreibt eine gesteigerte Sensibilität und psychische Labilität der modernen Subjekte, die bereits in romantischen Werken wie Tiecks "William Lovell" angelegt ist.
- Quote paper
- Christian Rausch (Author), 2013, Die (früh-)romantische Subjektivität und ihre Wirkung im Kontext der »literarischen Moderne«, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268297