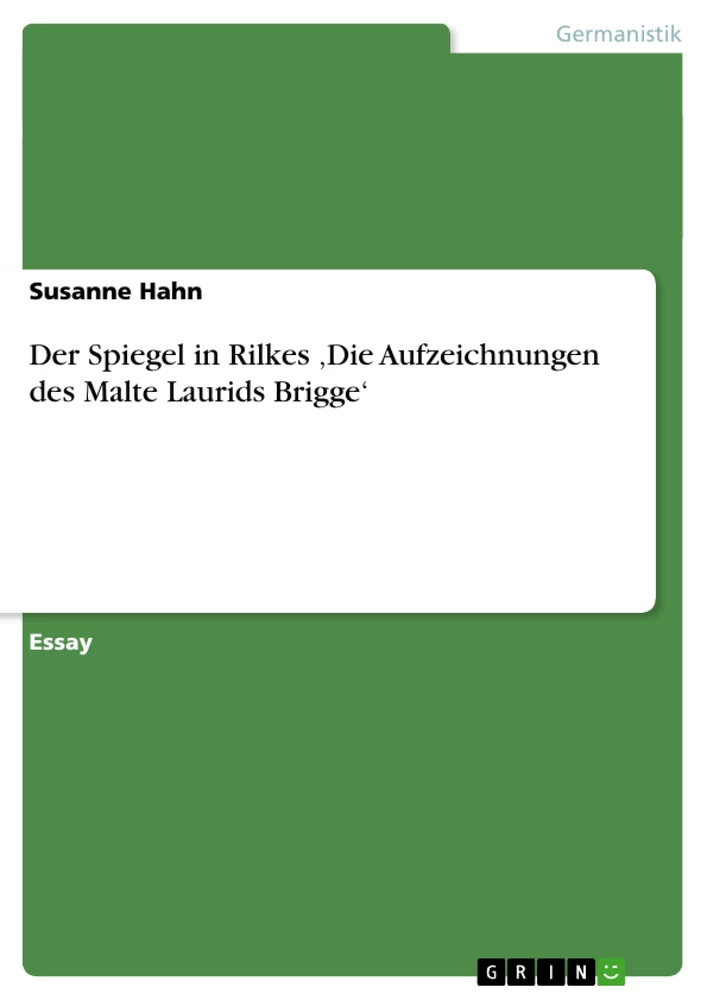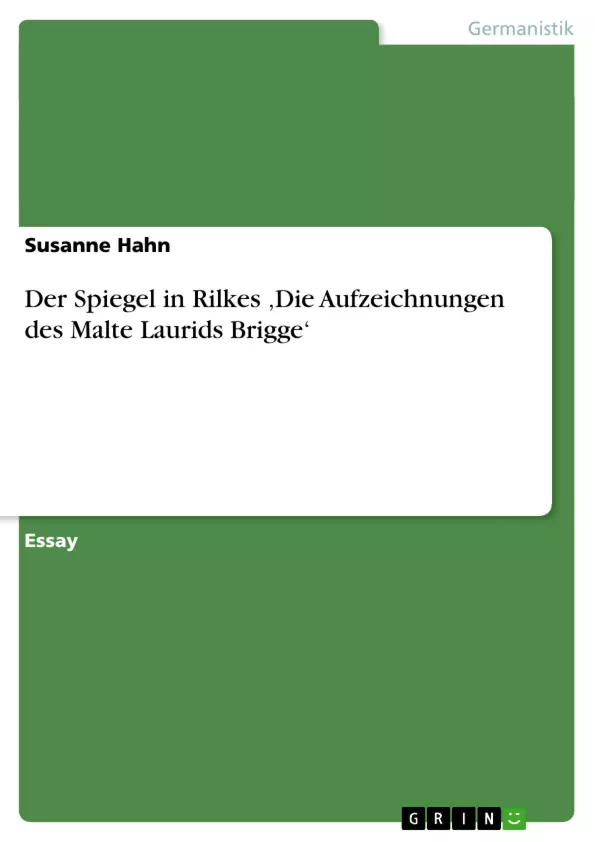Im Zentrum dieses Essays steht die Bedeutung und Signifikanz des Spiegels bzw. der verschiedenen auftauchenden Spiegel in Rilkes "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge".
Der Spiegel in Rilkes ‚Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge‘
Über sechs Jahre hinweg schrieb Rainer Maria Rilke an seinem einzigen veröffentlichten Roman ‚Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge‘, indem er selbst seine eigenen Eindrücke vom Aufenthalt in Paris in Form von Tagebucheinträgen niederschrieb. Der Autor der Einträge ist der fiktive junge Mann Malte, der mit seinen Aufzeichnungen dem Rezipient einen präzisen Einblick in dessen Leben und Erinnerungen aus seiner Kindheit, die er im Laufe des Buches Stück für Stück zusammenträgt, gibt.[1] In 71 Einträgen gibt er nicht nur dem Leser die Chance, herauszufinden wer er ist und wie er zu dem geworden ist, sondern vordergründig sich selbst. Innerhalb seiner Schriften finden immer wieder an verschiedenen Stellen Gegenstände Bedeutung, die Malte auf seine eigene Art und Weise wahrnimmt. Für ihn ist kein Ding ein einfaches Ding. Die Gegenstände bekommen aus Maltes Perspektive eine Seele und er agiert mit ihnen in ungewöhnlichen Situationen. Im Vordergrund soll bei der folgenden Betrachtung des Werkes der Spiegel stehen, der innerhalb der Aufzeichnungen an verschiedenen Stellen Bedeutung findet.
Malte stammt aus einem aussterbenden Adelsgeschlecht ab und wurde heimatlos, nachdem seine Eltern früh starben. Er reist nach Paris, um dort neu anzufangen und ein Leben als Dichter zu beginnen. Dort resigniert er über sein bisheriges Leben und schreibt alle Eindrücke der Stadt und Gedanken über seine Vergangenheit fragmentarisch und willkürlich nieder. Er verfolgt keinen Handlungsstrang oder roten Faden, sondern schreibt situationsbedingt, was ihn interessiert oder bedrückt. An eine Begegnung mit einem Spiegel erinnert er sich zum ersten Mal in seiner Kindheit im alten Herrenhaus seines Großvaters: „Die Vorhänge wurden zurückgezogen, und das robuste Licht eines Sommernachmittags untersuchte alle die scheuen, erschrockenen Gegenstände und drehte sich ungeschickt um in den aufgerissenen Spiegeln.“[2] Wie in seiner Aufzeichnung deutlich wird, sind die Gegenstände in dem Raum für ihn nicht nur Objekte, sondern werden sie in seiner kindlichen Erinnerung zu lebenden Subjekten. Die Gegenstände sind „erschrocken“[3], der Spiegel ist „aufgerissen“[4]. Malte beobachtet dieses Geschehen und interveniert nicht in das Interagieren der Sonne mit den Gegenständen. Während die Dinge im Raum zurückhaltend sind und sich der Sonne zu verschließen wollen, öffnet sich der Spiegel jedoch, indem er sich aufreißt. Dieses Öffnen des Spiegels wird auch für Malte selbst eine wesentliche Rolle spielen.
[...]
[1] Vgl.: Thomas Richter (Hrsg.): Editorischer Bericht. Das ‚Berner Taschenbuch‘ im Kontext der Entstehung der Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. In: Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Das Manuskript des ‚Berner Taschenbuchs‘. Textgenetische Edition.Wallstein Verlag. Göttingen 2012, S. 226ff.
[2] Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Kommentierte Ausgabe. Kommentiert und herausgegeben v. Manfred Engel. Reclam Verlag. Stuttgart 1997, S. 13.
[3] Ebenda.
[4] Ebenda.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Rilkes „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“?
Es ist Rilkes einziger Roman, verfasst in Form von 71 fragmentarischen Tagebucheinträgen des fiktiven jungen Adligen Malte in Paris.
Welche Bedeutung hat der Spiegel im Werk?
Der Spiegel ist ein zentrales Symbol für Maltes Selbsterkenntnis und Identitätssuche. Er wird oft als belebtes Subjekt wahrgenommen, das sich Malte „öffnet“.
Wie nimmt Malte Gegenstände wahr?
Für Malte haben Dinge eine Seele. Er beschreibt sie mit menschlichen Eigenschaften, zum Beispiel als „erschrocken“ oder „scheu“.
Warum schreibt Malte seine Erlebnisse nieder?
Er versucht durch das Schreiben seiner Kindheitserinnerungen und Pariser Eindrücke herauszufinden, wer er ist und wie er zu dem geworden ist, der er heute ist.
In welcher Stadt spielt der Roman hauptsächlich?
Der Roman spielt im Paris des frühen 20. Jahrhunderts, wo Malte als heimatloser Dichter lebt.
- Arbeit zitieren
- Susanne Hahn (Autor:in), 2013, Der Spiegel in Rilkes ‚Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge‘, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268327