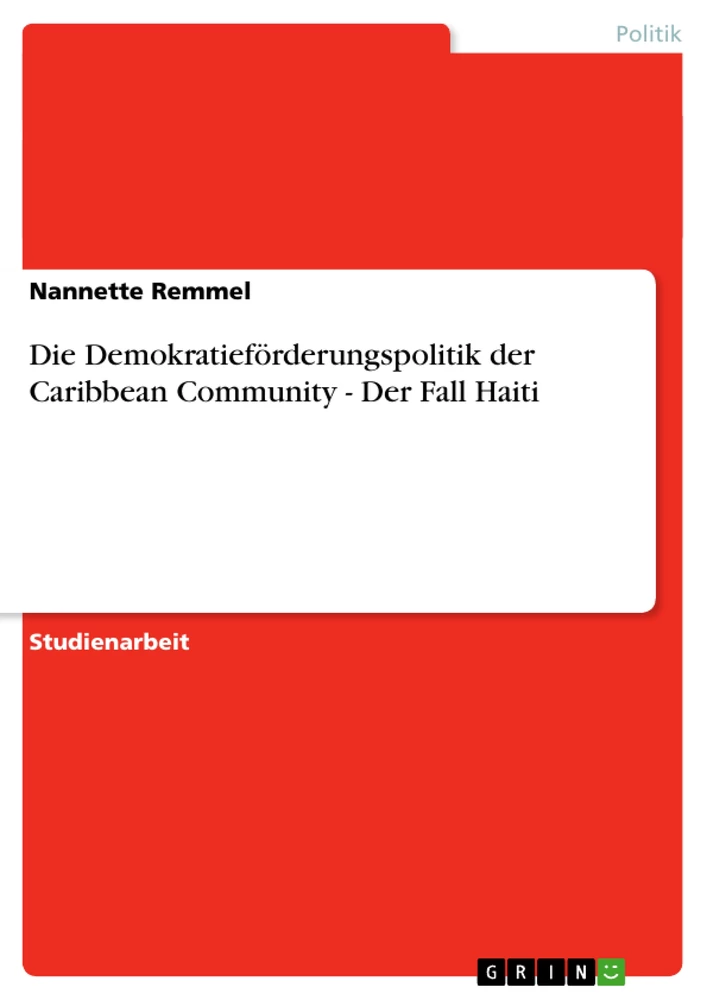Bewaffnete „Rebellen“ kontrollierten Anfang des Jahres weite Teile Haitis. Das Land war am
Rande eines Bürgerkriegs, als es ihnen Februar schließlich gelang, den Präsidenten Jean
Bertrand Aristide zu putschten, als sie die Hauptstadt, Port-au-Prince, einzunehmen drohten.
Aristide floh am 29.02.2004 ins Exil und noch am gleichen Tag kam es zur Intervention
kanadischer, US-amerikanischer und französischer Truppen. Aus dem Exil in Zentralafrika ließ
Aristide jedoch verkünden, dass er sein Land nicht freiwillig verlassen habe, sondern von den
USA dazu gezwungen worden sei.1 In diesem Zusammenhang tauchte die Integrationsgemeinschaft CARICOM2, in der Haiti das jüngste Mitglied darstellt, in der Medienberichterstattung auf. Sie weigerte sich, Aristide Glauben schenkend, an den UNSchutztruppen teilzunehmen.3 Anstatt also der Bevölkerung Haitis zu helfen, indem sie für Sicherheit sorgt und damit letztlich demokratische Verhältnisse in ihrem jüngsten Mitgliedsland begünstigt, stellte sie sich hinter Aristide. Es kommt die Frage auf, inwieweit sich die CARICOM, die sich zu demokratischen Werten bekennt, in ihrem Mitgliedsland um eine
Demokratisierung bemüht (hat). Welches Verhältnis hat die CARICOM also wirklich zu
Demokratie und verfolgt sie die Demokratieförderung als außenpolitisches Ziel? Der Sozialkonstruktivismus dient im Folgenden als Rahmen für die Behandlung dieser Thematik. Seine zentralen Aussagen zur Entstehung und Wirkung internationaler Organisationen werden
deshalb am Anfang der Arbeit vorgestellt. Wie und warum es zur Gründung der CARICOM
kam, welche Ziele sie verfolgt und welche zentralen strategischen Veränderungen es im Laufe
der Zeit gab, ist Gegenstand des nächsten Kapitels. Danach wird die aktuelle Struktur der
CARICOM mit ihren wichtigsten Institutionen dargestellt. Das generelle Verhältnis der
Gemeinschaft zur Demokratie und die Entstehung einer Demokratieförderungspolitik werden im
Anschluss daran behandelt. Zuletzt wird kritisch betrachtet, warum (das undemkratische) Haiti in
die Gemeinschaft aufgenommen wurde und inwieweit die CARICOM sich dort aktiv für die
Demokratie einsetzt. So soll exemplarisch die Demokratieförderungspolitik der CARICOM
beschrieben und beurteilt werden. 1Vgl. URL: http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20040531/lead/lead1.htm (31.05.2004)
2Caribbean Community; Karibische Gemeinschaft 3Vgl. URL http://www.caricom.org/newsflash-aristideinjamaica-patterson.htm (18.03.2004)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialkonstruktivismus
- Entstehung und Ziele der CARICOM
- Zentrale Veränderungen
- Die Organe der CARICOM
- Die CARICOM und die Demokratie
- Entstehung der Demokratieförderungspolitik
- Demokratiefördernde Institutionen
- Der Fall Haiti
- Aufnahmeprozess
- Demokratiefördernde Maßnahmen
- Wahlen 2000
- Putschversuch 2001
- 200 Jahre Unabhängigkeit
- Geschehnisse 2004
- Bewertung der Demokratieförderungspolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Demokratieförderungspolitik der Caribbean Community (CARICOM) am Beispiel Haitis. Sie analysiert, inwieweit sich die CARICOM, die sich zu demokratischen Werten bekennt, in ihrem Mitgliedsland um eine Demokratisierung bemüht. Der Sozialkonstruktivismus dient als theoretischer Rahmen, um die Entstehung und Wirkung der CARICOM zu verstehen.
- Die Entstehung und Ziele der CARICOM
- Zentrale Veränderungen im Laufe der Zeit
- Die Rolle der CARICOM bei der Demokratieförderung
- Die Aufnahme und Behandlung des Falls Haiti durch die CARICOM
- Eine kritische Bewertung der Demokratieförderungspolitik der CARICOM im Fall Haiti
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit und die Forschungsfrage vor, indem sie die Situation in Haiti Anfang 2004 und die Rolle der CARICOM in diesem Kontext beschreibt. Das zweite Kapitel erläutert den Sozialkonstruktivismus als theoretischen Rahmen und seine zentralen Aussagen zur Entstehung und Wirkung internationaler Organisationen. Kapitel 3 beleuchtet die Gründung der CARICOM, ihre Ziele und die wesentlichen strategischen Veränderungen, die sich im Laufe der Zeit ergeben haben. Kapitel 4 beschreibt die aktuelle Struktur der CARICOM und ihre wichtigsten Institutionen. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Verhältnis der CARICOM zur Demokratie und der Entstehung einer Demokratieförderungspolitik innerhalb der Gemeinschaft. Schließlich untersucht Kapitel 6 den Fall Haiti, indem es den Aufnahmeprozess, die Demokratiefördernden Maßnahmen der CARICOM und eine kritische Bewertung dieser Maßnahmen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Demokratieförderung, internationale Organisationen, Sozialkonstruktivismus, Caribbean Community (CARICOM), Haiti, politische Integration, regionale Zusammenarbeit, undemokratische Regierungen, politische Interventionen und die Bewertung der Wirksamkeit von Demokratieförderungsmaßnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die CARICOM?
Die CARICOM (Caribbean Community) ist eine Integrationsgemeinschaft karibischer Staaten, die sich unter anderem zu demokratischen Werten bekennt.
Wie verlief die Krise in Haiti im Jahr 2004?
Anfang 2004 kam es zu bewaffneten Aufständen, die zum Sturz und Exil von Präsident Jean Bertrand Aristide führten, gefolgt von einer internationalen Militärintervention.
Warum war die Haltung der CARICOM zu Haiti umstritten?
Die CARICOM weigerte sich zunächst, an UN-Schutztruppen teilzunehmen, da sie den Vorwürfen Aristides glaubte, von den USA zum Rücktritt gezwungen worden zu sein, was Fragen zu ihrer Demokratieförderung aufwarf.
Welche Rolle spielt der Sozialkonstruktivismus in der Arbeit?
Der Sozialkonstruktivismus dient als theoretischer Rahmen, um zu erklären, wie internationale Organisationen wie die CARICOM Identitäten bilden und politische Ziele wie Demokratisierung verfolgen.
Verfolgt die CARICOM aktiv eine Demokratieförderungspolitik?
Die Arbeit untersucht die Entstehung demokratiefördernder Institutionen innerhalb der CARICOM und bewertet deren Wirksamkeit am Beispiel der Maßnahmen in Haiti zwischen 2000 und 2004.
Warum wurde Haiti trotz politischer Instabilität in die CARICOM aufgenommen?
Die Arbeit betrachtet kritisch den Aufnahmeprozess Haitis und die Abwägung zwischen regionaler Integration und den demokratischen Mindeststandards der Gemeinschaft.
- Arbeit zitieren
- Nannette Remmel (Autor:in), 2004, Die Demokratieförderungspolitik der Caribbean Community - Der Fall Haiti, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26838