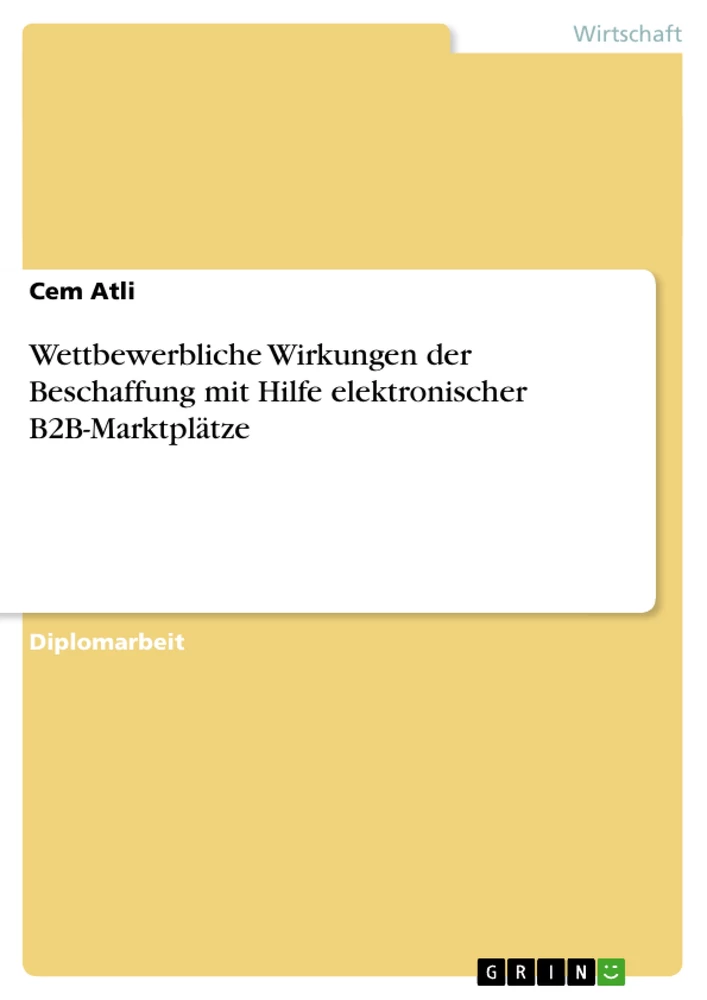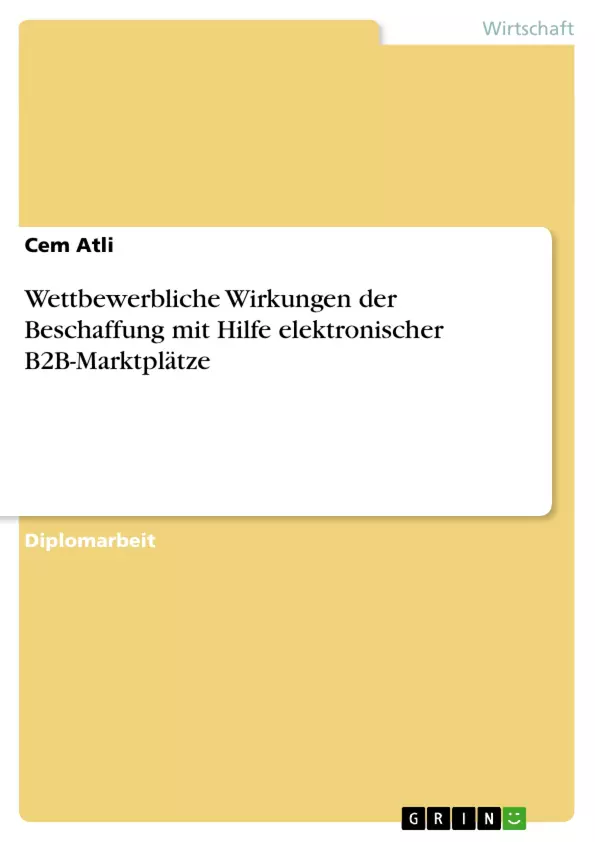Während E-Commerce für viele Unternehmen zunächst nur im Marketing- und Absatzbereich eine Rolle spielte, rücken seit Mitte der 90er Jahre zunehmend die Beschaffungsmöglichkeiten zwischen Unternehmen, die sogenannten B2B-Beziehungen, mit Hilfe der Internet-Technologie in den Blickpunkt des Interesses. Die Ursachen für die zunehmende Durchsetzung sind in erster Linie in der hohen Materialintensität von Industrieunternehmen zu sehen. Der Anteil fremdbezogener Leistungen am Umsatz liegt in vielen Branchen bereits deutlich über 50%. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass gerade in der Beschaffung eines Unternehmens enorme Kostensenkungspotentiale zu vermuten sind, die es durch die elektronische Unterstützung der Beschaffungsprozesse zu realisieren gilt. Die alte Kaufmannsregel „Im Einkauf liegt der Gewinn“ gilt also mehr denn je.
Durch die offenen Standards und der zunehmenden Diffusion des Internets werden vielfältige Möglichkeiten der elektronischen Unterstützung von Transaktionen im B2B-Bereich für eine Vielzahl von Unternehmen realisierbar. Angefangen mit der Nutzung des Internets als Informationsquelle für beschaffungsrelevante Daten, über die Optimierung des internen Beschaffungsprozesses durch den Einsatz von Intranets bis hin zur elektronischen Vernetzung mit externen Partnern wie Lieferanten und zur Nutzung elektronischer Marktplätze bietet sich ein weites Gestaltungsfeld.
Hierbei gewinnen vor allem elektronische Marktplätze an Bedeutung, weil sie sowohl zu erheblichen Ersparnissen bei den Transaktionskosten als auch zur Steigerung des Transaktionsnutzens führen können. Die Beschaffung über elektronische Marktplätze eröffnet den Unternehmen immense Potenziale. Neben einer weltweiten Markt- und Preistransparenz lassen sich die Beschaffungsprozesse beschleunigen, die Prozesskosten minimieren und insbesondere die gesamte Lieferkette optimieren. Die verbesserte Markt- und Preistransparenz führt zu verstärktem Wettbewerb zwischen den Anbietern und wirkt insgesamt transaktionskostensenkend.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Ziel und Vorgehensweise
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Neoklassisches Marktmodell
- 2.1.1. Annahmen
- 2.1.2. Aussagekraft
- 2.2. Erklärungsansätze der Neuen Institutionenökonomie (NIÖ)
- 2.2.1. Teiltheorien der NIÖ
- 2.2.2. Transaktionskostentheorie
- 2.2.3. Grundformen der Koordination
- 2.2.3.1. Markt
- 2.2.3.2. Hierarchie
- 2.2.3.3. Kooperation
- 2.2.3.4. Vergleich der Koordinationsformen
- 2.2.3.5. Einfluss von luk-Technik auf die Koordinationsformen
- 2.3. Wettbewerbstheorie
- 2.3.1. Begriffsdefinition
- 2.3.2. Ziele der Wettbewerbspolitik und Funktionen des Wettbewerbs
- 2.3.3. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- 2.3.4. Wettbewerbspolitische Eingriffsmöglichkeiten
- 3. Besonderheiten des Mediums Internet in der Beschaffung
- 3.1. Die Infrastruktur des Internet
- 3.2. Ziele von E-Procurement
- 3.3. Transaktionsphasen des elektronischen Beschaffungsprozesses
- 3.4. Eignung der E-Procurement-Tools klassifiziert nach Gütergruppen
- 3.5. Besondere Effekte der Internet-Ökonomie
- 3.5.1. Kommunikationseffekt
- 3.5.2. Integrationseffekt
- 3.5.3. Dis-Intermediation, Re-Intermediation und neue Intermediäre
- 3.5.4. Positive Feedback-Effekte
- 4. Elektronische B2B-Marktplätze
- 4.1. Begriffsdefinition
- 4.2. Klassifikationskriterien elektronischer B2B-Marktplätze
- 4.2.1. Klassifikation nach der Branchenausrichtung
- 4.2.1.1. horizontale Marktplätze
- 4.2.1.2. vertikale Marktplätze
- 4.2.2. Klassifikation nach dem Betreibermodell
- 4.2.2.1. Buy-Side-Marktplätze
- 4.2.2.2. Sell-Side-Marktplätze
- 4.2.2.3. neutrale Marktplätze
- 4.2.3. Klassifikation nach der Art des Zugangs
- 4.2.3.1. Geschlossene Marktplätze
- 4.2.3.2. Offene Marktplätze
- 4.2.4. Klassifikation nach Preisfindungsmechanismen
- 4.2.4.1. Schwarze Bretter
- 4.2.4.2. Kataloge
- 4.2.4.3. Auktionen
- 4.2.4.4. Börsen
- 4.3. Entwicklungsphasen und aktueller Stand elektronischer B2B-Marktplätze
- 5. Auswirkungen der elektronischen Beschaffung auf den Wettbewerb
- 5.1. Treibende Entwicklungen der elektronischen Beschaffung
- 5.2. Indikatoren für die wettbewerbliche Positionierung von Unternehmen
- 5.2.1. Branchenstrukturanalyse nach Porter
- 5.2.2. Einfluss der elektronischen B2B-Marktplätze auf die Wettbewerbskräfte
- 5.3. Optimierungspotentiale der Wettbewerbsposition von Unternehmen
- 5.3.1. Operative Ebene
- 5.3.2. Strategische Ebene
- 5.4. Wettbewerbsbeschränkende Faktoren
- 5.4.1. Marktstruktur
- 5.4.2. Standardisierungsgrad gehandelter Produkte
- 5.4.3. Technologische Reife der elektronischen Marktplätze
- 5.5. Kritische Analyse der Bedingungen des vollkommenen Marktes
- 5.5.1. Atomistische Angebots- und Nachfragestruktur
- 5.5.2. Fehlende Präferenzen
- 5.5.3. Vollständige Markttransparenz
- 5.5.4. Offene Märkte
- 5.5.5. Unendliche Anpassungsgeschwindigkeit
- 5.5.6. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6. Schlussbetrachtung
- Analyse der theoretischen Grundlagen des Wettbewerbs und der Beschaffung
- Bedeutung der Neuen Institutionenökonomie für das Verständnis der elektronischen Beschaffung
- Einfluss der Informations- und Kommunikationstechnologie auf den Beschaffungsprozess
- Wettbewerbswirkungen von elektronischen B2B-Marktplätzen
- Kritische Betrachtung der Voraussetzungen für einen funktionsfähigen Wettbewerb im Kontext der elektronischen Beschaffung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen elektronischer B2B-Marktplätze auf den Wettbewerb im Beschaffungsprozess. Sie untersucht, welche Wettbewerbsvorteile sich für Unternehmen durch den Einsatz dieser Plattformen ergeben und welche Herausforderungen es zu bewältigen gilt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und Zielsetzung des Projekts beschreibt. Anschließend werden die relevanten theoretischen Grundlagen wie das neoklassische Marktmodell, die Neue Institutionenökonomie und die Wettbewerbstheorie dargestellt. Kapitel 3 konzentriert sich auf die Besonderheiten des Internet als Medium im Beschaffungsprozess und beleuchtet die Ziele des E-Procurement sowie die Transaktionsphasen des elektronischen Beschaffungsprozesses.
Kapitel 4 fokussiert auf elektronische B2B-Marktplätze und klassifiziert diese nach verschiedenen Kriterien. Kapitel 5 analysiert die Auswirkungen der elektronischen Beschaffung auf den Wettbewerb und untersucht, welche Faktoren den Wettbewerb beeinflussen und welche Optimierungspotentiale sich für Unternehmen ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt wichtige Themen wie elektronische Beschaffung, B2B-Marktplätze, Wettbewerb, Neue Institutionenökonomie, Transaktionskosten, E-Procurement, Intermediation, Marktstruktur, Standardisierung und Informationsasymmetrie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile bieten elektronische B2B-Marktplätze im Einkauf?
Sie ermöglichen erhebliche Einsparungen bei Transaktionskosten, beschleunigen Beschaffungsprozesse und erhöhen die weltweite Markt- und Preistransparenz.
Was ist der Unterschied zwischen horizontalen und vertikalen Marktplätzen?
Horizontale Marktplätze bieten branchenübergreifende Güter an (z. B. Bürobedarf), während vertikale Marktplätze auf spezifische Branchen spezialisiert sind.
Wie beeinflusst E-Procurement die Wettbewerbsposition eines Unternehmens?
Durch Prozessoptimierung und bessere Einkaufskonditionen können Unternehmen Kostenvorteile erzielen und ihre gesamte Lieferkette effizienter gestalten.
Welche Rolle spielt die Transaktionskostentheorie im B2B-Bereich?
Sie hilft zu erklären, warum elektronische Märkte oft effizienter sind als traditionelle Hierarchien oder Kooperationen, indem sie die Kosten für Informationssuche und Abwicklung senken.
Was sind Buy-Side- und Sell-Side-Marktplätze?
Buy-Side-Marktplätze werden von den Nachfragern kontrolliert, während Sell-Side-Marktplätze von den Anbietern betrieben werden, um ihre Produkte elektronisch zu vertreiben.
- Quote paper
- Cem Atli (Author), 2004, Wettbewerbliche Wirkungen der Beschaffung mit Hilfe elektronischer B2B-Marktplätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26843