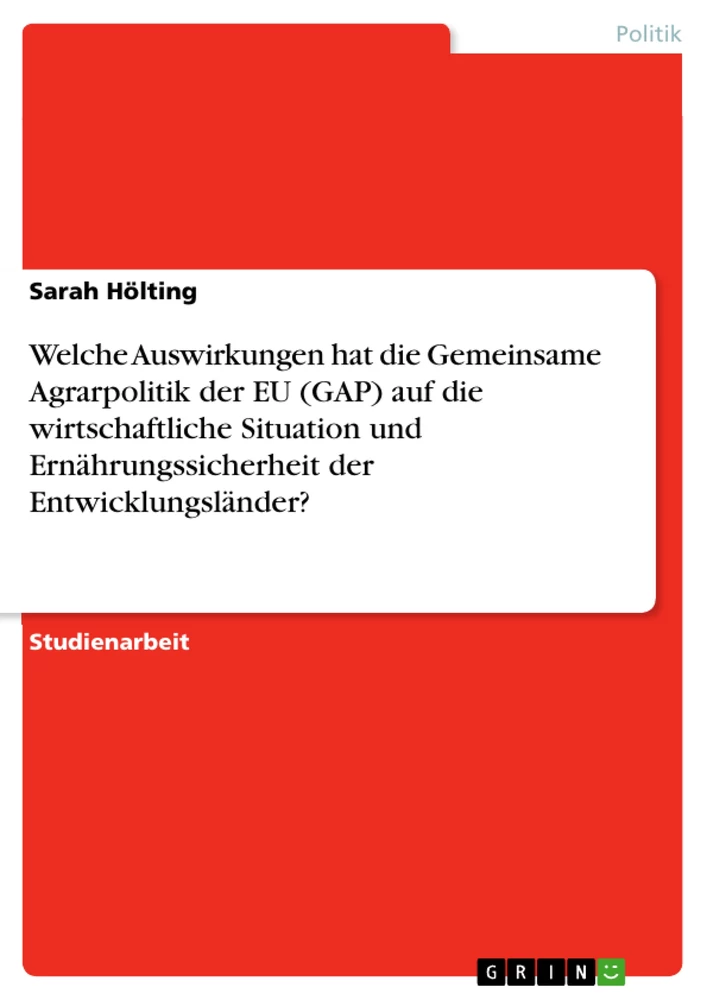2009 flossen rund 59, 6 Mrd. € der gesamten Ausgaben des EU-Haushalts in die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union (EU), womit die Agrarausgaben im EU-Budget zum zweitgrößten Einzeletat gehören (Rohwer, 2010: 27). Oft werden und wurden diese Ausgaben für protektionistische Maßnahmen im Agrarsektor eingesetzt, um die EU-Bauern vor der internationalen Konkurrenz zu schützen. In der vorliegenden Hausarbeit möchte ich überprüfen, ob die Kritik gerechtfertigt ist, dass Entwicklungsländer durch die agrarpolitischen Praktiken der EU in ihrer Entwicklung gehemmt werden....
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Welche Länder gelten als Entwicklungsländer?
3 Innen- und außenwirtschaftliche Stellung der Entwicklungsländer im internationalen Agrarhandel
4 Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
4.1 Ziele und Prinzipien der GAP
4.2 Entwicklung der GAP
4.2.1 Vom Nahrungsmittelimporteur zum Selbstversorger
4.2.2 Enorme Produktivitätssteigerung
4.2.3 Krise in den 1980er Jahren
4.2.4 MacSharry-Reform 1992: Von der Marktstützungs- zur Einkommenspolitik
4.2.5 Agenda 2000
4.2.6 Agrarreform 2003
4.2.7 Health Check 2008
5 Auswirkungen der GAP auf die Entwicklungsländer
5.1 EU-Exportsubventionen schuld am .Abstieg “ zum Nettoagrarimporteur?
5.2 Direktzahlungen
6 Ausweg aus der Krise?
7 Ausblick - Reform bis 2013
Literatur
Anhang
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)?
Die GAP ist das System der Agrarsubventionen und -regulierungen der EU, das einen bedeutenden Teil des EU-Haushalts ausmacht.
Wie beeinflussen EU-Exportsubventionen Entwicklungsländer?
Subventionierte EU-Produkte können lokale Märkte in Entwicklungsländern überschwemmen und dortige Bauern preislich unterbieten, was deren Existenz gefährdet.
Was war das Ziel der MacSharry-Reform 1992?
Die Reform leitete den Übergang von einer reinen Marktstützung (Preiseingriffe) hin zu einer direkten Einkommenspolitik für Landwirte ein.
Was bedeutet Ernährungssicherheit in diesem Kontext?
Es geht um die Frage, ob die GAP dazu beiträgt oder verhindert, dass Entwicklungsländer eine stabile eigene Nahrungsmittelversorgung aufbauen können.
Welche Rolle spielen Direktzahlungen heute?
Direktzahlungen unterstützen das Einkommen der EU-Bauern, werden aber oft als indirekter Wettbewerbsvorteil gegenüber ungesicherten Produzenten im globalen Süden kritisiert.
- Quote paper
- Sarah Hölting (Author), 2012, Welche Auswirkungen hat die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) auf die wirtschaftliche Situation und Ernährungssicherheit der Entwicklungsländer?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268458