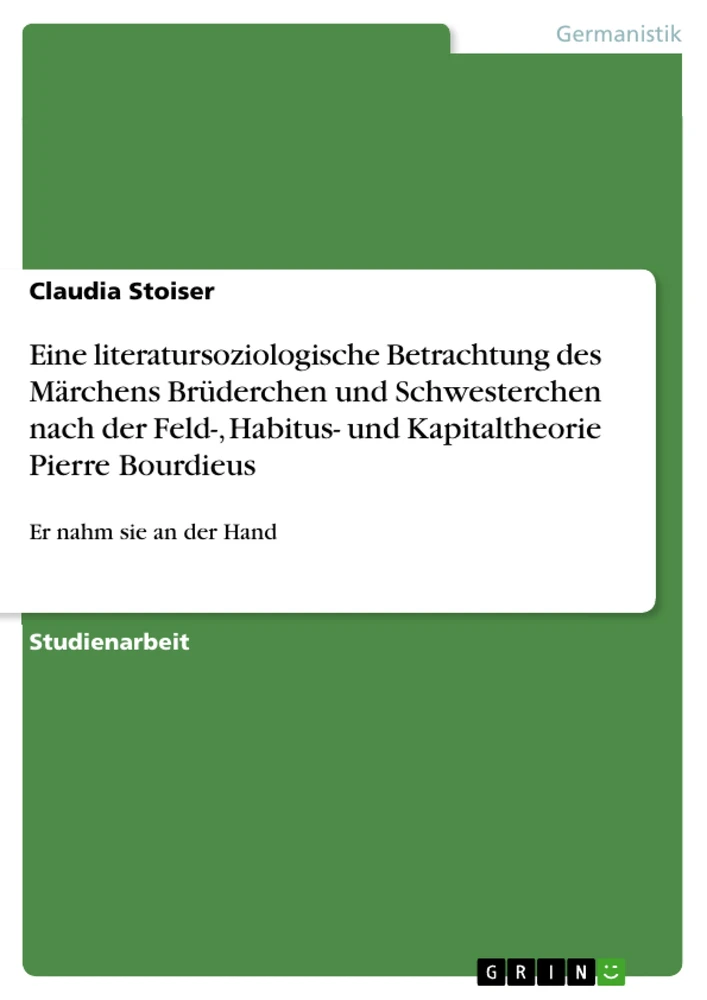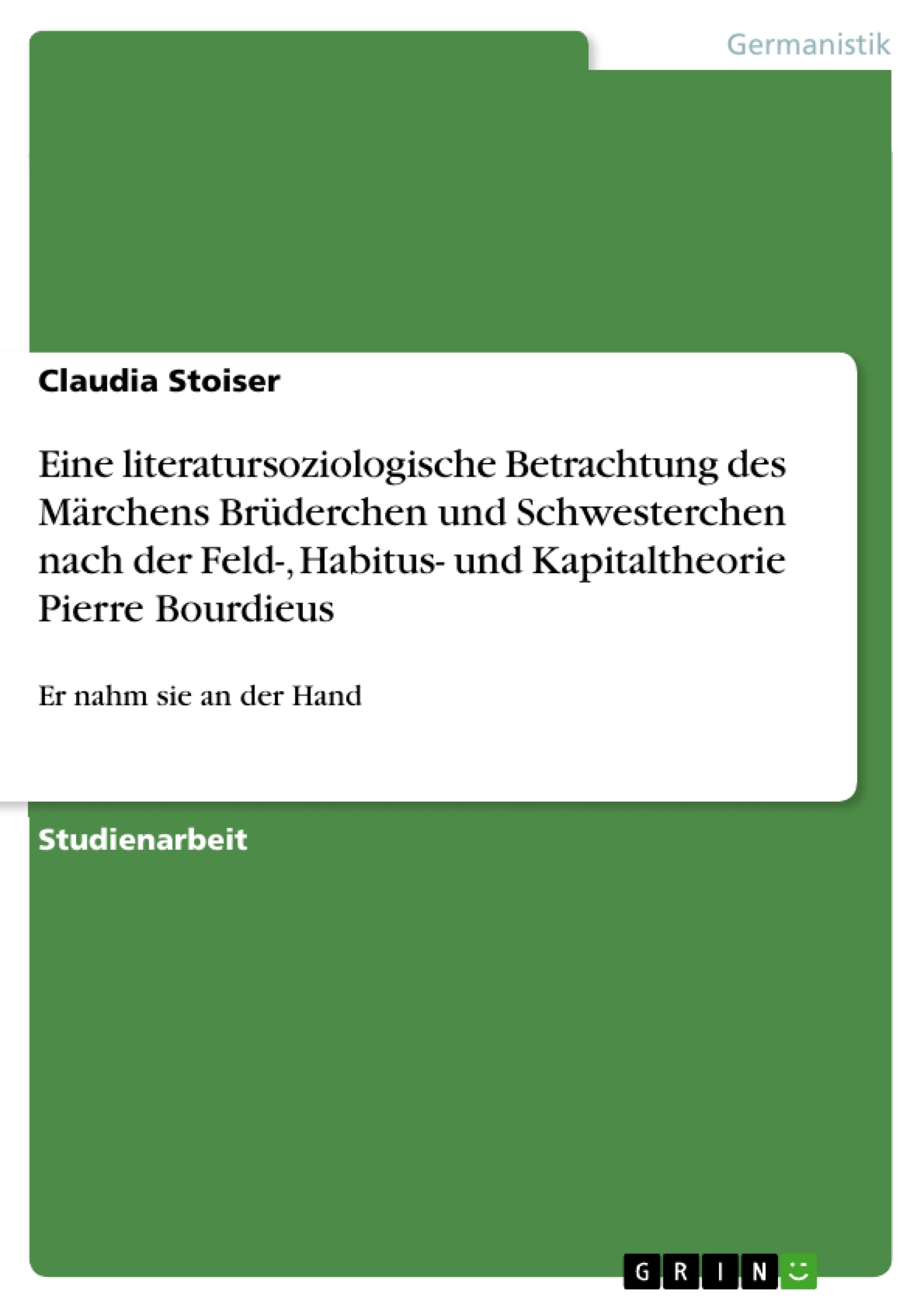Die vorliegende Seminararbeit untersucht das Grimmsche Märchen Nr. 11, Brüderchen und Schwesterchen, nach Pierre Bourdieus literatursoziologischen Ansätzen. Obwohl die Darstellung des Märchens an einigen Stellen werkimmanent bleiben muss, ist es literatursoziologisch notwendig, empirische Rahmendaten zum Betrachtungsbereich anzuführen, denn nach Heinz Rölleke ist „[d]as einigermaßen komplizierte Phänomen des Grimmschen Märchens [...] zu einem gewichtigen Teil durch seine Schöpfungsepoche und die Persönlichkeiten seiner Schöpfer bestimmt“. Deswegen ist es für eine literatursoziologische Analyse eines fiktionalen Werkes und im Sinne Bourdieus aufschlussreich, auch das (literarische) Feld der Kinder- und Hausmärchen zu beachten. Da jedoch die Betrachtung des Textes Brüderchen und Schwesterchen nach der Feld-, Habitus- und Kapitaltheorie Bourdieus im Vordergrund dieser Arbeit stehen soll, werden lediglich die wichtigsten Eckpunkte der zeitgenössischen Produktion, Distribution und Rezeption der Kinder- und Hausmärchen berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Literatursoziologie
- 2.1 Pierre Bourdieus Feld-, Habitus- und Kapitaltheorie
- 2.1.1 Feldtheorie und sozialer Raum
- 2.1.2 Der Begriff des Habitus
- 2.1.3 Die vier Kapitalarten
- 3. Das (literarische) Feld der Kinder- und Hausmärchen: Produktion - Distribution - Rezeption
- 3.1 Soziales Kapital der Brüder Grimm und seine Auswirkungen
- 3.2 Entwicklungen im Medienbereich und das Leseverhalten in Hinblick auf die Lesesozialisation von Kindern in der Biedermeierzeit
- 4. Er nahm sie an der Hand - Brüderchen und Schwesterchen (KHM 11)
- 4.1 Quellen, Tradierung und die soziale Position der Beiträgerin
- 4.2 Vergleiche der Textfassungen von 1810, 1812 Anhang, 1812 und 1837 (= 1819/1857): Abriss der Inhalte in Hinblick auf betrachtungsrelevante Unterschiede
- 4.2.1 Goldner Hirsch
- 4.2.2 Zum Brüderchen und Schwesterchen. No. 11
- 4.2.3 Brüderchen und Schwesterchen (1812)
- 4.2.4 Brüderchen und Schwesterchen (1837)
- 4.3 Analyse der Unterschiede: Feld, Sozialstruktur, Habitus, Kapital und gesellschaftsbedingte Einflüsse
- 4.3.1 Das soziale Feld in Brüderchen und Schwesterchen
- 4.3.2 Gesellschaftsbedingte Einflüsse und Veränderungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Grimmsche Märchen "Brüderchen und Schwesterchen" (KHM 11) unter Anwendung der literatursoziologischen Theorien Pierre Bourdieus. Die Arbeit analysiert die gesellschaftlichen Bedingungen der Entstehung und Rezeption des Märchens und beleuchtet die Interaktion zwischen fiktionalem und realem sozialen Feld. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Figuren, ihrer sozialen Positionen und ihres Habitus im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit.
- Anwendung der Feld-, Habitus- und Kapitaltheorie Bourdieus auf ein literarisches Werk
- Analyse der sozialen Positionen der Figuren in "Brüderchen und Schwesterchen"
- Untersuchung der gesellschaftlichen Einflüsse auf die Entwicklung des Märchens über verschiedene Fassungen hinweg
- Bedeutung von Kapitalarten (soziales Kapital, etc.) im Kontext des Märchens
- Verbindung zwischen fiktionalem Handlungsfeld und realem historischem Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt den Ansatz, das Märchen "Brüderchen und Schwesterchen" mit Hilfe der literatursoziologischen Theorie Pierre Bourdieus zu analysieren. Es wird betont, dass die Analyse sowohl werk-immanente Aspekte als auch den historischen Kontext berücksichtigt, um die gesellschaftlichen Einflüsse auf das Märchen zu verstehen. Die Schwierigkeiten einer solchen Analyse werden angesprochen, insbesondere die Übertragung fiktionaler Elemente auf die Realität. Die Bedeutung von Textvergleichen verschiedener Fassungen des Märchens für die Untersuchung der gesellschaftlichen Einflüsse wird hervorgehoben.
2. Literatursoziologie: Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen der Literatursoziologie und beschreibt den Fokus auf gesellschaftliche Zusammenhänge in der Entstehung und Wirkung von Literatur. Die Relevanz von Produktion, Distribution und Rezeption literarischer Texte wird betont. Das Kapitel dient als theoretische Grundlage für die spätere Analyse des Märchens.
2.1 Pierre Bourdieus Feld-, Habitus- und Kapitaltheorie: Dieses Kapitel stellt die zentralen Konzepte von Pierre Bourdieus soziologischer Theorie vor – Feld, Habitus und Kapital. Es wird der enge Zusammenhang zwischen diesen drei Konzepten und deren wechselseitige Beeinflussung erklärt. Die Anwendung dieser Theorie auf die Analyse von "Brüderchen und Schwesterchen" und das Feld der Kinder- und Hausmärchen wird vorbereitet. Der Begriff des Feldes als ein sozialer Raum mit verschiedenen Positionen und Machtverhältnissen wird detailliert erläutert.
3. Das (literarische) Feld der Kinder- und Hausmärchen: Produktion - Distribution - Rezeption: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Kontext der Entstehung der Kinder- und Hausmärchen, untersucht die Rolle der Brüder Grimm und deren soziales Kapital, und analysiert Entwicklungen im Medienbereich und ihre Auswirkung auf das Leseverhalten von Kindern der Biedermeierzeit. Es bietet den notwendigen historischen und soziologischen Hintergrund für die Interpretation des Märchens.
4. Er nahm sie an der Hand - Brüderchen und Schwesterchen (KHM 11): Dieses Kapitel widmet sich der detaillierten Analyse des Märchens "Brüderchen und Schwesterchen" selbst. Es beginnt mit einer Untersuchung der Quellen und der sozialen Position der ursprünglichen Erzählerin. Vergleiche verschiedener Textfassungen helfen, die Entwicklung des Märchens über die Zeit und die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen nachzuvollziehen. Die Analyse konzentriert sich auf die Figuren, ihre Positionen im sozialen Feld, ihren Habitus und wie diese Aspekte durch gesellschaftliche Einflüsse geprägt wurden. Die Darstellung von Standesunterschieden, Mutter- und Stiefmutterbild, juristische Entwicklungen und die Bedeutung von Natur werden im Kontext der Bourdieu'schen Theorie untersucht.
Schlüsselwörter
Pierre Bourdieu, Feldtheorie, Habitus, Kapital, Literatursoziologie, Kinder- und Hausmärchen, Brüder Grimm, Brüderchen und Schwesterchen, Sozialstruktur, Gesellschaftsgeschichte, Märchenanalyse, Textvergleich, soziale Positionen, Figurencharakterisierung, Biedermeierzeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von "Brüderchen und Schwesterchen" mit Bourdieus Theorie
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert das Grimmsche Märchen "Brüderchen und Schwesterchen" (KHM 11) unter Anwendung der literatursoziologischen Theorien Pierre Bourdieus. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der gesellschaftlichen Bedingungen der Entstehung und Rezeption des Märchens und der Interaktion zwischen fiktionalem und realem sozialen Feld.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf Pierre Bourdieus Feld-, Habitus- und Kapitaltheorie. Diese Theorie wird verwendet, um die sozialen Positionen der Figuren im Märchen, ihre Handlungsweisen und die gesellschaftlichen Einflüsse auf die Entwicklung des Märchens über verschiedene Fassungen hinweg zu analysieren.
Welche Aspekte des Märchens werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Figuren, ihre sozialen Positionen und ihren Habitus im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit. Es werden verschiedene Fassungen des Märchens verglichen, um die Entwicklung des Textes und die damit verbundenen gesellschaftlichen Einflüsse nachzuvollziehen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Darstellung von Standesunterschieden, dem Mutter- und Stiefmutterbild, juristischen Entwicklungen und der Bedeutung von Natur gewidmet.
Wie wird Bourdieus Theorie angewendet?
Die Konzepte des Feldes als sozialer Raum mit verschiedenen Positionen und Machtverhältnissen, des Habitus als verinnerlichte Handlungsweise und des Kapitals (soziales Kapital etc.) werden auf das Märchen angewendet, um die sozialen Dynamiken und Machtstrukturen im fiktionalen Handlungsfeld zu analysieren und mit dem realen historischen Kontext zu verbinden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Literatursoziologie und Bourdieus Theorie, ein Kapitel zum literarischen Feld der Kinder- und Hausmärchen, und ein Kapitel zur detaillierten Analyse von "Brüderchen und Schwesterchen". Das letzte Kapitel beinhaltet die Untersuchung der Quellen des Märchens, Vergleiche verschiedener Fassungen und eine Analyse der Figuren im Kontext von Feld, Habitus und Kapital.
Welche Bedeutung haben die verschiedenen Fassungen des Märchens?
Der Vergleich verschiedener Fassungen von "Brüderchen und Schwesterchen" (1810, 1812 Anhang, 1812 und 1837) ermöglicht es, die Entwicklung des Märchens über die Zeit zu verfolgen und die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich in diesen Änderungen widerspiegeln, zu analysieren. Diese Veränderungen werden im Kontext von Bourdieus Theorie interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pierre Bourdieu, Feldtheorie, Habitus, Kapital, Literatursoziologie, Kinder- und Hausmärchen, Brüder Grimm, Brüderchen und Schwesterchen, Sozialstruktur, Gesellschaftsgeschichte, Märchenanalyse, Textvergleich, soziale Positionen, Figurencharakterisierung, Biedermeierzeit.
Welche Herausforderungen birgt die Analyse?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen bei der Übertragung fiktionaler Elemente auf die Realität und die Interpretation der gesellschaftlichen Bedingungen anhand eines literarischen Werkes. Die komplexe Interaktion zwischen fiktionalem und realem sozialen Feld wird berücksichtigt.
- Citar trabajo
- Bakk. MA Claudia Stoiser (Autor), 2009, Eine literatursoziologische Betrachtung des Märchens Brüderchen und Schwesterchen nach der Feld-, Habitus- und Kapitaltheorie Pierre Bourdieus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268609