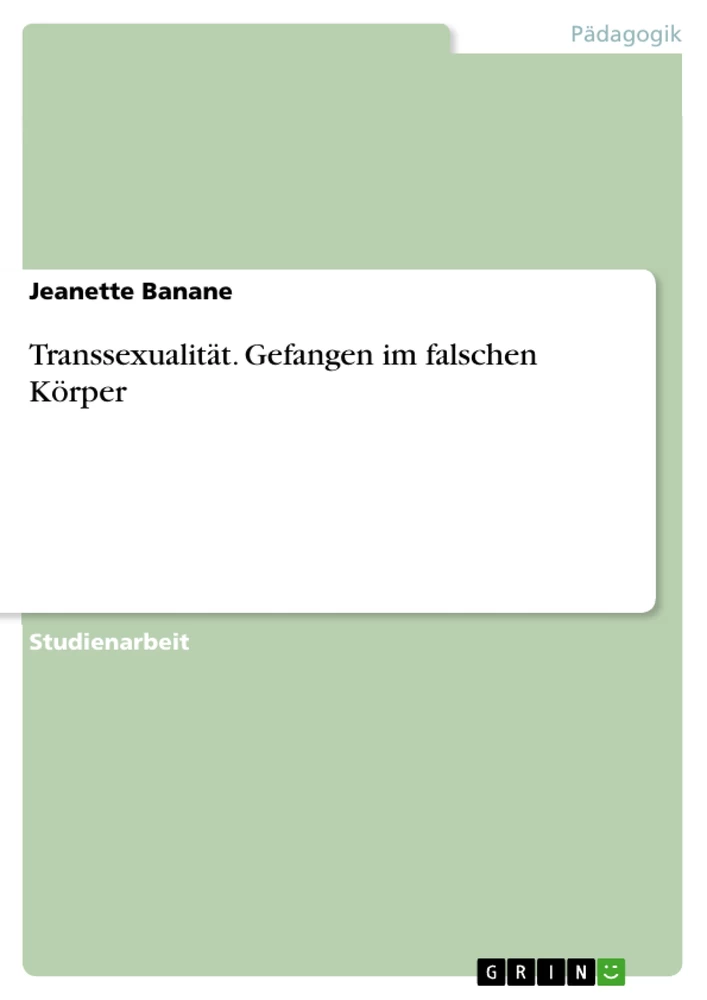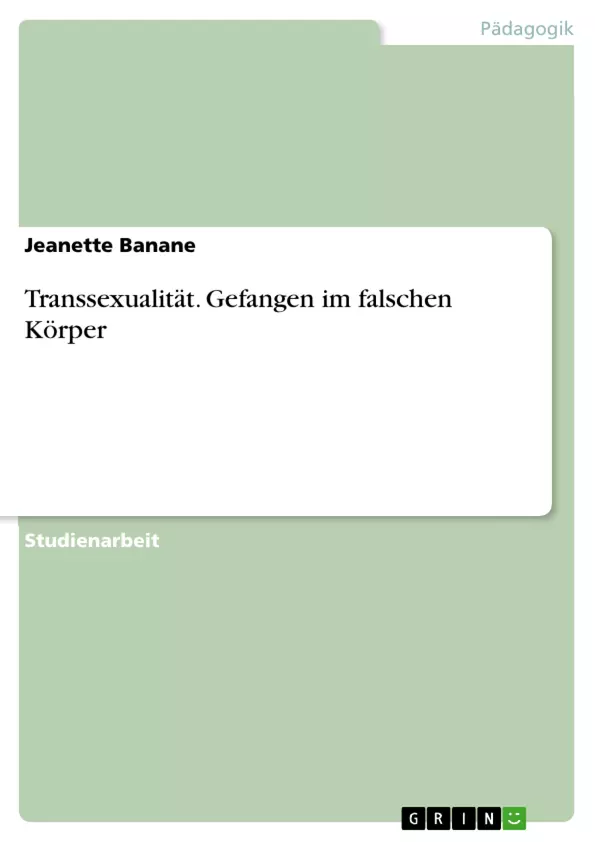Ziel meiner Arbeit war es, das Thema Transsexualität etwas genauer zu betrachten, die verschiedenen Formen darzustellen und den Weg, insbesondere von Transfrauen sowie die Probleme von Transsexuellen genauer darzustellen.
Es handelt sich um eine Abschlussarbeit im Rahmen der Sonderpädagogischen Zusatzausbildung.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Transsexualität – Was ist das?
3 Formen der Geschlechtsidenditätsstörung
3.1 Transsexualität
3.2 Transgender
3.3 Transvestitismus
3.4 Intersexualität
3.5 Travestie
3.6 Androgynie
4 Gründe für Transsexualität – Vermutungen
4.1 Psychosoziale Erklärungsversuche
4.2 Biologische Erklärungsversuche
4.2.1 Polyzystisches Ovarialsyndrom bei Frau-zu-Mann Transsexuellen
4.2.2 Hormonelle Einflüsse
4.2.3 Gen für Transsexualität
4.2.4 Besonderheiten im Hypothalamus
4.2.5 Klinefelder Syndrom
5 Der innere Weg zum neuen Ich
5.1 Die Erkenntnis
5.2 Der Weg zum Arzt
5.3 Gleichgesinnte finden
5.4 Entschluss gefasst – Ja zum neuen Leben
6 Der medizinische/ juristische Weg – am Beispiel von Mann zu Frau
6.1 Die Diagnose
6.2 Psychotherapie
6.3 Die Alltagserprobung
6.4 Die Hormonbehandlung
6.5 Die Namensänderung – „kleine Lösung“
6.6 Die Operation – endlich eine Frau
6.7 Die Haarentfernung
6.8 Die Personenstandsänderung – „große Lösung“
6.9 Endlich eine richtige Frau!?
7 Die Alltagsprobleme
8 Fazit
Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Abschlussarbeit über Transsexualität?
Ziel der Arbeit ist es, das Thema Transsexualität detailliert zu betrachten, verschiedene Formen der Geschlechtsidentität zu unterscheiden und insbesondere den Weg von Transfrauen sowie deren Alltagsprobleme darzustellen.
Welche Formen der Geschlechtsidentitätsstörung werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen Transsexualität, Transgender, Transvestitismus, Intersexualität, Travestie und Androgynie.
Welche biologischen Erklärungsversuche für Transsexualität werden genannt?
Es werden hormonelle Einflüsse, genetische Faktoren, Besonderheiten im Hypothalamus sowie Syndrome wie das Polyzystische Ovarialsyndrom und das Klinefelter-Syndrom angeführt.
Wie sieht der medizinische und juristische Weg für Transfrauen aus?
Dieser Weg umfasst Diagnose, Psychotherapie, Alltagserprobung, Hormonbehandlung, operative Eingriffe sowie die rechtliche Namens- und Personenstandsänderung („kleine“ und „große Lösung“).
In welchem Rahmen wurde diese Arbeit verfasst?
Es handelt sich um eine Abschlussarbeit im Rahmen einer Sonderpädagogischen Zusatzausbildung.
- Quote paper
- Jeanette Banane (Author), 2014, Transsexualität. Gefangen im falschen Körper, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268622