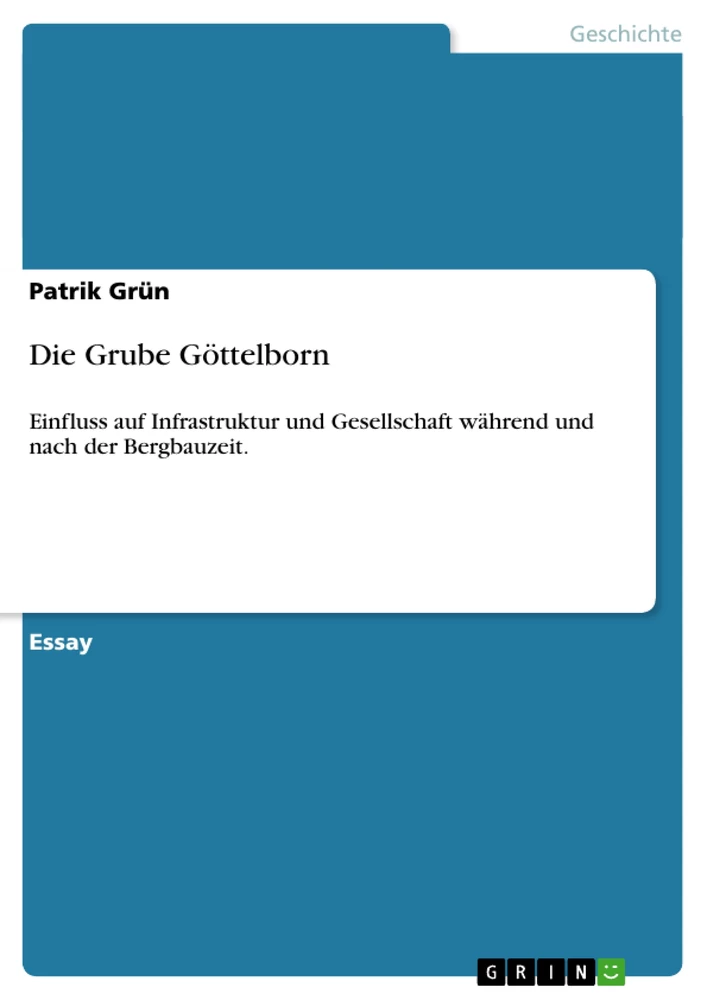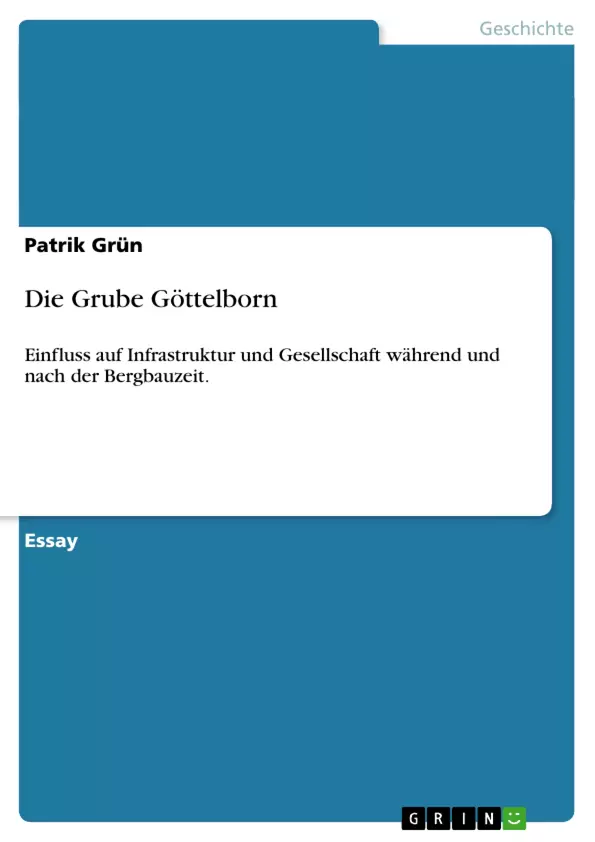Kurzer Überblick darüber, welche infrastrukturellen Auswirkungen die Grube Göttelborn auf den Ort hatte.
Die Gemeinde Göttelborn, heute ein Ortsteil der Gemeinde Quierschied, liegt im südlichen Saarland, ca. zwölf Kilometer nördlich der Landeshauptstadt Saarbrücken. Wie viele Siedlungen in dieser Region, blickt auch Göttelborn auf eine Vergangenheit zurück, die eng verbunden mit dem Bergbau ist.
Gesichert ist, dass hier spätestens seit dem Jahr 1771 eine private Kohlengrube existierte, aus der wohl in der Mitte der 1880er Jahre schließlich die königliche Steinkohlegrube entstand. Der Kohleabbau florierte, wovon auch der stete Ausbau der Anlage zeugt. So wurden in der 1920er Jahren zwei zusätzliche Fördertürme erbaut, um die Ertragsleistung der Grube zu erhöhen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, genauer im Jahr 1954, übernahm schließlich die Saarbergwerke AG die Grube Göttelborn. Die Förderleistung lag in den folgenden Jahrzehnten stets im internationalen Spitzenbereich: So konnte man 1978 sogar einen Weltrekord[1] für die bei einem Schachtdurchmesser 6,50 Meter schnellste Bohrgeschwindigkeit aufstellen.
Gegen Ende der 80er Jahre wurde die Grube Göttelborn schließlich mit den Gruben Warndt-Luisenthal und Ensdorf aufgrund logistischer Argumente zusammengelegt und zusätzlich mit der Grube Reden zum Verbundwerk Göttelborn-Reden zusammengefasst. Es deutete sich in dieser Zeit bereits an, dass man aufgrund struktureller Nachteile auf dem internationalen Kohlemarkt ins Hintertreffen geraten war, insofern waren diese Vorgänge als Kostensenkungsmaßnahmen zu verstehen.
Im Jahr 1994 wurde mit Schacht IV schließlich der bis heute höchste Förderturm der Welt in Göttelborn eingeweiht. Obwohl sein Bau als Zeichen für die Sicherheit des Kohlebergbaus in der Region gedacht war, wurde die Göttelborner Grube jedoch bereits sechs Jahre später geschlossen. Gründe hierfür waren u.a. die sinkenden Subventionszahlungen und die im internationalen Vergleich hohen Produktionskosten, sodass der Bergbau in Göttelborn nicht mehr rentabel erschien.
Inzwischen ist bereits bundes- wie europaweit der Ausstieg aus der Kohleförderung beschlossen, sodass im Jahr 2012 das letzte saarländische Kohlebergwerk (Bergwerk Saar in Ensdorf/ Saarlouis) geschlossen und spätestens im Jahr 2018 der Kohleabbau in Deutschland endgültig eingestellt werden soll.
Während der Zeit der Kohleförderung in Göttelborn sind enge Verbindungen zwischen dem Ort und der Abbauanlage erwachsen.
[...]
[1] Nach Simmet, Helmut: Göttelborn. Vom Werden und Wachsen eines vom Bergbau geprägten Ortes. Göttelborn 1998, S. 172. Simmet spricht an dieser Stelle von der „Meinung von Experten“, nennt hierfür jedoch keinen wissenschaftlichen Nachweis bzw. keine wissenschaftliche Quelle.
Häufig gestellte Fragen
Wo befindet sich die Grube Göttelborn?
Die Grube liegt im südlichen Saarland, etwa zwölf Kilometer nördlich von Saarbrücken, in der Gemeinde Quierschied.
Was ist das Besondere am Schacht IV der Grube?
Schacht IV beherbergt den bis heute höchsten Förderturm der Welt, der 1994 eingeweiht wurde.
Wann wurde die Grube Göttelborn geschlossen?
Trotz des modernen Förderturms wurde die Grube bereits im Jahr 2000 aufgrund mangelnder Rentabilität geschlossen.
Welchen Weltrekord hielt die Grube im Jahr 1978?
Sie stellte einen Weltrekord für die schnellste Bohrgeschwindigkeit bei einem Schachtdurchmesser von 6,50 Metern auf.
Warum endete der Bergbau in Göttelborn?
Gründe waren sinkende Subventionszahlungen und die im internationalen Vergleich zu hohen Produktionskosten der Steinkohle.
- Citar trabajo
- Patrik Grün (Autor), 2010, Die Grube Göttelborn, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268680