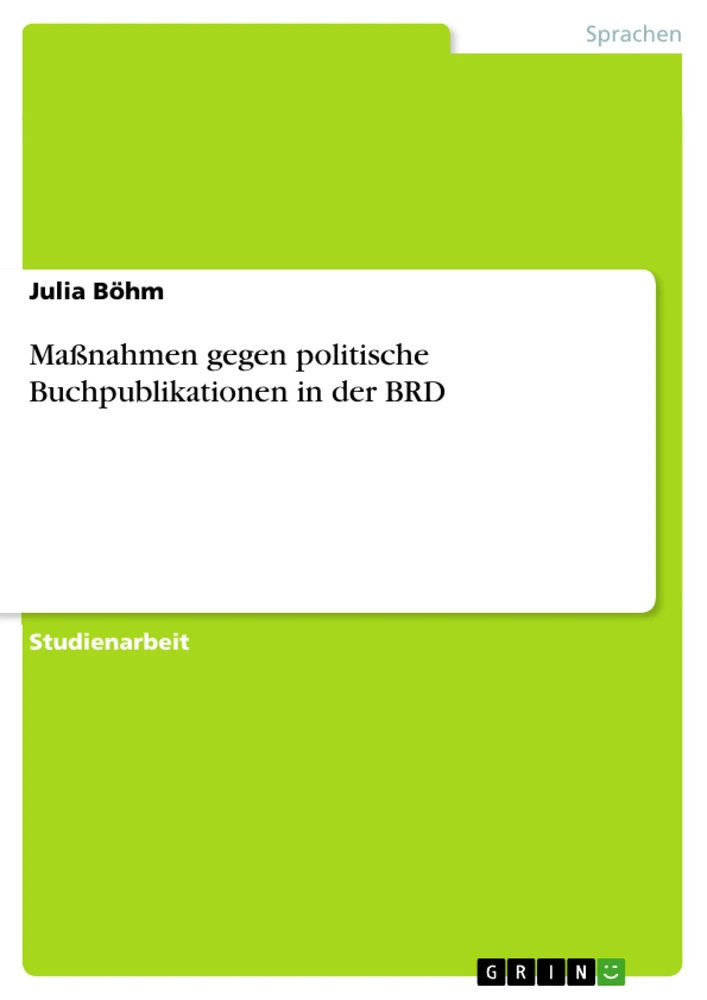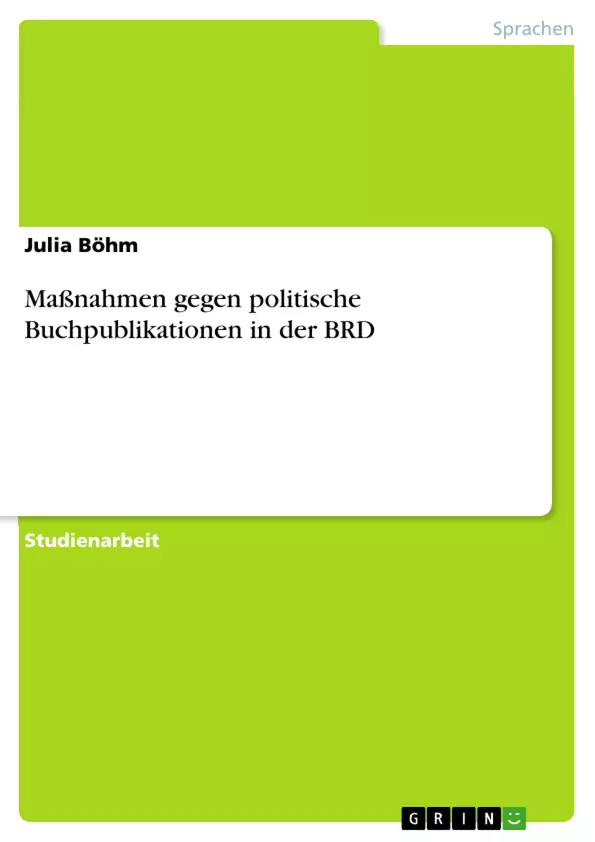Der Begriff „Zensur“ ist sehr weitläufig und facettenreich. Im Laufe der Zeit wurde er immer wieder neu definiert, verändert und in unterschiedlichen Rahmenbedingungen umgesetzt. Auf Grund der verschiedenen Texte und Definitionen zum Thema Zensur und den verschiedenen Gesellschaftsbedingungen, in denen diese entstanden sind, fällt es schwer eine einzige geltende Definition des Begriffs Zensur aufzustellen. Auf Grund dieser Schwierigkeiten wählte ich für diese Untersuchung den Titel „Maßnahmen gegen politische Buchpublikationen in der BRD“. Maßnahmen umfassen in diesem Falle alle Handlungen von autoritärer Stelle, die die Herstellung und Verbreitung von bildlichen und schriftlichen Erzeugnissen kontrollieren, bestrafen und verbieten, sowohl vor als auch nach deren Publikation.
Diese Arbeit soll einen kurzen Abriss über den Umgang mit politischen Veröffentlichungen in der BRD geben. Zunächst betrachte ich kurz das Zensursystem der BRD. In diesem Abschnitt wird aufgrund der Benutzung des Wortes Zensur im Gesetzestext nicht der oben definierte Begriff „Maßnahmen“ verwendet. Das soll Unstimmigkeiten im benannten Abschnitt vermeiden. Anschließend wird die rechtsextreme Publizistik betrachtet. Es soll herausgestellt werden, in welcher Weise und vor allem in welchem Umfang rechtsextreme Autoren ihre Schriften publizierten. Im weiteren Verlauf der Untersuchung werden die linksextremen Veröffentlichungen betrachtet. Es soll an Hand von Beispielen gezeigt werden, wie und mit welchen Motiven gegen Autoren und Verleger links-gerichteter Schriften vorgegangen wurde.
Die Hausarbeit soll ein deutliches Missverhalten im Umgang mit rechts- und linksextremen Schriften herausstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zensursystem der BRD
- Rechtsextreme Seite
- Erste Phase (1945-1970)
- Zweite Phase (1970-1980)
- Dritte Phase (ab 1980)
- Linksextreme Seite
- Beispiel: Wagenbach Verlag
- Das Braunbuch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Umgang mit politischen Veröffentlichungen in der BRD, indem sie Maßnahmen gegen rechtsextreme und linksextreme Buchpublikationen untersucht. Dabei stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Praxis des Umgangs mit solchen Schriften im Fokus.
- Zensursystem der BRD und die Rolle des Grundgesetzes
- Rechtsextreme Publizistik und ihre Entwicklung in der BRD
- Rechtliche Maßnahmen gegen rechtsextreme Publikationen
- Linksextreme Veröffentlichungen und Beispiele für Vorgehensweisen gegen Autoren und Verleger
- Die Herausforderungen im Umgang mit rechts- und linksextremen Schriften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung definiert den Begriff „Maßnahmen“ und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar. Anschließend wird das Zensursystem der BRD im Kontext des Grundgesetzes erläutert. Das Kapitel über die rechtsextreme Seite befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung rechtsextremer Publikationen in der BRD, wobei die erste Phase (1945-1970) den Fokus auf die Verbreitung von revisionistischen Schriften legt. Das Kapitel über die linksextreme Seite beleuchtet anhand von Beispielen, wie gegen Autoren und Verleger links-gerichteter Schriften vorgegangen wurde.
Schlüsselwörter
Zensur, BRD, Rechtsextremismus, Linksextremismus, Buchpublikationen, politische Veröffentlichungen, Grundgesetz, Strafgesetzbuch, Revisionismus, Holocaust, Volksverhetzung, Medienkontrolle.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es Zensur in der Bundesrepublik Deutschland?
Laut Grundgesetz findet eine Vorzensur nicht statt. Die Arbeit untersucht jedoch „Maßnahmen“, die nach der Publikation die Verbreitung kontrollieren oder verbieten können.
Wie wird gegen rechtsextreme Publizistik vorgegangen?
Maßnahmen umfassen Verbote und Bestrafungen bei Inhalten wie Holocaustleugnung, Revisionismus oder Volksverhetzung gemäß dem Strafgesetzbuch.
Welche Rolle spielt der Wagenbach Verlag in dieser Untersuchung?
Der Verlag dient als Beispiel für das Vorgehen gegen linksextreme oder linksgerichtete Schriften und die Motive der Behörden in solchen Fällen.
Was ist das „Braunbuch“?
Das Braunbuch wird als Beispiel für eine politische Publikation angeführt, die im Kontext der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und deren Aufarbeitung kontrovers behandelt wurde.
Kritisiert die Arbeit den Umgang mit politischen Schriften?
Ja, die Hausarbeit zielt darauf ab, ein vermeintliches Missverhältnis im staatlichen Umgang mit rechts- und linksextremen Schriften herauszuarbeiten.
- Citar trabajo
- BA Julia Böhm (Autor), 2008, Maßnahmen gegen politische Buchpublikationen in der BRD, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268703