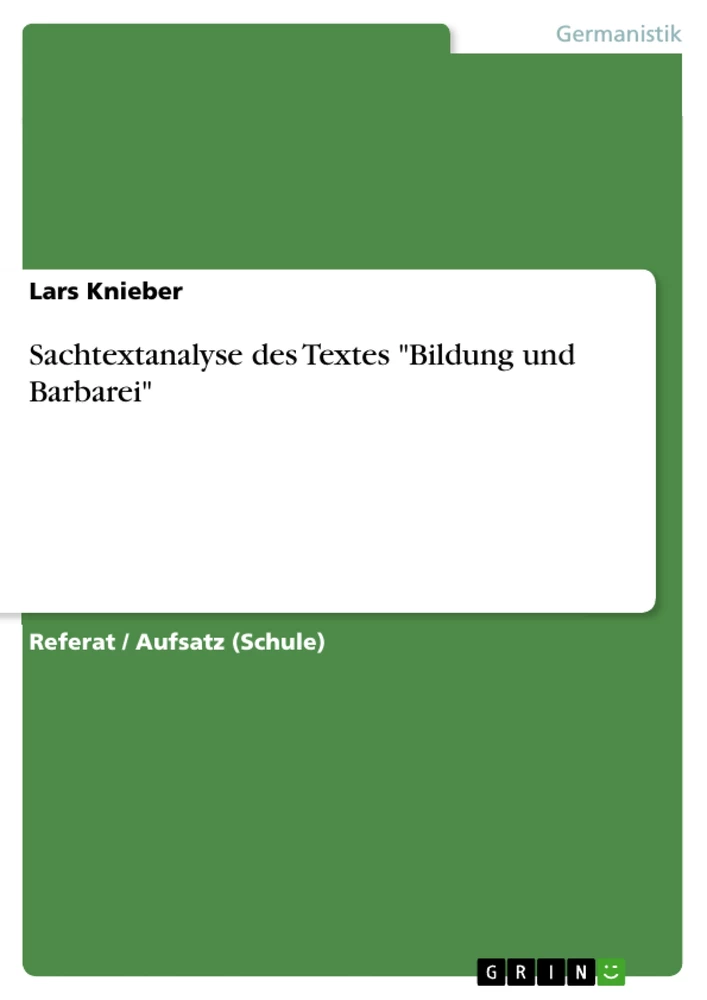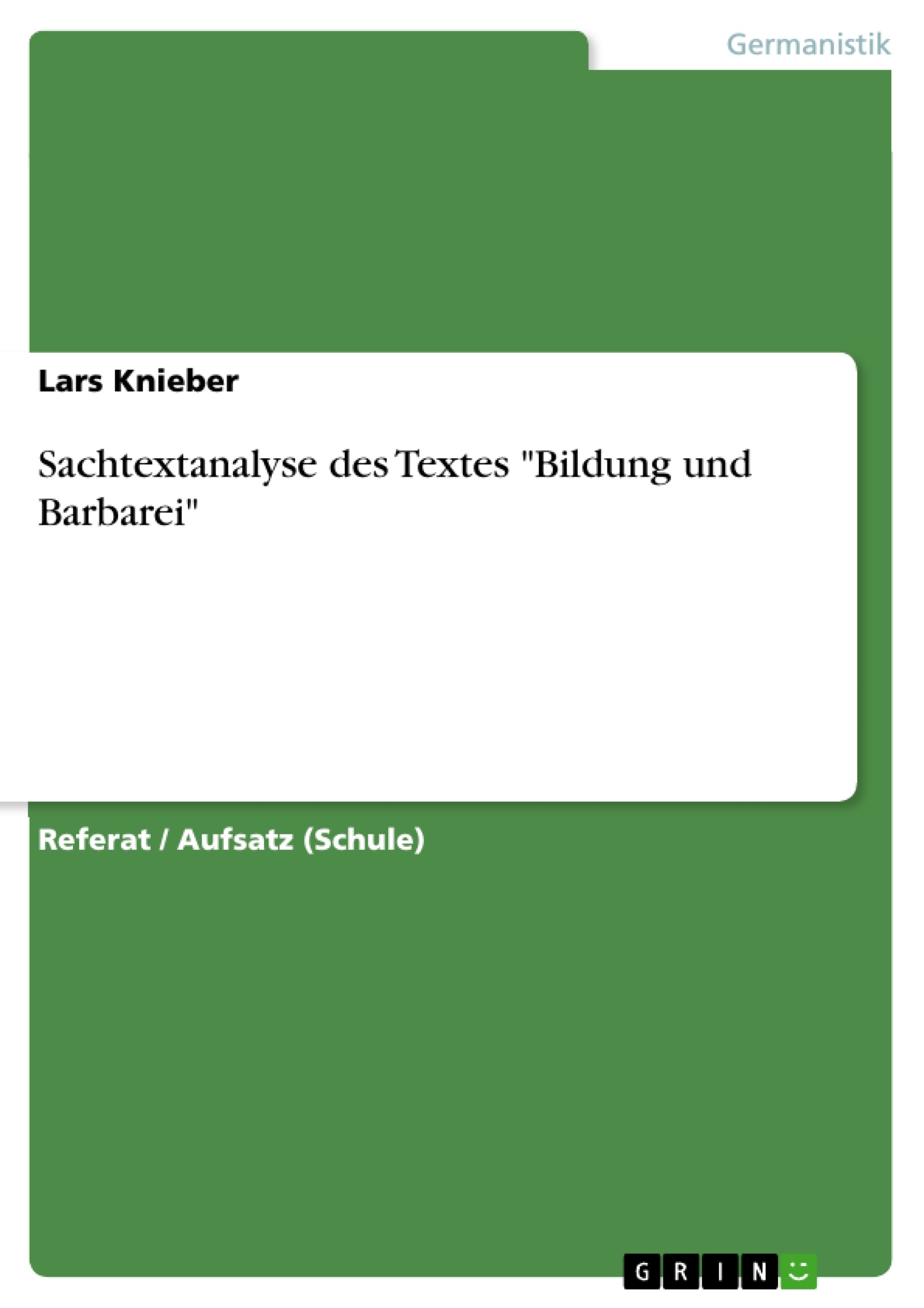Diese Sachtextanalyse bezieht sich auf den Text „Bildung und Barbarei“ von Prof. Dr. Georg Zenkert, welcher am 27.09.2005 in der Frankfurter Rundschau erschienen ist. Die hier zugrunde liegende Version ist ein gekürzter Auszug, der unter anderem bei den schriftlichen Abiturprüfungen 2010 in Hamburg als Referenztext diente.
Die vorgenommene Analyse berücksichtigt die inhaltliche Ebene, die Argumentationsstrucktur sowie die sprachlichen Mittel.
Sachtextanalyse des Textes „Bildung und Barbarei“
von Lasse Kelzenberg
Der Sachtext „Bildung und Barbarei“ von Prof. Dr. Georg Zenkert erschien in der Frankfurter Rundschau Nr. 255 vom 27.09.05 im Forum Humanwissenschaften und thematisiert die Wandlung und die Bedeutung des Bildungsbegriffes in der zeitgenössischen Gesellschaft. Insbesondere wird dabei auf den Bildungs- und den Leistungsgedanken eingegangen, in welchem Zusammenhang diese stehen und welche Veränderungen es bei diesen in letzter Zeit gegeben hätte.
Dem Bildungsbegriff ist nach Zenkert eine Wandlung widerfahren. Der Leistungsgedanke hätte den Bildungsgedanken verdrängt. Diesem Schluss liegt zugrunde, dass Zenkert den Begriff der Leistung so versteht, dass die Leistung bloß darin bestehe, dass Erwartungen erfüllt werden müssten. Dies richte sich gegen die bereits von Schiller beschriebe Ausfassung von Bildung, mit der ich mich unter anderem nachfolgend beschäftigen möchte. So schreibt Zenkert: „Die Idee der Leistung hat den Bildungsgedanken verdrängt. Leistung steht für objektive Anforderungen, für den Einsatz aller Kräfte, scheint also auf den ersten Blick nicht unverträglich mit Bildung zu sein. Tatsächlich aber bedeutet leisten – wörtlich einer Spur folgen – nicht anderes als vorliegende Erwartungen zu erfüllen. Für Bildung bleibt dabei wenig Raum.“ (Z. 27ff)
Nun beginnt der zu analysierende Text Zenkerts mit einer Definition des Bildungsbegriffes, wobei diese in einer klassischen Art der Argumentation – bestehend aus Prämisse I, Prämisse II und der Konklusion – beinhaltet ist. „Wir sind Barbaren.“ (Z. 1) ist seine zunächst verwirrend anmutende erste Prämisse, die er direkt an den Anfang des Textes stellt und so beim Leser Neugierde wecken will. Die Auflösung dieser Prämisse folgt noch im selben Absatz. So bezieht er sich auf Schillers Begriff des Barbaren, den er wie folgt zusammenfasst: Barbaren sind „diejenigen, die ihre individuellen Möglichkeiten zurückstellen, um sich den Forderungen der nüchternen Zweckrationalisierung zu beugen.“ (Z. 1f) Nachfolgend urteilt Zenkert, wir lebten heutzutage in einem „System wechselseitiger Abhängigkeiten […], dessen Credo der Sachzwang ist.“ (Z. 4f) Dies ist also seine zweite Prämisse. Schließlich kommt er am Ende des Absatzes zu der Konklusion, dass wir so betrachtet „in einer Zivilisation ohne Bildung“ (Z. 7f) lebten. Dieser Aufbau nach dem Schema zwei Prämissen und eine Konklusion ist eine sehr eingängige und leicht verständliche Art der Argumentation, wobei diese besonders durch seinen parataktischen Aufbau der Sätze unterstrichen wird.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptthese von Georg Zenkerts Text?
Zenkert behauptet, dass der Leistungsgedanke den Bildungsgedanken verdrängt hat und wir in einer „Zivilisation ohne Bildung“ leben.
Wie definiert Zenkert den Begriff „Barbar“?
Unter Bezugnahme auf Schiller definiert er Barbaren als Menschen, die ihre individuellen Möglichkeiten der Zweckrationalisierung unterordnen.
Was kritisiert der Autor am modernen Leistungsbegriff?
Er kritisiert, dass „leisten“ heute nur noch bedeutet, vorliegende Erwartungen zu erfüllen (einer Spur zu folgen), was keinen Raum für echte Bildung lässt.
Wie ist die Argumentationsstruktur des Sachtextes aufgebaut?
Zenkert nutzt ein klassisches Schema aus zwei Prämissen und einer daraus resultierenden Konklusion, um seine Thesen eingängig zu präsentieren.
In welchem Medium erschien der Originaltext?
Der Text „Bildung und Barbarei“ wurde am 27.09.2005 in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht.
- Quote paper
- Lars Knieber (Author), 2014, Sachtextanalyse des Textes "Bildung und Barbarei", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268704