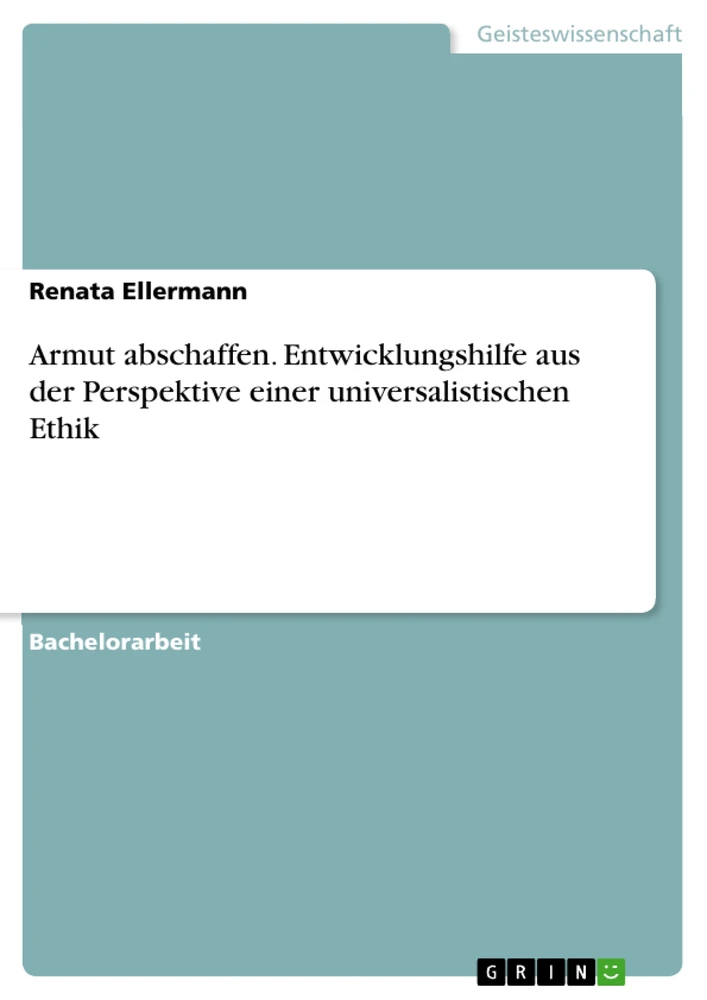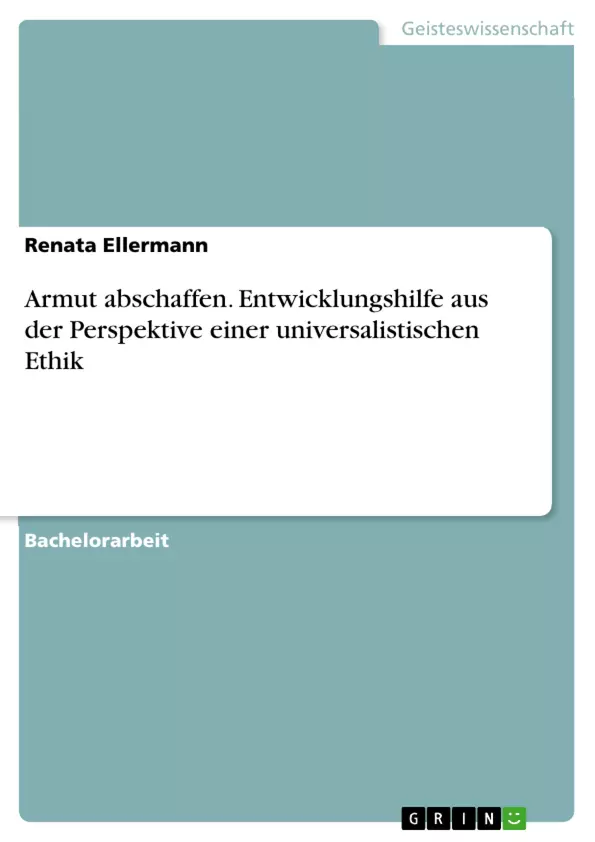Wir leben in einer Welt, in der ein immer größerer Teil der Menschen armutsbedingt leidet und stirbt, während ein anderer Teil im Überfluss lebt. Das erschreckende Ausmaß der Armut und der Ungleichheit in der heutigen Welt belegen die statistischen Zahlen. Fast eine Milliarde Menschen sind unterernährt. Jede sechste Sekunde verhungert ein Kind. Armutsbedingt Leiden bedeutet nicht nur Mangel an Nahrung, sondern Obdachlosigkeit , keinen Zugang zum Trinkwasser und fehlende medizinische Versorgung . Jährlich sterben 18 Millionen Menschen vorzeitig in Folge von Armut, mehr als doppelt so viel wie in den schlimmsten Jahren des Zweiten Weltkriegs. 98% der Unterernährten leben in den Entwicklungsländern. In den Industrieländern dagegen wandert ein Drittel der Lebensmittel in den Abfall. Allein in Deutschland werden jährlich 20 Millionen Tonnen Nahrungsmittel vernichtet. Um nur ein Beispiel dieser Absurdität zu nennen, verlangen die strengen EU-Normen, dass eine Kartoffel eine exakte Größe hat, sonst wird sie einfach weggeworfen. Die Diskrepanz zwischen Armut und Reichtum zeigt eine wachsende Tendenz. In den letzten fünfzig Jahren hat sich der Abstand zwischen den reichsten und den ärmsten Länder der Welt mehr als verdoppelt, von 35:1 (1950) stieg sie auf 72:1 (1992). Die Wohlstandspyramide wird immer steiler: die reichsten zweihundert Personen der Welt besitzen so viel wie 41% der Weltbevölkerung.
Allein die Armut und die wachsende Kluft zwischen Notleidenden und Wohlhabenden machen diesen Weltzustand noch nicht zu einem moralischen Problem. Hungersnot und Elend auf einer Seite und dekadenter Reichtum auf der anderen Seite sind kein neues Phänomen in der Geschichte der Menschheit. Was heute die Weltarmut zu einem schwerwiegenden moralischen Problem der reichen Welt macht, sind das Wissen über die Weltarmut sowie der fehlende Wille, diese abzuschaffen. Die mangelnde Hilfsbereitschaft der Industrieländer sowie deren aktive Mitwirkung zur Verschärfung der Armut in den Entwicklungsländern lassen vermuten, dass die Beseitigung der Weltarmut nicht gewollt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Lassen sich globale Hilfspflichten begründen?
- 1.1. Rechte und Pflichte des Individuums
- 1.1.1. Das Recht auf ein menschliches Minimum nach Oruka
- 1.1.2. Die Pflicht zur Hilfeleistung nach Kant
- 1.1.3. Die Verpflichtung zu helfen nach Singer
- 1.2. Rollenabhängige Pflichten des sozialen Akteurs
- 1.2.1. Verantwortung als Funktion der Macht
- 1.2.2. Verantwortung für die gegenwärtige internationale Ordnung
- 1.2.3. Kompensation für ungerechte Taten in der Vergangenheit
- 1.2.4. Internationale Hilfe nach Rawls
- 1.2.5. Solidarität
- 1.2.6. Kooperation
- 1.2.7. Subsidiarität als Gesellschaftsprinzip
- 2. Wie ist das Pflichtobjekt?
- 3. Die Natur des Menschen
- 3.1. Menschliche Hemmschwellen bei Hilfeleistung
- 3.2. Hilfsbereitschaft aus Mitleid
- 4. Ausblick
- Literatur
- Internetlinks für statistische Daten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die ethischen Implikationen der Entwicklungshilfe. Sie beleuchtet die Problematik der Weltarmut und die Frage, ob und wie sich globale Hilfspflichten begründen lassen. Die Arbeit analysiert verschiedene ethische Konzepte und diskutiert ihre Relevanz für die Entwicklungshilfe.
- Globale Hilfspflichten und ihre Begründungsansätze
- Rechte und Pflichten des Individuums in Bezug auf die Weltarmut
- Rollenabhängige Pflichten des sozialen Akteurs
- Die Natur des Menschen und seine Hemmschwellen bei der Hilfeleistung
- Die Rolle von Mitleid und Solidarität in der Entwicklungshilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Weltarmut und die Diskrepanz zwischen Reichtum und Armut dar. Sie erläutert die Bedeutung der Entwicklungshilfe als Lösungsansatz und die Frage nach der Wirksamkeit dieser Hilfe.
Kapitel 1 beschäftigt sich mit der Frage, ob sich globale Hilfspflichten begründen lassen. Es werden verschiedene Ansätze zur Begründung von Hilfspflichten diskutiert, unter anderem das Recht auf ein menschliches Minimum nach Oruka, die Pflicht zur Hilfeleistung nach Kant und die Verpflichtung zu helfen nach Singer. Weiterhin werden rollenabhängige Pflichten des sozialen Akteurs betrachtet, wie zum Beispiel die Verantwortung als Funktion der Macht, die Verantwortung für die gegenwärtige internationale Ordnung und die Kompensation für ungerechte Taten in der Vergangenheit.
Kapitel 2 untersucht das Pflichtobjekt der Entwicklungshilfe.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Natur des Menschen und seinen Hemmschwellen bei der Hilfeleistung.
Schlüsselwörter
Entwicklungshilfe, Weltarmut, globale Hilfspflichten, Rechte und Pflichten, individuelles Handeln, soziale Verantwortung, Mitleid, Solidarität, homo communis.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Weltarmut in dieser Arbeit als moralisches Problem betrachtet?
Weltarmut ist ein moralisches Problem, weil das Wissen über das Elend vorhanden ist, aber oft der Wille zur Abschaffung fehlt und Industrieländer teils aktiv zur Verschärfung beitragen.
Welche ethischen Ansätze zur Begründung von Hilfspflichten werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert Konzepte wie das Recht auf ein menschliches Minimum (Oruka), die Pflicht zur Hilfeleistung nach Kant und die utilitaristische Verpflichtung nach Peter Singer.
Wie groß ist die Diskrepanz zwischen Arm und Reich laut Statistik?
Der Abstand zwischen den reichsten und ärmsten Ländern hat sich von 1950 bis 1992 mehr als verdoppelt (von 35:1 auf 72:1). Die reichsten 200 Personen besitzen so viel wie 41 % der Weltbevölkerung.
Was sind "rollenabhängige Pflichten" in der Entwicklungshilfe?
Dies bezieht sich auf die Verantwortung sozialer Akteure aufgrund ihrer Macht, die Verantwortung für die internationale Ordnung oder Kompensationen für vergangenes Unrecht.
Welche Hemmschwellen verhindern laut der Arbeit effektive Hilfeleistung?
Die Arbeit untersucht die Natur des Menschen und psychologische Barrieren, die trotz Mitleid oder Solidarität die tatsächliche Hilfsbereitschaft einschränken.
Wie viel Nahrung wird in Industrieländern wie Deutschland verschwendet?
In Industrieländern landet ein Drittel der Lebensmittel im Abfall; allein in Deutschland werden jährlich etwa 20 Millionen Tonnen Nahrungsmittel vernichtet.
- Quote paper
- Renata Ellermann (Author), 2011, Armut abschaffen. Entwicklungshilfe aus der Perspektive einer universalistischen Ethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268713