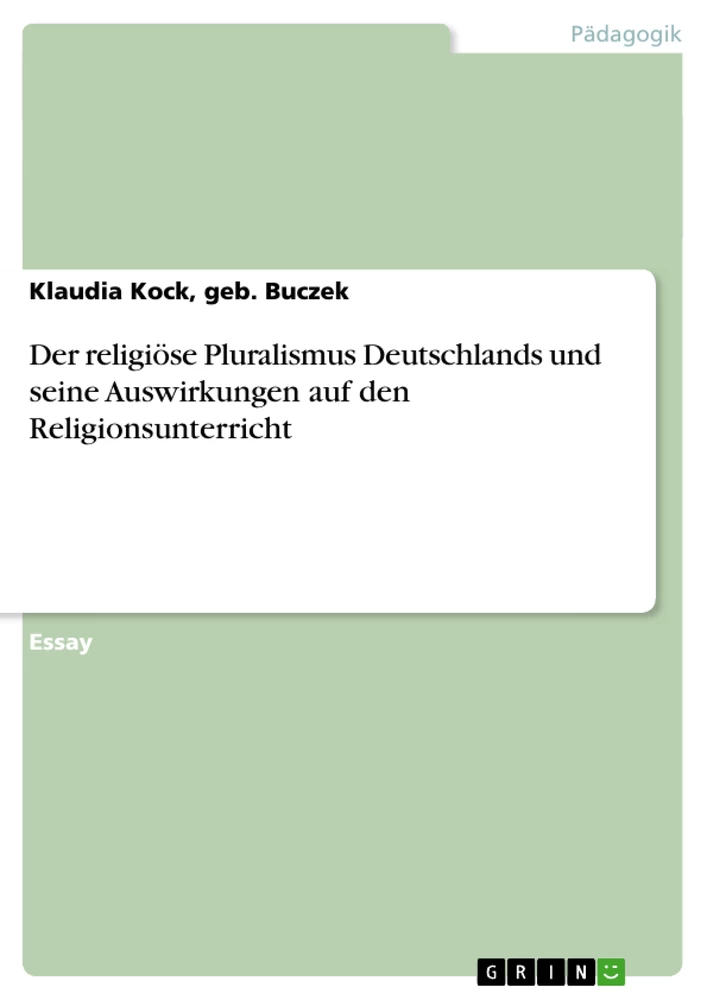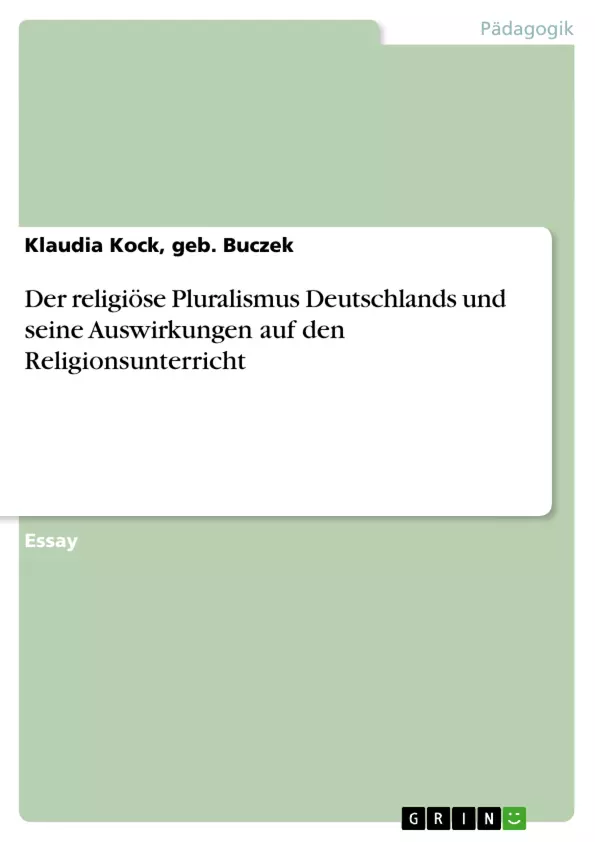Unsere moderne deutsche Gesellschaft ist in vielerlei Hinsicht pluralistisch. In unserem Land leben viele Angehörige verschiedener Nationen, Ethnien, Kulturen und Religionen zusammen. In den letzten Jahrzehnten hat sich vor allem der „Markt der Religionen und des Spirituellen“ in Deutschland stark gewandelt. Einerseits kamen neue spirituelle und religiöse Angebote zu den bereits fest in der Gesellschaft etablierten christlichen Konfessionen hinzu, andererseits erlebten die eingesessenen christlichen Konfessionen einen erheblichen Bedeutungszuwachs. Die Religion in Deutschland gibt es heute nur noch im Plural. Auf der einen Seite ist dieser Pluralismus durchaus positiv zu betrachten, weil er für alle Menschen (gläubig oder nicht) etwas bietet, auf der anderen Seite birgt er ein großes Konfliktpotenzial, weil er in seiner Unüberschaubarkeit an religiösen und spirituellen Angeboten auch Verunsicherung und Angst stiftet, vor der manch einer in die vermeintliche Sicherheit fundamentalistischer Orientierungen flieht. Vor allem die Auseinandersetzung mit „fremden“, nicht christlichen Religionen und religiösen bzw. spirituellen Vorstellungen sorgt immer wieder für Konfliktzündstoff. Diese Sachlage stellt die christlichen Kirchen Deutschlands vor neue Probleme und Herausforderungen. Besonders der Islam, der längst zum festen Bestandteil der deutschen Gesellschaft gehört, führt immer wieder zu Unstimmigkeiten. Neben den Hürden des täglichen Lebens stellt der Religionsunterricht die wohl größte Herausforderung für die christlichen Kirchen dar. Er zeichnet sich heute nicht mehr durch Schülerinnen und Schüler der zwei christlichen Konfessionen aus, sondern durch Lehrgruppen die von Kindern/Jugendlichen verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen gebildet werden, die meisten davon muslimischen Glaubens. Trotzdem ist der Religionsunterricht in Deutschland in den meisten Bundesländern nach wie vor nach den zwei christlichen Konfessionen getrennt, auch wenn die neuen Lehrpläne auf die Bedeutung des interkulturellen und interreligiösen Lernens verweisen. Doch kann diese Form des Religionsunterrichts der multireligiösen Gesellschaft der BRD überhaupt noch gerecht werden?
- Citation du texte
- Klaudia Kock, geb. Buczek (Auteur), 2013, Der religiöse Pluralismus Deutschlands und seine Auswirkungen auf den Religionsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268823