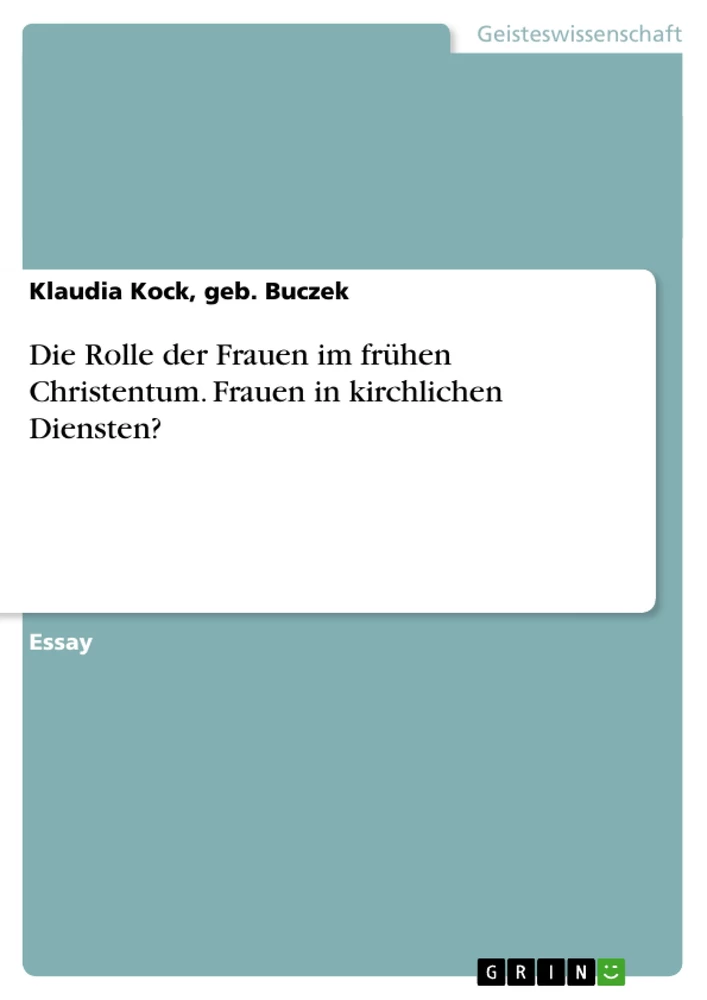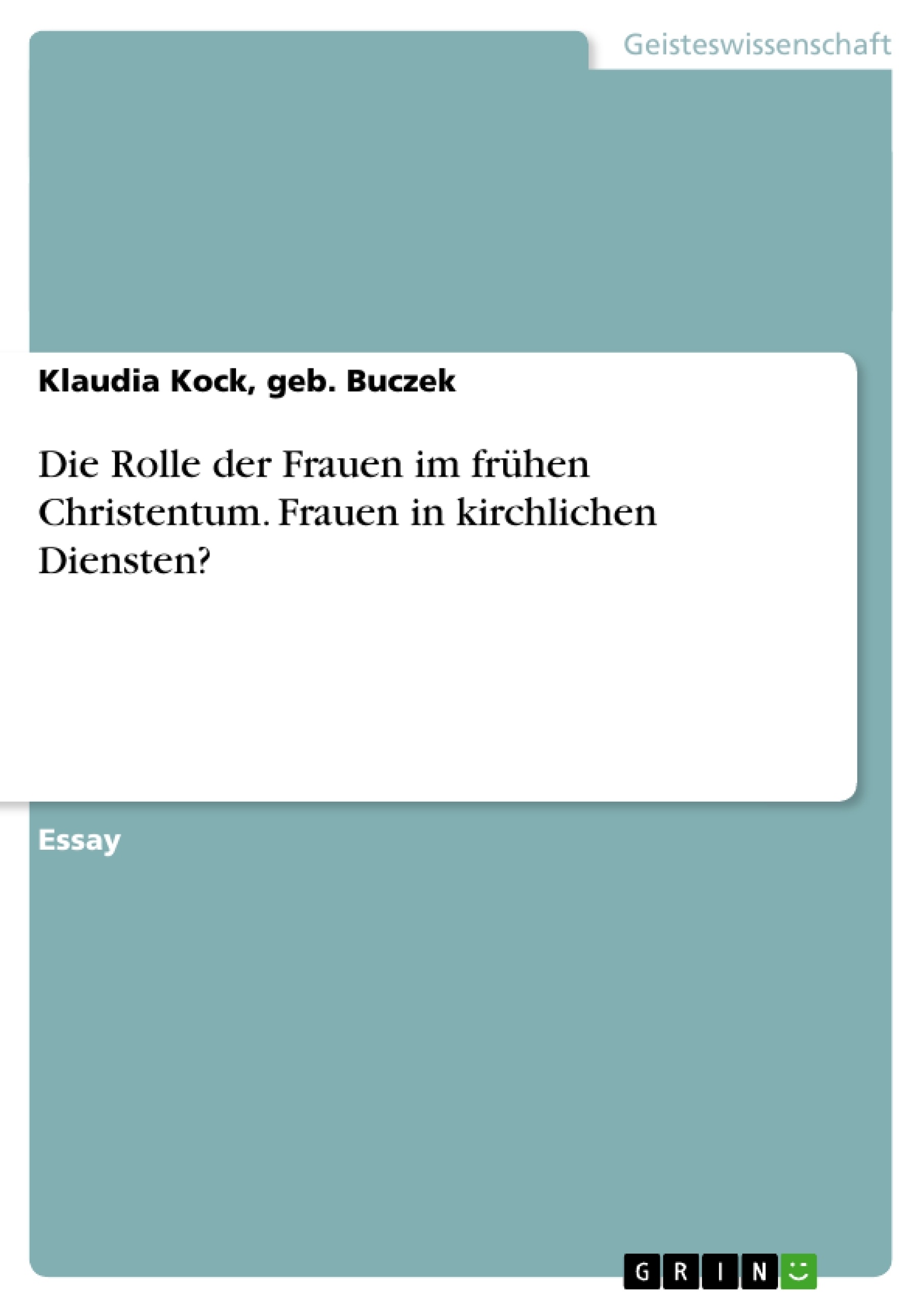In der heutigen Zeit werden die Debatten um die Partizipation von Frauen in kirchlichen Diensten immer lauter. Besonders die seit den 1970er Jahren aufkommende feministische Theologie bringt durch ihre Forschungsarbeit auf dem Gebiet der frühchristlichen Frauengeschichte immer wieder neue Erkenntnisse über die herausragende Bedeutung von Frauen im frühen Christentum und fordert auf Grundlage ihrer Forschungsergebnisse die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in kirchlichen Ämtern. Deshalb ist hier die Frage nach den Wurzeln der Tatsache, dass bis heute nur Männer einen kirchlichen Dienst übernehmen dürfen, unweigerlich. Ist sie auf eine jahrhundertelange verbindliche Tradition zurückzuführen ist oder handelt es sich hierbei vielmehr um eine traditionelle Praxis, die sich aus den traditionellen gesellschaftlichen Rollenmustern des Frühchristentums ausgebildet hat?
In der heutigen Zeit werden die Debatten um die Partizipation von Frauen in kirchlichen Diensten immer lauter. Besonders die seit den 1970er Jahren aufkommende feministische Theologie bringt durch ihre Forschungsarbeit auf dem Gebiet der frühchristlichen Frauengeschichte immer wieder neue Erkenntnisse über die herausragende Bedeutung von Frauen im frühen Christentum und fordert auf Grundlage ihrer Forschungsergebnisse die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in kirchlichen Ämtern. Deshalb ist hier die Frage nach den Wurzeln der Tatsache, dass bis heute nur Männer einen kirchlichen Dienst übernehmen dürfen, unweigerlich. Ist sie auf eine jahrhundertelange verbindliche Tradition zurückzuführen ist oder handelt es sich hierbei vielmehr um eine traditionelle Praxis, die sich aus den traditionellen gesellschaftlichen Rollenmustern des Frühchristentums ausgebildet hat? Meines Erachtens handelt es sich dabei um letzteres, nämlich um eine aus einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft entstandene Tradition, die mit den Vorstellungen Jesu über die Ausübung bzw. Verbreitung seiner Lehren nichts gemein hat. Lassen sie mich das näher erläutern.
Das Neue Testament gibt an vielen Stellen die überragende Bedeutung der Frauen im frühen Christentum wieder. Viele Frauen folgten Jesu und seinen Lehren und bauten die christliche Frühkirche mit auf. In allen Evangelien sind es die Frauen, die bei dem Ostergeschehen die entscheidende Rolle spielen, denn als erste Zeuginnen der Auferstehung trugen sie wesentlich zur Entstehung des Christentums bei. Eine dieser Frauen ist Maria aus Magdala, die wichtigste Osterzeugin, Jüngerin Jesu sowie die erste Apostelin, die aber nach dem Ostergeschehen in den neutestamentlichen Schriften nicht mehr erwähnt wird. Dies erscheint mir etwas suspekt, da ich mir nicht vorstellen kann, dass eine sich so stark für die Lehren Jesu engagierende Frau, urplötzlich ohne einen Hinweis nach der Passion aus den Schriften der Bibel verschwindet, zumal sie in so genannten „apokryphen Schriften“ auch nach der Leidensgeschichte Jesu eine führende Rolle unter seinen Jüngern gespielt hat. Eine andere wichtige Frau des Frühchristentums ist Lydia, die erste Christin Europas nach Apg 16, 11-16. Sie war nicht nur der erste Mensch in Europa, der sich dem Christentum zuwandte, sondern auch die Leiterin der christlichen Gemeinde in Philippi. Doch nicht nur in den Evangelien sowie den Apostelgeschichten lassen sich Hinweise auf die überragende Rolle von Frauen im frühen Christentum finden. In den Paulusbriefen benennt der Apostel selbst zwei Frauen, deren Handeln und Wirken für das Frühchristentum, aber vor allem für die heutige Debatte um die Besetzung der kirchlichen Ämter mit Frauen von größter Wichtigkeit sind. Zum einen geht es hier um die Diakonin Phöbe. Diese wurde nach Röm 16,16 von Paulus mit der Aufgabe betraut einen seiner Briefe an die Gemeinde in Rom zu bringen. Dieser Auftrag erscheint zunächst nicht besonders spektakulär, wäre da nicht die Tatsache, dass sie den Brief der Gemeinde nicht nur übergeben sollte, sondern diesen auch theologisch auslegen musste und somit dessen Inhalt nach eigener Auffassung interpretieren konnte. Paulus musste also vollstes Vertrauen in diese Frau gehabt haben, denn sonst würde er ihr eine so wichtige Aufgabe nicht anvertrauen. Er war sich aber allem Anschein nach sicher, dass die Diakonin seinen Brief im Sinne des Evangeliums wiedergeben würde. Eine große Aufgabe, die er einer Frau gab, obwohl es den Frauen damals verboten war zu lehren oder zu verkündigen und obwohl sich Paulus an vielen Stellen seiner Briefe frauenfeindlich äußert. Er muss in ihr also eine würdige Trägerin seiner Botschaft gesehen haben, sonst hätte er aus dem Kreise seiner Anhänger sicherlich einen Mann gewählt. Zum anderen soll hier die Apostelin Junia (Röm 16, 7) erwähnt werden, in Röm 16,7 werden Andronikus und Junia erwähnt, die „angesehen unter den Aposteln sind“. Wieder eine Frau, die ein männliches Amt ausübte. So schrieb Johannes Chrystosomos: „Ein Apostel zu sein ist etwas Großes. Aber berühmt unter den Aposteln – bedenke, welch großes Lob das ist. Wie groß muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie für den Titel Apostel würdig befunden wurde.“[1] In der damaligen Zeit ein großes Lob für eine Frau und ein Zeichen dafür, dass er sie mit den männlichen Aposteln gleich stellte.
[...]
[1] Vgl. Wilhelm Schneemelcher: Neutestamentarische Apokryphen. In deutscher Übersetzung. 2 Bände, Mohr Siebeck, Tübingen 1999, Band 2, S. 10.
- Quote paper
- Klaudia Kock, geb. Buczek (Author), 2013, Die Rolle der Frauen im frühen Christentum. Frauen in kirchlichen Diensten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268825