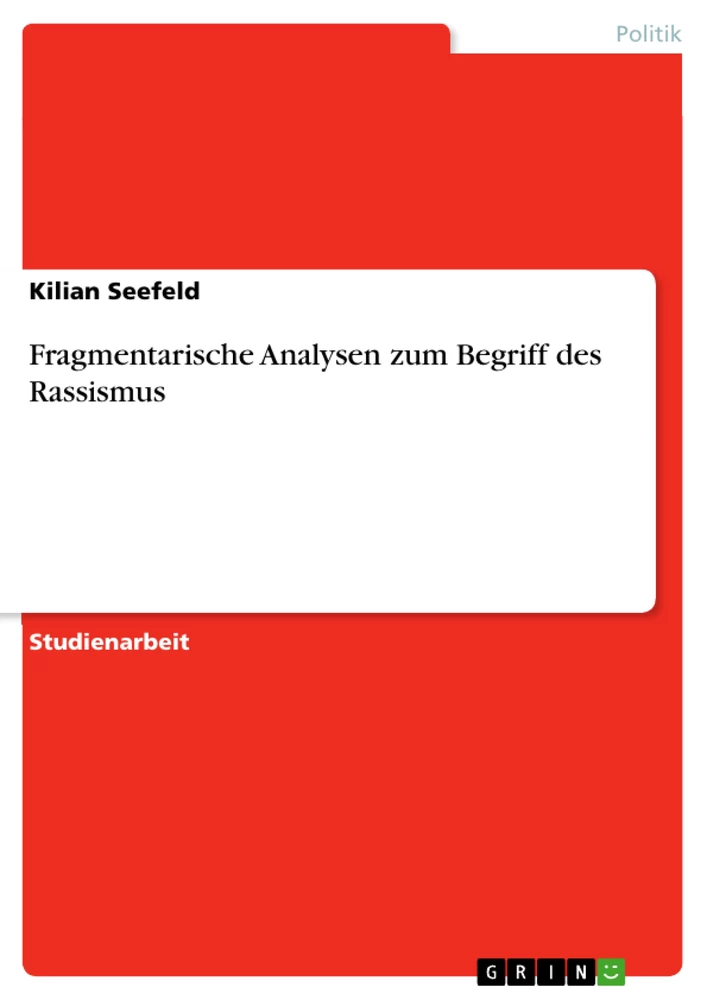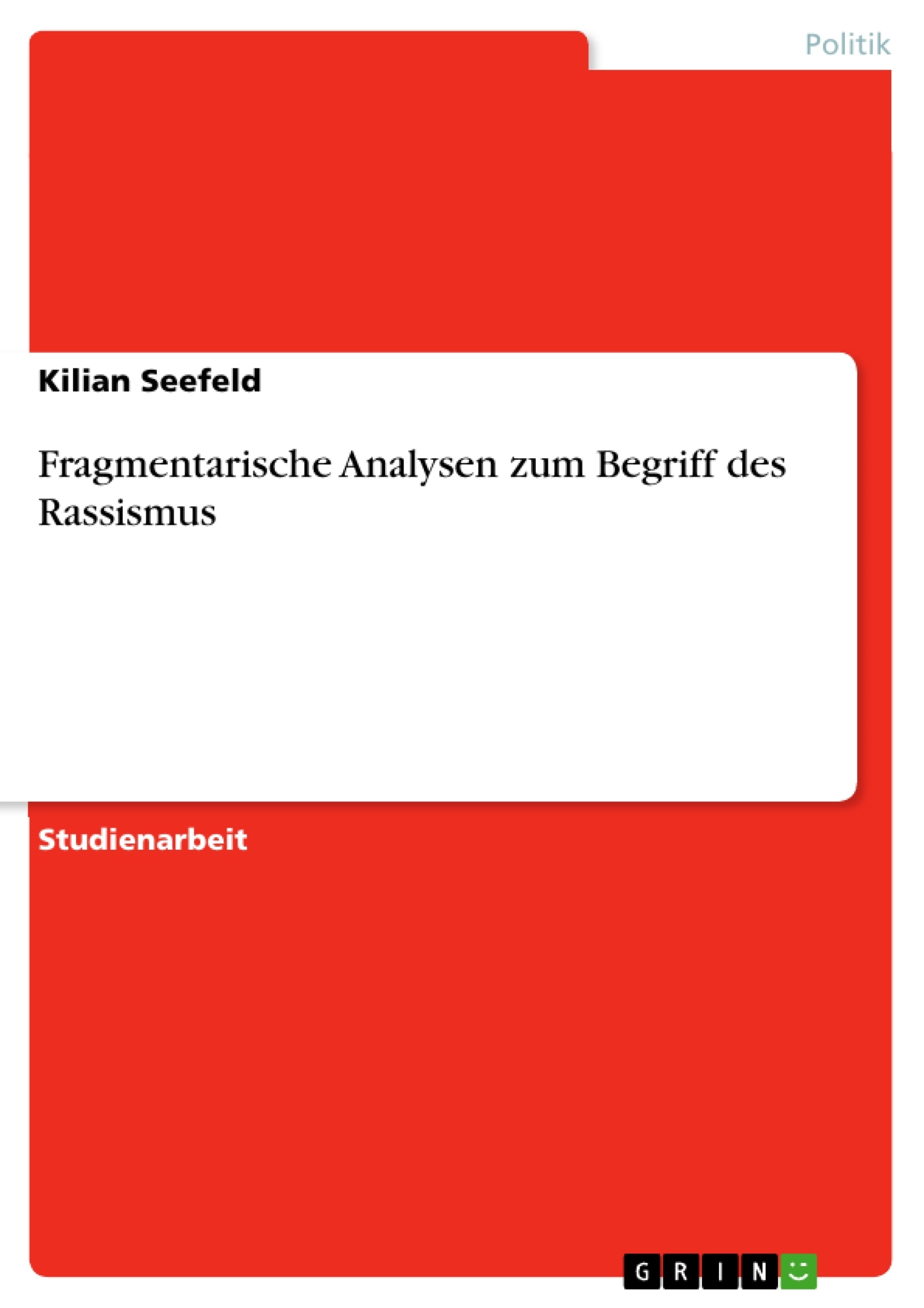Ein wesentlicher Bestandteil eines menschenwürdigen Lebens kann sicherlich darin gesehen werden, ein Leben frei von Diskrimierungen führen zu können. Dem Schutz vor rassistischer Diskrimierung kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Denn es handelt sich bei dieser um eine Form von Diskrimierung, die aufgrund der internen soziologischen Struktur unter bestimmten Umständen eine besonders gravierende gesellschaftsschädigende Wirkung entfalten kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Inhalt der Arbeit
1.2. Methodologische Vorklärung: Die Rede von der „Existenz“ menschlicher Rassen
2. Die Phänomene „Rasse“ und „Rassismus“
2.1. Begriffliche Aspekte
2.2. Soziologische Aspekte
3. Hendrik Cremer: „... und welcher Rasse gehören sie an?“
Literatur
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der fragmentarischen Analysen zum Rassismus?
Die Arbeit untersucht die soziologischen Strukturen und begrifflichen Aspekte von Rassismus, um dessen gesellschaftsschädigende Wirkung besser zu verstehen.
Warum ist der Schutz vor rassistischer Diskriminierung besonders wichtig?
Rassismus stellt eine gravierende Verletzung der Menschenwürde dar und kann aufgrund seiner internen Struktur besonders schwere soziale Schäden verursachen.
Wie wird die "Existenz" menschlicher Rassen methodologisch geklärt?
Die Arbeit setzt sich kritisch mit der Rede von menschlichen Rassen auseinander und klärt die wissenschaftliche Unhaltbarkeit dieses Konzepts auf.
Welche Rolle spielen soziologische Aspekte beim Rassismus?
Soziologische Analysen helfen zu verstehen, wie rassistische Denkmuster in der Gesellschaft entstehen, sich verbreiten und Machtstrukturen festigen.
Welchen Beitrag leistet Hendrik Cremer zur Thematik?
Die Arbeit bezieht sich auf Cremers Ausführungen zur Problematik rassistischer Kategorisierungen in der heutigen Gesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Kilian Seefeld (Autor:in), 2014, Fragmentarische Analysen zum Begriff des Rassismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268872