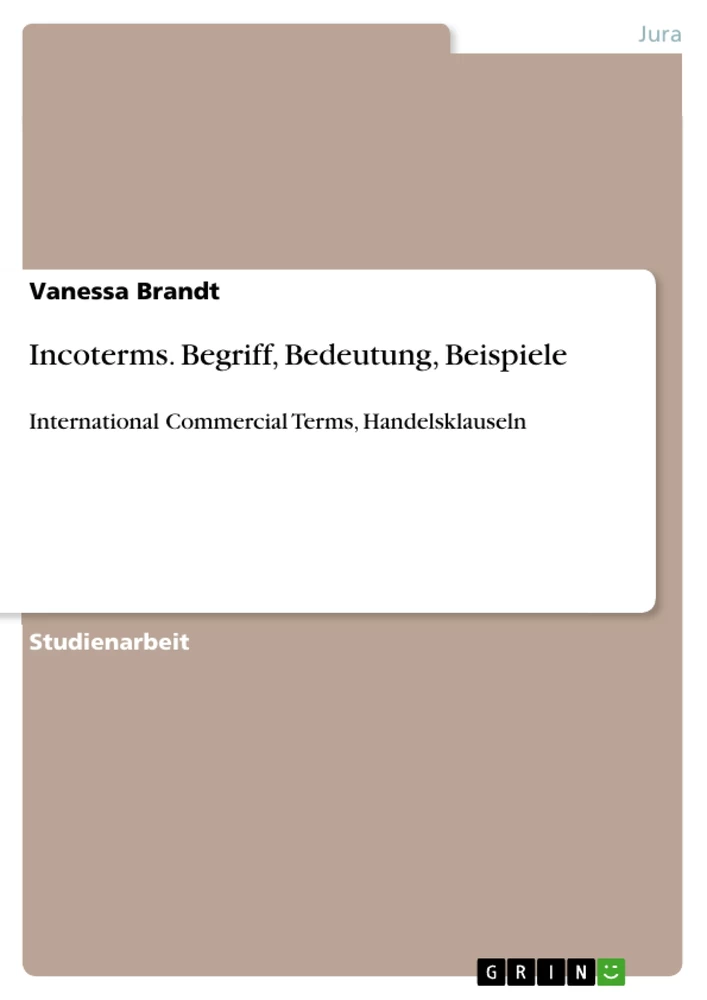Bei den Incoterms handelt es sich um standardisierte Lieferbedingungen, die von dem ICC herausgegeben werden – einer renommierten nichtstaatlichen Organisation mit Sitz in Paris, deren Mitglieder eine umfassende Sachkenntnis in der internationalen Handelspraxis aufweisen. Die Incoterms ersetzen nicht den ganzen Kaufvertrag, sondern widmen sich dem Gefahrübergang und der Verantwortlichkeit für Risiko und Kosten. Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Incoterms 2010, also die aktuellen Regeln der ICC zur Auslegung nationaler und internationaler Handelsklauseln, vorzustellen und mit anschaulichen Beispielen zu untermauern.
Diese Hausarbeit gliedert sich wie folgt: Das erste Kapitel enthält die Einleitung. Kapitel B klärt über Be-griffe und Grundlagen auf und schafft eine notwendige Basis für das weitere Verständnis. In Kapitel C werden alle elf Klauseln erklärt und passende Beispiele angehängt. Das letzte Kapitel gibt einen Überblick über die gewonnenen Erkenntnisse, fasst diese eingängig zusammen und erlaubt einen Einblick in zukünftige Entwicklungen.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
A. EINLEITUNG
B. Begriffe und Grundlagen
I. Die Internationale Handelskammer
II. Incoterms
III. Privatrecht
IV. Das UN-Kaufrecht
V. Einbeziehung in Verträge
C. Die Klauseln der Incoterms 2010 mit Beispielen
I. Alle Transportarten
1. EXW
2. FCA
3. CPT
4. CIP
5. DAT
6. DAP
7. DDP
II. See- und Binnenschiffahrtstransport
1. FAS
2. FOB
3. CFR
4. CIF
D. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was sind Incoterms?
Incoterms sind standardisierte Lieferbedingungen der Internationalen Handelskammer (ICC), die Kosten und Risiken im globalen Handel regeln.
Ersetzen Incoterms den Kaufvertrag?
Nein, sie regeln lediglich den Gefahrübergang sowie die Verantwortlichkeit für Transportkosten und Risiken, nicht aber den gesamten Vertrag.
Welche Version der Incoterms wird hier behandelt?
Die Arbeit stellt die elf Klauseln der Incoterms 2010 vor.
Was bedeutet die Klausel EXW?
EXW (Ex Works) bedeutet "Ab Werk" – der Käufer trägt fast alle Kosten und Risiken ab dem Standort des Verkäufers.
Gibt es spezielle Klauseln für den Schiffstransport?
Ja, Klauseln wie FAS, FOB, CFR und CIF sind speziell für den See- und Binnenschiffstransport vorgesehen.
- Citar trabajo
- Vanessa Brandt (Autor), 2014, Incoterms. Begriff, Bedeutung, Beispiele, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268970