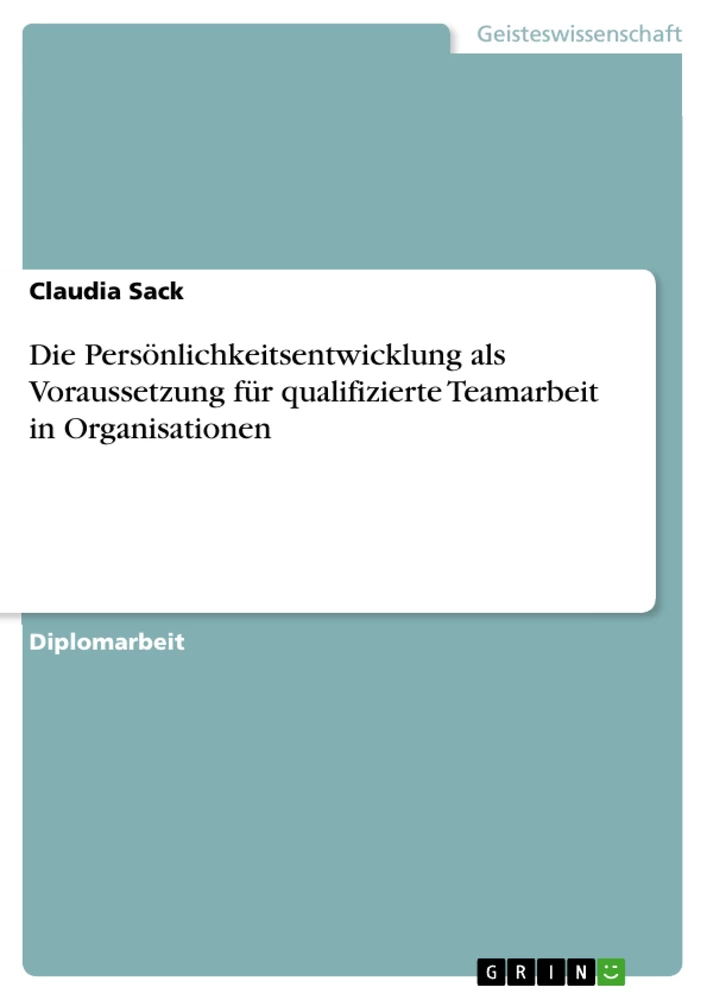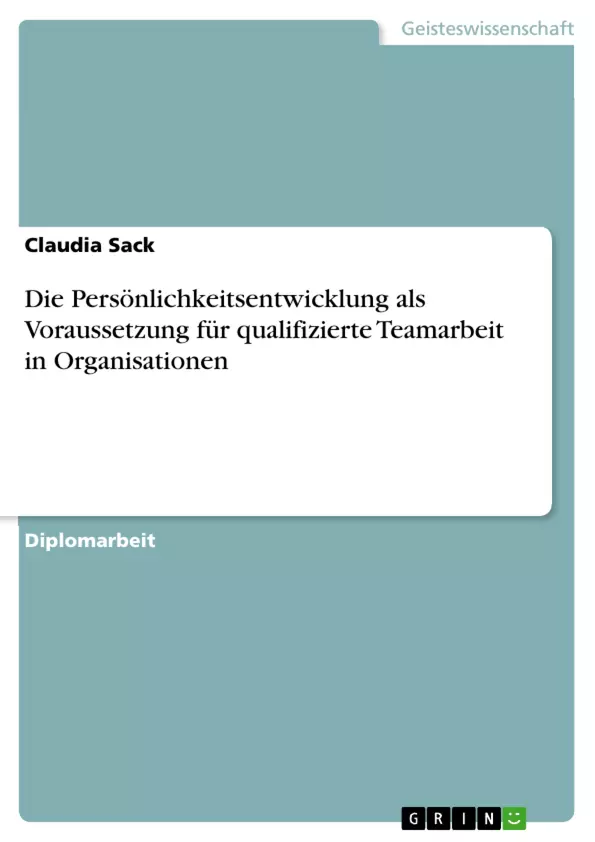Die eigene Person mit ihren Eigenschaften und Fähigkeiten ist der wichtigste Schlüssel für Arbeit und Beruf. Sie erfordert bei ständig veränderten Arbeitsformen und Rahmenbedingungen in Organisationen (wie z.B. Teamarbeit) eine permanente (Weiter-)Qualifizierung.
Kenntnisse über die eigene Persönlichkeit mit ihren Stärken und Schwächen sind dabei Ausgangsposition und Voraussetzung für jegliche Entwicklungsmöglichkeit - hier mit dem Ziel einer verbesserten Teamfähigkeit.
In der vorliegenden Arbeit habe ich zuerst skizziert, was ich allgemein unter guter Teamarbeit verstehe und welche notwendigen Voraussetzungen dafür v.a. hinsichtlich der persönlichen Qualifikation und der Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter gegeben sein müssen. In einem zweiten Schritt habe ich aufgezeigt, inwieweit die eigene Persönlichkeit und die Kenntnis über ihre Stärken und Schwächen gerade für eine Zusammenarbeit mit anderen Menschen - wie bei der Teamarbeit - so eine wichtige Rolle spielt. Daraus habe ich in einem dritten Schritt Überlegungen angestellt, wie sich die Persönlichkeit v.a. im Hinblick auf Teamfähigkeit entwickeln läßt. Abschließend habe ich kurz beschrieben, unter welchen Rahmenbedingungen diese Persönlichkeitsentwicklung möglicherweise stattfinden könnte.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Fachliche und persönliche Begründung des Themas
2. Teamarbeit und ihre Voraussetzungen
2.1. Begriffsklärung: Teamarbeit
2.1.1. Merkmale von Teamarbeit
2.1.2. Einordnung von Teamarbeit unter andere Gruppenmodelle
2.2. Strukturelle Voraussetzungen
2.2.1. Technische und organisatorische Voraussetzungen
2.2.2. Die Struktur von Teams
2.3. Persönliche Voraussetzungen und Fähigkeiten
2.3.1. Der Begriff der Teamfähigkeit und ihre Merkmale
2.3.2. Der Begriff der sozialen Kompetenz und sein zentraler Stellenwert
2.3.3. Einstellung zur Teamarbeit
2.4. Gruppendynamische Bedingungen
2.4.1. Phasen der Gruppen- bzw. Teamentwicklung
2.4.2. Der Umgang mit Konflikten
2.4.3. Der Umgang mit Entscheidungen
2.5. Zusammenfassende Überlegungen und weitere Vorgehensweise
3. Die Persönlichkeit als Grundlage für Teamarbeit
3.1. Begriffsklärung: Persönlichkeit
3.2. Warum ist Persönlichkeit so wichtig?
3.3. Wie läßt sich Persönlichkeit methodisch erfassen?
3.4. Das DISG-Persönlichkeits-Modell
3.4.1. Das Persönlichkeits-Modell (DISG) von W.M. Marston
3.4.2. Die vier DISG-Persönlichkeits-Typen
3.5. Persönlichkeit und Teamarbeit
3.5.1. Persönlichkeit und Teamrollen
3.5.2. Persönlichkeit und Teamzusammensetzung
3.5.3. Persönlichkeitstypische Umgangsformen bei Teamarbeit
3.6. Zusammenfassende Überlegungen und weitere Vorgehensweise
4. Entwicklungsmöglichkeiten der Persönlichkeit mit dem Ziel einer verbesserten Teamfähigkeit
4.1. Sich selbst und andere besser kennen- und verstehen lernen mit Hilfe
des DISG-Persönlichkeits-Profils
4.1.1. Den eigenen Verhaltensstil definieren und verstehen
4.1.2. Unterschiedliche Verhaltensweisen erkennen und schätzen lernen
4.1.3. Exemplarische Darstellung an einem selbst durchgeführten Beispiel
4.2. Erwerb sozialer bzw. kommunikativer Kompetenzen
4.2.1. Entwicklung von Fähigkeiten für eine offene Kommunikation
4.2.2. Entwicklung von Fähigkeiten zum konstruktiven Umgang mit Konflikten
4.3. Zusammenfassende Überlegungen und weitere Vorgehensweise
5. Rahmenbedingungen für die Persönlichkeitsentwicklung mit dem Ziel qualifizierter Teamarbeit
5.1. Rahmenbedingungen für die Persönlichkeitsentwicklung in Unternehmen
5.2. Rahmenbedingungen für die Persönlichkeitsentwicklung in sozialen
Einrichtungen
6. Zusammenfassende Überlegungen, kritische Betrachtung und
Ausblick
Anhang
A. Ergänzende Darstellungen
A/1. Die vier Verhaltensstile
A/2. Die klassischen Verhaltensstile
A/3. Andere im Team verstehen - Zusammenfassung
A/4. Aspekte des Verhaltens, die bei anderen Teammitgliedern Spannungen erzeugen
B. Literaturverzeichnis
C. Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Formen von Gruppen in Unternehmen
Abb. 2: Modelle gruppenorientierter Arbeitsgestaltung
Abb. 3: Konflikthandhabungsstile nach Thomas
Abb. 4: Die vier DISG-Typen
Abb. 5: Beispiel einer Wortgruppe des DISG-Fragebogens
Abb. 6: Wonach beurteile ich andere Teammitglieder?
1. Fachliche und persönliche Begründung des Themas
Unsere Gesellschaft ist geprägt von sich immer schneller vollziehendem Wandel. Neue technologische Innovationen und Entwicklungen waren starke Triebkraft v. a. für die Wirtschaft und haben sie vorangetrieben. Das beständige und rasante Wachsen des sekundären Sektors (Industrie, Handwerk) hat die Ausdehnung des tertiären Sektors (Handel, Verkehr und Dienstleistungen) herbeigeführt und eine zunehmende Internationalisierung und Globalisierung der Märkte mit sich gebracht. Die einzelnen Betriebe stehen dadurch bedingt unter immer stärkerem Konkurrenz- und Preisdruck und müssen bei gleichzeitig verbesserter Wirtschaftlichkeit langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen sichern.
Mit diesen wirtschaftlichen Entwicklungen hat sich auch das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter in den einzelnen Organisationen[1] stark verändert. Die schnelle Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten, Methoden und Abläufen erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Kooperationsfähigkeit seitens der Mitarbeiter. Die neuen Anforderungen sind z.T. sehr spezifisch und komplex. So setzt die Bearbeitung von Aufgaben nicht nur eine hohe Qualifizierung der Mitarbeiter voraus, sondern verlangt von den einzelnen Personen auch die Fähigkeit der Zusammenarbeit und Vernetzung. Die Notwendigkeit für gemeinschaftliche Lösungen mit dem Ziel einer Produktivitäts- und Leistungssteigerung, wie sie Gruppen- und Teamarbeit[2] ermöglichen, werden damit immer unumgänglicher.
Genauso wie die Organisationen und Unternehmen ständig steigende Ansprüche an ihre Mitarbeiter stellen, stellen auch die Mitarbeiter selbst neue Ansprüche an die jeweiligen Organisationen und Unternehmen, zu deren Erfolg sie beitragen. Der wachsende Wohlstand und der damit verbundene, gestiegene Lebensstandard, ein breiter Zuwachs an Bildung und den damit verbundenen Möglichkeiten, Einfluß zu nehmen, haben ein neues Arbeitsbewußtsein hervorgerufen. Statt eintöniger, mechanischer Pflichterfüllung möchte der Mitarbeiter heute besser informiert sein, durch mehr Partizipation und Autonomie am Arbeitsplatz aktiv am unternehmerischen Geschehen mitwirken können und sinnstiftende, verantwortungsvolle Arbeitsinhalte haben. So belegen zahlreiche Umfrageergebnisse von Rosenstiel (1992) und anderen, daß eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit und viel Kontakt zu anderen Menschen für immer mehr Arbeitnehmer von größerer Bedeutung ist als ein hohes Einkommen und gute Aufstiegsmöglichkeiten. 55 Prozent der Arbeitnehmer würden sogar lieber weniger verdienen, wenn sie dafür weniger arbeiten zu müssen (vgl. Faix; Laier 1991: S. 23).
Zahlreiche Unternehmen haben diesen Einstellungs- und Wertewandel erkannt und versuchen, geeignete Maßnahmen zu treffen, den Ansprüchen der Mitarbeiter entgegenzukommen, ihren Bedürfnissen nach Selbstverwirklichung, erweitertem Handlung-, Tätigkeits- und Entfaltungsspielraum zu begegnen und damit ihre Motivation, Leistungsbereitschaft und Identifikation mit der Arbeit herauszufordern. Spätestens seit dem Auftreten der „Human-Relation-Bewegung“[3] als Folge der Hawthorne-Studie[4] gilt die Thematik der sozialen Gruppen als eines der zentralen Themen der soziologisch-sozialpsychologisch orientierten Organisationsforschung. Auch wirtschaftlich orientierte Organisationen verstanden es, dieses Thema aufzugreifen, um damit u.a. Leistungs- und in Folge Umsatzvorteile zu erzielen. Insbesondere im Zuge der Diskussion um die „Humanisierung der Arbeit“ in den 70er und 80er Jahren entstanden vielfältige Gruppenarbeitskonzepte, deren Vor- und Nachteile bis heute diskutiert werden.
Galten jahrzehntelang Humanität und wirtschaftliche Effizienz als polarisierte Gegenspieler, so stellen menschenwürdige, individuelle Arbeitsplätze, die den Mitarbeitern vielfältige Möglichkeiten und Freiräume zur Selbstverwirklichung bieten, heute für moderne, langfristig an Gewinn orientierten und stabilen Unternehmen keine mögliche Alternative mehr dar, sondern werden sogar als Voraussetzung für deren wirtschaftliche Erfolge gesehen. Das unternehmerische Streben nach gewinnbringendem Vorteil wird mit dem Wohlbefinden der jeweiligen Mitarbeiter verbunden, wirtschaftliche Effizienz und die sozialethische Forderung nach Humanität fließen zusammen. Der Mensch rückt zunehmend in den Mittelpunkt des Betriebsgeschehens und seine Qualifikation wird zur wichtigsten Ressource der Organisation und des Unternehmens. Der Mensch muß in seinem Qualifikationsprofil an die ständigen Veränderungen der Organisationen und Unternehmen immer wieder aufs neue angepaßt werden bzw. sich selbst anpassen, um einen fortwährenden Produktionsfluß auch unter weiterentwickelten, veränderten betrieblichen Bedingungen zu gewährleisten. Gerade weil eine neue Arbeitsform wie Gruppenarbeit einige Besonderheiten gegenüber herkömmlichen Arbeitsmodellen aufweist und von den in der Gruppe tätigen Individuen Anpassungsleistungen und spezielle Fähigkeiten erfordert, sind Qualifizierungsmaßnahmen in dieser Hinsicht unumgänglich, um die Umsetzung des Gruppenvorhabens erfolgreich verwirklichen zu können.
Aber gerade hier tauchen oft die größten Probleme auf: Die Notwendigkeit qualifizierender Anpassungsmaßnahmen auf veränderte Bedingungen in Betrieben wird oftmals zu spät oder nicht in vollem Ausmaß erkannt, geschweige denn rechtzeitig eingeleitet. Neue Produkte, Methoden, Abläufe und Konzepte (wie z.B. Gruppen- und Teamarbeit in Unternehmen) werden einfach eingeführt und übernommen, ohne dafür die jeweiligen strukturellen sowie persönlichen Voraussetzungen der einzelnen Mitarbeiter zu berücksichtigen, dementsprechend zu verändern oder gar erst zu schaffen. Zwar wird inzwischen schon bei den Bewerbungen vermehrt auf Qualifizierungsmerkmale wie „Teamfähigkeit“, „soziale Kompetenz“ und „Persönlichkeit“ geachtet und als wichtige Zugangsvoraussetzung gefordert; doch schließt sich hier ein weiteres Problem an: nämlich die Frage, wer die Mitarbeiter auf diese veränderten Rahmenbedingungen und Arbeitsformen in den Organisationen und Unternehmen vorbereiten soll und in wessen Zuständigkeitsbereich diese Aufgabe der Qualifizierung bzw. Weiterbildung fällt? Diese Fragen sind immer wieder sehr umstritten und werden aus den verschiedensten Gesichtspunkten (z.B. Kosten, Zeit, etc.) unterschiedlich bewertet und gehandhabt. Die Palette, ob und inwieweit diese Probleme in Organisationen wahrgenommen bzw. wie mit ihnen umgegangen wird, reicht von völliger Ignoranz der Thematik über selbstorganisierte Lerngruppen bis hin zu professionellen, institutionalisierten Weiterbildungsprogrammen durch externe Unternehmensberater. Diese genauer zu untersuchen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Ich habe sowohl im Rahmen meines Studiums (im Praktikum und in Arbeitsgruppen - wie z.B. der für die gemeinsame, mündliche Prüfung im Studienschwerpunkt) als auch außerhalb (in verschiedener Form von Gemeindearbeit und in Sportvereinen) immer wieder selbst in Teams gearbeitet, was mich oft durch auftretende Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich an meine persönlichen Grenzen gebracht hat. Gleichzeitig habe ich jedoch meine eigene Person, mein Verhalten und das von anderen - mit Hilfe von Supervision, Beratung und Begleitung von außenstehenden Mentoren[5] - immer mehr reflektieren gelernt und durch die Aneignung von wissenschaftlichen Theorien in den einzelnen Disziplinen (v.a. in den Teilgebieten der Psychologie) im Laufe meines Studiums zunehmend ein Verständnis für menschliches Verhalten gewonnen, das mich motivierte, viele der hilfreichen (Er-)Kenntnisse in meinen Alltag zu integrieren, praktisch anzuwenden und einzuüben.
Dabei habe ich über einen längeren Zeitraum eine wichtige Feststellung gemacht: Allein das Wissen und bessere Verständnis der eigenen Person und des sozialen Umfelds ist oft schon eine Hilfe und wichtige Voraussetzung zum Erlernen eines verbesserten Umgangs mit anderen. Der Erwerb dessen kommt aber in den meisten Studiengängen und Ausbildungen - v.a. wenn diese inhaltlich nicht unbedingt in erster Linie mit Menschen zu tun haben - viel zu kurz (wie z.B. BWL, technische Berufsausbildungen etc.). Die Folgen davon sind in der Praxis oft verheerend, was ich aus vielen Erfahrungsberichten von Arbeitnehmern in diesen Bereichen weiß und aus eigenen Erfahrungen in diversen Jobs bestätigen kann. Sie werden in den letzten Jahren zunehmend als problematisch erkannt. Gerade in der Wirtschaft boomen deshalb Weiterbildungsprogramme und -seminare zu den Themen „Persönlichkeit“, „Kommunikation“ und „soziale Kompetenz“ (vgl. Manager Seminare Nr. 32, Juli 98, S.88ff.), die meist von externen Trainern oder Beratern veranstaltet und durchgeführt werden.
Da aus meiner längeren, intensiven, persönlichen Beschäftigung mit diesen Themen mehr und mehr der Wunsch entstanden ist, mich evtl. auch beruflich in diese Richtung zu orientieren, habe ich mich bei der Ausarbeitung meiner Diplomarbeit überwiegend auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt, da er mir dafür der unerforschtere Markt zu sein scheint, dem ich aus sozialpädagogischer Sicht mit meiner Arbeit innovativeres Material bieten möchte. Das heißt jedoch nicht, daß die zugrundeliegenden Gedanken nicht genauso gut für den sozialen Bereich verwendbar sind - was meine eigene Umsetzung in die Praxis (siehe Punkt 4.1.3.) bestätigt.
In meinen Ausführungen geht es mir also überwiegend darum, aufzuzeigen,
1. daß die eigene Person mit ihren Eigenschaften und Fähigkeiten der wichtigste Schlüssel für Arbeit und Beruf ist, die entsprechend den veränderten Arbeitsformen und Rahmenbedingungen in Organisationen - wie sie z.B. Teamarbeit erfordert - Qualifizierung braucht;
2. daß die Kenntnisse über die eigene Persönlichkeit mit ihren Stärken und Schwächen Ausgangsposition und Voraussetzung für jegliche Entwicklungsmöglichkeit - hier mit dem Ziel verbesserter Teamfähigkeit - darstellt,
3. daß und inwiefern auf dieser Erkenntnis beruhend Persönlichkeitsentwicklung v.a. im Hinblick auf eine Zusammenarbeit mit anderen Menschen - wie bei Teamarbeit - möglich ist.
Wo und in welchem Rahmen diese Vorschläge umsetzbar sind, soll unter Punkt 5. nur angedacht werden, da dies stark von den jeweiligen Unternehmen bzw. Organisationen abhängt, auf die ich mich hier nicht genau festlegen möchte.
Der Begriff „Persönlichkeitsentwicklung“, der in der aktuellen Managementliteratur ein stehender, wenn auch mißverständlicher Begriff ist, soll im Zusammenhang mit meiner Arbeit nicht im rein entwicklungspsychologischen Sinn verstanden werden, sondern eher in der Bedeutung so wie er z.B. von Linneweh; Hofmann (1995) unter dem Begriff „Persönlichkeits-management“ auftaucht: Nämlich als effektives Management der eigenen Person mit dem Ziel, diese bewußt und selbstbestimmt zu führen und in einem lebenslangen Lernprozeß die persönliche Kompetenz im Umgang mit anderen Menschen und Umständen durch Reflexion und aktive Steuerung zu steigern (vgl. ebenda: S.75ff.).
Dennoch möchte ich das in diesem Sinn verstandene „Persönlichkeitsmanagement“, für dessen Zwecke in erster Linie die Grundregeln der ökonomischen Managementlehren auf das Aufgabenfeld der eigenen Person übertragen werden (vgl. ebenda: S.75), insoweit von dem von mir verwendeten Begriff „Persönlichkeitsentwicklung“ abgrenzen, als daß es mir nicht um das Ziel geht, auf das eigene ICH gerichtete Lebensstrategien zu entwickeln, die den Menschen bzw. Mitarbeitern helfen sollen, zu einer höheren Lebenszufriedenheit zu gelangen (vgl. ebenda: S.76).
Mir geht es vielmehr darum, aufgrund der gesellschaftlich bestehenden Notwendigkeit, Mitarbeiter an veränderte Bedingungen anpassen zu müssen (siehe oben), Möglichkeiten aufzuzeigen, im Rahmen der Weiterbildung die eigene Person - ausgehend von der Kenntnis der eigenen Persönlichkeit - durch den Erwerb von fehlenden Kompetenzen weiterzuentwickeln. Einige Autoren - wie z.B. Richter (1995) oder Geißler et al. (1995) - fassen den Erwerb dieser fehlenden Kompetenzen als Teil der Persönlichkeitsentwicklung unter dem „Konzept der Schlüsselqualifizierung“ (nach Richter, 1995)[6] zusammen, auf das ich in Teilen meiner Arbeit zwar zurückgreifen bzw. verweisen werde, dessen genaue Ausführungen ich jedoch unterlassen werde, da es mir in erster Linie um eine persönliche Weiterentwicklung und den Erwerb von Kompetenzen im Zusammenhang mit Teamarbeit geht. All diesen Ansätzen liegt die Annahme zugrunde, daß die menschliche Persönlichkeit in ihrer individuellen Besonderheit weniger ein abgeschlossenes Produkt ist, sondern vielmehr ein ständig fortschreitender Prozeß, auf den bewußt Einfluß genommen werden kann (vgl. Persönlichkeitstheorien von Allport, 1949 und Thomae, 1955). Der Begriff „Teamarbeit“ soll hier in Anlehnung an das Verständnis von Katzenbach et al. (1993: S.149) als Mittel zur Leistungserstellung angesehen werden und nicht als Selbstzweck (z.B. in therapeutischem Sinne).
Bei meiner weiteren Vorgehensweise werde ich zuerst skizzieren, was ich allgemein unter guter Teamarbeit verstehe und welche notwendigen Voraussetzungen dafür v.a. hinsichtlich der persönlichen Qualifikation und der Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter gegeben sein müssen. In einem zweiten Schritt werde ich aufzeigen, inwieweit die eigene Persönlichkeit und die Kenntnis über ihre Stärken und Schwächen gerade für eine Zusammenarbeit mit anderen Menschen - wie bei der Teamarbeit - so eine wichtige Rolle spielt. Daraus werde ich in einem dritten Schritt Überlegungen anstellen, wie sich die Persönlichkeit v.a. im Hinblick auf Teamfähigkeit entwickeln läßt. Abschließend werde ich kurz beschreiben, unter welchen Rahmenbedingungen diese Persönlichkeitsentwicklung möglicherweise stattfinden könnte.
2. Teamarbeit und ihre Voraussetzungen
2.1. Begriffsklärung: Teamarbeit
Der Begriff „team“ kommt ursprünglich aus dem Englischen und bedeutet wörtlich übersetzt „Mannschaft“ (Sport) oder „Gespann“ (Messinger et al., 1990: S.589). Beim Team handelt es sich um eine leistungsorientierte Kleingruppe, bei der sich mehrere Personen für einen längeren Zeitraum zusammenschließen, um eine sportliche oder arbeitsbezogene Tätigkeit gemeinsam, mit vereinten Kräften zu verrichten. Hauptkennzeichen dieser Tätigkeit ist, daß immer eine Bearbeitung von Problemen im Vordergrund steht, deren Lösung aufgrund ihrer Komplexität nicht immer von einzelnen Personen bewältigt werden kann und somit der Mithilfe und Unterstützung anderer Personen bedarf.
Unter Teamarbeit wird in der Fachliteratur daher eine Form partnerschaftlicher Zusammenarbeit verstanden, bei der die einzelnen Teammitglieder in unmittelbarem Kontakt stehen und unter der Voraussetzung gegenseitiger Akzeptanz und ständiger Kooperation die fachlichen und persönlichen Fähigkeiten und Kenntnisse jedes einzelnen Teammitgliedes für die Erreichung eines gemeinsamen Zieles konstruktiv genutzt und eingesetzt werden (vgl. Spangenberg, 1972; Scherpner et al., 1976). Bei der Problemlösung stehen überwiegend kommunikative Prozesse im Vordergrund. Die einzelnen Teammitglieder sind einander in ihrer Wertigkeit gleichgestellt und können dabei gleiche oder ungleiche Professionen haben (vgl. Schneider, 1996: S.96f.).
2.1.1. Merkmale von Teamarbeit
In Abgrenzung zu dem Begriff „Gruppe“ lassen sich zusammenfassend folgende entscheidende Merkmale der Teamarbeit (vgl. Katzenbach et al., 1993: S.70ff.) festhalten:
- die Notwendigkeit ergänzender Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder
- eine gemeinsame, längerfristige Ziel-und Leistungsorientierung,
- ein kooperativer Arbeitsstil und
- wechselseitige Verantwortlichkeit als Ausdruck von Engagement und Vertrauen.
Damit wird deutlich, daß der größte Vorteil eines Teams gegenüber anderen Formen von Gruppen v.a. in der Möglichkeit eines erhöhten Leistungspotentials liegt, was oft auch als Synergieeffekt eines Teams beschrieben wird. Dieser Leistungsvorteil und das synergetische Ergebnis eines Teams, das häufig durch das potenzierte Addieren von Einzelfähigkeiten, z.B. durch die Formel 2+2=7, dargestellt wird, ist wesentlich höher als die einfache Summe der Einzelfähigkeiten der Teammitglieder (2+2=4) (vgl. Ueberschaer, 1997: S.31). Der Ergänzungsgedanke der verschiedenen Fähigkeiten und Kenntnisse der einzelnen Teammitglieder und der notwendige kooperative Umgang mit den unterschiedlichen Herangehensweisen an die zu bewältigenden Aufgaben in einem Team sind für das Zustandekommen des Synergieeffektes eine wichtige Voraussetzung.
Auch der bewußten Pflege der emotionalen Beziehungen im Team kommt deshalb eine sehr wichtige Bedeutung zu, da erst dadurch genügend Solidarität für eine offene Bewältigung von Wert- und Zielkonflikten möglich wird. Je intensiver die Zusammenarbeit auf Grundlage wechselseitig positiver Gefühle der einzelnen Gruppenmitglieder untereinander wird und je mehr gemeinsame Symbole gefunden und gemeinsame Erfahrungen gemacht werden, desto größer wird der Zusammenhalt einer Gruppe und ein ausgeprägtes Wir-Gefühl. Dieser Ausdruck eines starken Zugehörigkeitsgefühls und einer gemeinsamen Gruppenidentität wird oft auch als „Teamgeist“ bezeichnet (Puch, 1994: S.138).
Die längerfristige bis dauerhafte Zusammenarbeit, auf die Teams meist angelegt sind, bringt unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit gegenüber temporären, offenen Gruppenkonzeptionen einen weiteren Vorteil: Den Ergebnissen verschiedener Untersuchungen zur Folge verläuft die Leistungskurve einer Gruppe entsprechend dem gruppendynamischen Verlaufsprozeß (siehe Punkt 2.4.1.). Damit wird ein hohes, maximales Leistungspotential erst nach einem längeren Zeitraum (von etwa 2-3 Jahren) erreicht, wenn die Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit geschaffen ist (vgl. Rosenstiel, 1992: S.272). Somit ist Teamarbeit nach Senge (1990) immer auch als ein langer, zielgerichteter Lernprozeß zu sehen.
Um bei den weiteren Ausführungen leichter verdeutlichen zu können, inwiefern es sich bei Teamarbeit um eine besondere Form von Gruppenarbeit handelt, die deshalb auch spezifische Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Qualifikationen der einzelnen Gruppenmitglieder erfordert, werde ich im Folgenden durch zwei Ordnungsschemata einen Überblick geben, wo und wie Teamarbeit sich unter andere Gruppenmodelle in Organisationen einordnen läßt.
2.1.2. Einordnung von Teamarbeit unter andere Gruppenmodelle
Wie schon in der Einleitung erwähnt, wurden insbesondere im Zuge der Diskussion um die „Humanisierung der Arbeit“ in den 70er und 80er Jahren verschiedene Gruppenmodelle entwickelt, die in der Praxis von Organisationen angewendet werden. Zu ihnen zählen u.a. Gruppenfertigung, teilautonome Arbeitsgruppen, Qualitätszirkel, Lernstatt, Werkstatt, Projektgruppen, Teams, usw.. Bei der Einordnung von Teams in die verschiedenen Gruppenmodelle lehne ich mich an den Vorschlag von Bungard; Antoni (1993: S.382f.) an, die die Gruppenkonzeptionen nach zwei Dimensionen ordnen (Abb.1):
1. die Art der organisatorischen Einbindung in die Organisation (integriert/außerhalb)
2. die Dauer der Zusammenarbeit (kontinuierlich/temporär)
Abb. 1: Formen von Gruppen in Unternehmen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Quelle: Wahren, 1994: S.34)
Dieses Ordnungsschema in Abb.1 verdeutlicht, wie die Teamarbeit - als ein Gruppenmodell unter anderen - in der Art der Verankerung und Zusammenarbeit in Organisationen einzuordnen ist: Sie ist integrierter Bestandteil einer Organisation und auf relativ dauerhafte Zusammenarbeit angelegt.
Eine weitere Möglichkeit, Teams in die unterschiedlichen Formen von Gruppenmodellen einzuordnen, ist eine Unterscheidung von Gruppen nach ihren Aufgaben und Zielsetzungen in Leistungs- bzw. Problemlösegruppen (Abb. 2):
Abb. 2: Modelle gruppenorientierter Arbeitsgestaltung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Quelle: Puch, 1994: S. 137f.)
Dieses Schema (Abb. 2) verdeutlicht, daß es sich bei einem Team um eine Form von Leistungsgruppe handelt. Im Gegensatz zu Problemlösegruppen, bei denen es eher um die Bearbeitung mitarbeiterorientierter Probleme geht, liegt hier der Schwerpunkt überwiegend in der Bewältigung fachlicher und leistungsorientierter Aufgaben.
Auf Grundlage dieses Verständnisses lassen sich notwendige Voraussetzungen für eine gute Teamarbeit ableiten, die ich in Anlehnung an Wahren (1994) auf drei Ebenen beschreiben will:
- auf struktureller Ebene (Punkt 2.2.)
- auf personeller Ebene (Punkt 2.3.)
- und auf interaktioneller Ebene (Punkt 2.4.)
Dabei ist mir bewußt, daß eine genaue Trennung der einzelnen Ebenen nur schwer möglich ist, da die Ebenen sich immer wieder stark überschneiden und wechselseitig beeinflussen oder gar bedingen. Doch der Versuch einer getrennten Betrachtungsweise soll es später erleichtern, den Schwerpunkt bei den Ausführungen meiner Arbeit verstärkt auf die letzten beiden Ebenen zu legen.
2.2. Strukturelle Voraussetzungen
Um beim weiteren Vorgehen bei den Begriffen mehr Klarheit zu schaffen, möchte ich zunächst durch ein Zitat definieren, was ich unter „Strukturen“ verstehe:
„Die Struktur [einer Organisation] ist das Ergebnis von getroffenen Regelungen und vereinbarten Normen, die das Verhalten und die Leistung der MitarbeiterInnen steuern. Im einzelnen regelt die formelle Struktur die Art und den Umfang der Aufgabenverteilung, die Stellenbildung, die Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse, die Verteilung der Verantwortung, die hierarchische Über- und Unterstellung sowie die Kommunikationsbeziehungen und Informationskanäle.“ (Puch, 1994: S.45)
Teamarbeit kann nicht losgelöst von den Strukturen einer Institution, in der sie stattfindet, betrachtet werden. Sie kann nur da sinnvoll und effektiv aufgebaut werden, wo auch der institutionelle Rahmen dafür gegeben bzw. dafür geschaffen wird. Zwar müssen teamarbeitsfreundliche Strukturen nicht zwangsläufig zu guter, effektiver Teamarbeit führen; vielmehr müssen die Mitarbeiter individuelle Fähigkeiten besitzen - die ich unter dem Punkt 2.3. genauer beschreiben werde -, um die von der Einrichtung gegebenen Möglichkeiten gewinnbringend nutzen zu können. Dennoch werden auch Mitarbeiter, die über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, keine wirklich effiziente Arbeit im Team leisten können, wenn in der Institution teamfeindliche Strukturen vorherrschen (Merchel, 1980: S.180).
2.2.1. Technische und organisatorische Voraussetzungen
Im Zuge der einleitend beschriebenen Veränderungen der Arbeitseinstellung der Mitarbeiter sollte deshalb bei einem entsprechendem Wandel der Organisationsstruktur v.a. auf eine Veränderung der Macht-, Einfluß- und Komptenzverhältnisse im Sinne einer Delegation von Entscheidungsbefugnissen nach unten angestrebt werden, die die Grundlage für effektive Teamarbeit bildet (Fürstenau, 1970: S. 221f.). Institutionen, in denen einerseits Teamarbeit angestrebt wird, aber gleichzeitig hierarchische Strukturen vorherrschen, bergen einen Widerspruch in sich (Quiske et al., 1973: S.34). Im Zuge der Veränderungen zu einem Hierarchieabbau in Organisationen und Unternehmen, der den Mitarbeitern mehr Handlungs- und Entscheidungsfreiheiten einräumt, ist deshalb zu beachten, daß die Funktion des Leiters sich wandelt. Hatte dieser im Rahmen der tayloristischen Arbeitsorganisation die Funktion des Anweisers und Controllers, wandelt sich dieses Bild mehr und mehr zu einem Trainer und Entwickler von Gruppen. Seine Aufgabe liegt demnach nicht mehr so stark im Führen von Einzelpersonen, sondern vielmehr im situativen Führen und Managen von Rahmenbedingungen, in denen die Gruppen ihre Aufgaben erfüllen können (vgl. Grün. In: Personalführung, H.2 Jg. 26: S.97). Auf die konkreten Arbeitsplatzbedingungen will ich hier nur sehr kurz eingehen, da sie die Kernaussagen meiner Arbeit lediglich tangieren.
Durch die Anordnung der Arbeitsplätze wird entscheidend beeinflußt, ob und inwieweit Kommunikation, soziale Kontakte und der Austausch von Informationen überhaupt möglich werden. Da bei Teamarbeit überwiegend kommunikative Prozesse im Vordergrund stehen, sollte die Einrichtung von Gruppenarbeitsplätzen so gestaltet sein, daß sie einen guten Blickkontakt und eine unmittelbare Kommunikationsmöglichkeit für jeden erlauben. Es bieten sich z.B. ringförmige Strukturen mit räumlicher Nähe aller erforderlichen Arbeitsplätze an, die eine effektive Zusammenarbeit begünstigen.
2.2.2. Die Struktur von Teams
Die Struktur von Teams wird von einer Reihe von Faktoren geprägt, die allgemein der von Kleingruppen entsprechen. Mir erscheinen jedoch aus dem Studium unterschiedlichster Literatur und aufgrund von Erkenntnissen aus der Teampraxis folgende strukturellen Bereiche für eine effektive Teamarbeit als besonders beachtenswert: Teamgröße, Teamziele, Leitung, Aufgabenverteilung und Kommunikationsstruktur.
- Teamgröße
Untersuchungen zum Kommunikationsverhalten in Gruppen von Gibb; Bass (in: Wahren, 1994: S.131) haben ergeben, daß sowohl der Prozentsatz der Personen, die Ideen haben, sie aber nicht äußern, als auch der Prozentsatz der Personen, die während einer Diskussion nie sprechen, bei wachsender Gruppengröße (schon ab vier Personen) zunimmt. Da bei Teamarbeit gerade der kommunikative Aspekt eine wichtig Voraussetzung und Rolle spielt, sollte deshalb auf eine angemessene Teamgröße geachtet werden. Nach der Erfahrung vieler Teampraktiker liegt die optimale Teamgröße bei drei bis fünf, höchstens aber fünf bis sieben Teammitgliedern, was sich auch mit organisationspsychologischen Untersuchungen zur Motivation in Gruppen deckt (vgl. Körkel, 1998). Ist das Team zu groß, nimmt der Zusammenhalt des Teams ab, da die Kontakt- und Interaktionsmöglichkeiten unter den einzelnen Teammitgliedern automatisch verringert werden. Aufgabenrelevante Informationen können nicht mehr mit der erforderlichen Schnelligkeit fließen; es kommt zur Bildung kontraproduktiver Untergruppen. Nach Schneider; Knebel (1995: S.38) ist die Teamgröße abhängig von der Komplexität und dem Umfang der jeweiligen Teamaufgabe und sollte entsprechend dem Schlüssel ´Nur so viele Teammitglieder wie unbedingt nötig, um die einzelnen Teilaspekte mit ihnen abzudecken` bemessen werden.
- Teamziele
Wie schon bei den Merkmalen von Teamarbeit in Abgrenzung zu dem Begriff „Gruppe“ er-wähnt, kennzeichnet ein Team seine gemeinsame Ziel- und Leistungsorientierung. Dabei ist zu beachten, daß die Ziele so klar und konkret formuliert werden sollten, daß sie für alle ver-ständlich, erreichbar und damit gut überprüfbar sind. Sie sollten dazu immer wieder flexibel nach den Anforderungen der jeweiligen Situation und Sachlage gestaltet und von allen Team-mitgliedern unterstützt und mitgetragen werden. Nach Senge (1996: S.284ff.) ist die Ausrich-tung eines Teams auf einen gemeinsamen Zweck, eine gemeinsame Vision, „eine notwendige Bedingung , damit das Empowerment des einzelnen zum Empowerment des ganzen Teams bei-tragen kann“ (ebenda: S.286), was oben (siehe Punkt 2.1.1. Merkmale der Teamarbeit) auch als Synergieeffekt beschrieben wurde. Nur wo alle Teammitglieder an den Zielen und Visionen mitformulieren und sich dementsprechend mit ihnen identifizieren können, werden sie sich diesen auch verpflichtet fühlen und somit die gemeinsame Leistung durch die gebündelte Energie stei-gern. Zudem sollte über eine gemeinsame Strategie zur Umsetzung der Ziele Einigkeit herrschen.
- Leitung
Vorweg möchte ich hinsichtlich der Autoritäts- und Machtstruktur eines Teams nochmals darauf hinweisen, daß in Teams eine grundsätzlich personale Gleichwertigkeit der einzelnen Teammitglieder besteht, was Schneider; Knebel (1995) für „eine sehr wesentliche strukturelle Bedingung für die Funktionsfähigkeit eines Teams“ (S.40) hält. Dennoch haben „Experimente mit Arbeitsteams aus Forschung, Industrie- und Dienstleistungsbetrieben [...] eindeutig bewiesen, daß ein Team ohne eine gezielte Steuerung durch einen formal bestimmten Leiter nicht leistungsfähig ist“ (Quiske et al., 1973: S.105). Sie neigen dazu, sich in Diskussionen zu verlieren, die Mitglieder tragen Macht- und Profilierungskämpfe aus, und es bilden sich informelle Führerschaften (vgl. ebenda). Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, sollte für jedes Team ein formaler Teamleiter bestimmt werden. Da Gruppen für sich schnell eine vertikale Rollendifferenzierung finden, schließe ich mich der Meinung von Wahren (1994: S.147) an, daß die Wahl des jeweiligen Teamleiters jedem Team selbst überlassen bleiben sollte. Die Funktion dieses Teamführers als „Erster unter Gleichwertigen“ (Decker, 1988: S.17) ist die einer „Service- Funktion“ für die übrigen Teammitglieder (Quiske et al., 1973: S.106). Der Teamleiter ist also kein übergeordneter Vorgesetzter über die anderen Teammitglieder, sondern „eigentlich der Spezialist in Sachen Koordinieren von Spezialisten“ (Schneider; Knebel, 1995: S.42). Seine Aufgaben bestehen nach Schneider; Knebel (1995: S.42f.) darin,
„die interpersonelle, multi- und interdisziplinäre, interfunktionale (gegebenenfalls auch übernationale) Zusammenarbeit der verschiedenen hochqualifizierten Spezialisten und Experten zu organisieren und die optimalen Bedingungen zu schaffen, damit deren Engagement, wechselseitiges Vertrauen wie Kreativität zur Entfaltung kommen. Er hat ferner die Aufgabe, die zeitweilig widerstreitenden Interessen der Teammitglieder miteinander vereinbar zu machen, ihnen zu helfen, die einzelnen Aufgabenstellungen kontinuierlich aufeinander abzustimmen, dabei die Schnittstellen- wie auch die logistischen Probleme zu lösen, die Einzelaktivitäten für den jeweiligen Problembereich synergetisch zusammenzufassen, Spannungen, die sich aus der Verschiedenartigkeit der Teammitglieder ergeben, abzubauen, für einen kooperativen Arbeitsstil im Team zu sorgen, zu einem reibungslosen Ablauf der Teamarbeit entscheidend beizutragen und das Team über kritische Phasen hinwegzuführen“
Die dargestellten Aufgaben eines Teamleiters stellen sehr hohe Ansprüche an seine Funktion. Dabei sollte jedoch nicht vergessen werden, daß Teamarbeit ein gemeinsamer Lernprozeß ist, bei dem Fehler gemacht und daraus Erfahrungen gesammelt werden können. Zudem ist es wichtig, daß die einzelnen Teammitglieder den jeweiligen Leiter unterstützen. Um eine Verfestigung von Teamrollen zu vermeiden, ist es notwendig, die Leitung in gewissen Zeitabständen zu wechseln. Ein sinnvoller Turnus für den Wechsel muß sich aus den konkreten Arbeitsbedingungen des Teams entwickeln (Neumann, 1974: S.88).
- Aufgabenverteilung
Von wesentlicher Bedeutung bei der Aufgabenverteilung ist die fachliche Kompetenz der ein-zelnen Gruppenmitglieder. Dieser entsprechend sollten in einem Team die Aufgaben klar und sinnvoll verteilt, die jeweiligen Ziele so unmißverständlich wie möglich abgesteckt und so präzise wie möglich formuliert, die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Tätigkeiten festgelegt und die möglichen Schnittstellen hinreichend exakt definiert werden (vgl. Schneider; Knebel, 1995: S.36f.). Dabei sollte die Aufgabenverteilung nicht als starre Kompetenzzuweisung gesehen werden, sondern jeder Mitarbeiter bereit sein, „über die eigenen „Kompetenzen“ hinaus zu wirken, wenn die aktuelle Situation dies verlangt“ (Scherpner et al., 1976: S.46).
- Kommunikationsstruktur
Wie aus den vorangehenden Ausführungen sicherlich deutlich wird kommt der Kommunikation in einem Team eine wesentliche Bedeutung zu. Sie ist sowohl für die Einigung über gemeinsame Teamziele als auch für die kooperative Zusammenarbeit in einem Team grundlegende Voraussetzung. Auch nach Schneider, Knebel (1995: S.32ff.) hängt die Funktionsfähigkeit eines Teams in hohem Maße von der Beschaffenheit und Qualität der Kommunikationsstruktur ab. Eine hierarchische Kommunikationsstruktur sollte dabei durch eine sogenannte kommunikative Vollstruktur (Wahren, 1994: S.136f.) ersetzt werden: Jedes Teammitglied sollte uneineingeschränkt mit jedem Teammitglied kommunizieren bzw. sich an der Kommunikation beteiligen können, um somit Sender und Empfänger von Informationen zugleich sein zu können.
2.3. Persönliche Voraussetzungen und Fähigkeiten
Für Domisch et al. (1993. In: Ueberschaer, 1997: S.56) stellen folgende Fähigkeiten und Verhaltensweisen innerhalb eines Teams die persönliche Voraussetzung guter Teamarbeit dar:
„Sich in ein Team integrieren, auf andere eingehen und sich allgemein kollegial und fair verhalten. Gefühle, Anliegen, Probleme und Meinungen anderer anerkennen, respektieren und darauf eingehen. Absprachen einhalten; loyales Verhalten dem Gruppenentscheid gegenüber. Anderen bei Schwierigkeiten helfen. Das Gruppenklima durch ausgleichendes, schlichtendes Verhalten positiv beeinflussen. Mit offenen Karten spielen; Informationen nicht irreführender Art und Weise benutzen. Kompromißbereitschaft. Zuhören, ohne andere zu unterbrechen. Keine Spannungen und Aggressionen erzeugen. Auf Angriffe nicht aggressiv reagieren.“
Neben den strukturellen Faktoren hängt die Leistungsfähigkeit von Teams entscheidend von der persönlichen Qualifikation bzw. der Teamfähigkeit der einzelnen Teammitglieder ab (vgl. Wahren, 1994: S.207). Aus dem Zitat von Domisch et al. (1993) wird bereits deutlich, daß zur Teamarbeit eine Vielzahl an persönlichen Voraussetzungen erwartet und gefordert wird. Was man genau unter dem Begriff „Teamfähigkeit“ versteht und wie er definiert wird, darüber ist man sich in der Literatur allerdings nicht ganz einig. Dennoch lassen sich gewisse Überschneidungen von Anforderungsprofilen und wichtigen Voraussetzungen der einzelnen Teammitglieder für eine konstruktive, effektive Zusammenarbeit feststellen, die ich im folgenden Teil zusammenfassen will.
2.3.1. Der Begriff der Teamfähigkeit und ihre Merkmale
Der Begriff „Teamfähigkeit“ ist heutzutage bei Stellenanzeigen, Personalfrage- und Leistungsbeurteilungsbögen, Anforderungsprofilen sowie Weiterbildungsprogrammen zum regelrechten Modewort geworden. „Eine exemplarisch durchgeführte Auswertung von 98 Stellenanzeigen für Führungskräfte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Ende März 1998 bestätigt: Teamfähigkeit ist neben Fach- und Methodenkompetenz die am häufigsten gefragte Kompetenz,...“ (Manager Seminare Nr.32, Juli 98: S.90). Doch die Frage ist, was genau mit diesem Begriff gemeint ist, dessen Auslegung bzw. z.T. auch Auslegbarkeit in der Literatur und Praxis immer wieder umstritten ist und deshalb bei verschiedenen Autoren unterschiedliche Anforderungsprofile zur Folge hat. Ganz allgemein wird unter dem vielfach geforderten Persönlichkeitsmerkmal der „Teamfähigkeit“ „die Fähigkeit und Bereitschaft des einzelnen, in einem Team an der Erreichung festgesetzter bzw. vereinbarter Ziele menschlich und sachlich wirkungsvoll mitzuarbeiten“ (Schneider; Knebel, 1995: S.58) verstanden. Analog zu den Hauptmerkmalen von Teamarbeit, zu denen ein „kooperativer Arbeitsstil“ zählt (siehe Punkt 2.1.1.) wird deshalb der Begriff der „Teamfähigkeit“ oft im Zusammenhang mit dem Begriff der „Kooperationsfähigkeit“ genannt bzw. sogar gleichgesetzt. Welche genauen Qualifikationsmerkmale man nun mit einem „kooperativen“ bzw. „teamfähigen“ Verhalten verbindet, möchte ich deshalb zunächst an dem Begriff der „Kooperation“ genauer erläutern:
„Kooperation ist die Bezeichnung für solidarisches Zusammenwirken mehrerer Personen einer Gruppe zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels“ (Keller; Novak, 1991: S.202). Dabei benötigen die einzelnen die Fähigkeit, sich in die Gruppe integrieren zu können, ohne diese dominieren zu wollen. Sie müssen sich auf verschiedene Personen einstellen und sich aktiv einbringen können, um gemeinschaftliche Entscheidungen voranzutreiben. Unter der Voraussetzung der Akzeptanz sowohl eigener Fehler und Schwächen als auch der von anderen sollten Probleme der Kooperationspartner durch eigenes unterstützendes Verhalten bewältigt werden. Kooperatives Arbeiten erfordert eine Einigung über die Koordination der Handlungsabläufe, die von den Beteiligten eine gute Kommunikationsfähigkeit für das ständige Abstimmen, Anpassen und Vergleichen voraussetzt (vgl. Schuler; Barthelme, 1995: S.83).
Zusammenfassend lassen sich aus dem Studium unterschiedlichster Literatur (vgl. Bachmann, 1997: S.108ff.; Belbin, 1996: S.155ff.; Francis; Young, 1989: S.117ff.; Scherpner et al., 1976: S.14ff.; Schneider; Knebel, 1995: S.57ff.; Spangenberg, 1972: S.27ff.; Wahren, 1994: S.207f.) und in Anlehnung an die Ergebnisse einer Befragung von Führungskräften durch Jochum (1990: S.320) folgende wesentlichen Merkmalen von „Teamfähigkeit“ darstellen:
1. Aufgeschlossenheit
Bereitschaft zur Anerkennung und Einarbeitung in neuartige Gebiete und deren innovative Problemlösungen; Bereitschaft zur Akzeptanz anderer Meinungen, Ideen und Beiträge; grundsätzliche Offenheit und Bereitschaft zur Weiterbildung; Risikobereitschaft; Kreativität und aktive Freude am Gestalten;
2. Selbsterkenntnis und Selbstkontrolle
Reale Selbsteinschätzung; Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbstkritik; sachlich, ausgeglichenes Verhalten; Selbstbeschränkung;
3. Integrationsverhalten
Kontakt- und Partizipationsfähigkeit; auf andere eingehen können; Toleranz; Bereitschaft und Streben nach Konsens ohne Aufgabe der eigenen Identität und Meinung; aktive Beteiligung und Förderung des Gruppenklimas; Verantwortungsbewußtsein;
4. Kooperationsverhalten
Bereitschaft zur Unterstützung anderer und zur Aufgabenteilung; Dialogfähigkeit; Respekt und Achtung vor der Leistung anderer und die Bereitschaft zum Teilen von Erfolg; Wahrnehmung und Unterstützung gemeinsamer Ziele; Kompromißbereitschaft; Kritikoffenheit gegenüber den anderen Teampartnern; Flexiblität statt starres Festhalten des eigenen Standpunktes;
5. Kommunikationsverhalten
Kommunikationfähigkeit; Bereitschaft zur Einbringung und Weitergabe von eigenen Beiträgen, Erfahrungen, Anregungen und Informationsaustausch; Bereitschaft zum Zuhören; Konfliktfähigkeit;
6. Durchsetzungsvermögen
Fähigkeit, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen, eigene Standpunkte überzeugend darzustellen und sich für diese einzusetzen; Selbstbewußtsein; Fähigkeit, auch „Nein“ sagen zu können.
Diese dargestellten Merkmale dürfen allerdings nicht als eine stabile Größe beim einzelnen Teammitglied verstanden werden, sondern sind vielmehr durch die Dynamik des Gruppengeschehens veränderbar. Weiterhin sind die hier verwendeten Begriffe idealtypisch und können deshalb in ihrer Formulierung nicht als allein maßgeblich gelten. Ihre stichpunktartige Auflistung ist lediglich der Versuch, die Wichtigkeit personaler Voraussetzungen und Qualifikationen der einzelnen Teammitglieder, so wie sie sich für erfolgreiche Teamarbeit in der Teampraxis als hilfreich und notwendig erwiesen haben, hervorzuheben und zusammenzustellen.
Betrachtet man „Teamfähigkeit“ als eine Fähigkeit unter vielen, die ein Umstrukturierungsprozeß in Unternehmen im Zuge der immer schneller voranschreitenden Technologieentwicklung von ihren Mitarbeitern erfordert (siehe Hinführung zum Thema, Punkt 1.), so ließe sich sowohl der Begriff der „Teamfähigkeit“ als auch der Begriff der „Kooperationsfähigkeit“ bei dem sog. „Konzept der Schlüsselqualifizierung“ (nach Richter, 1995)[7] mit dem übergreifenden Ziel des Erwerbs einer individuellen Handlungskompetenz unter den Bereich der „Sozialkompetenz“ einordnen (ebenda: S.15).
Im folgenden werde ich deshalb näher erläutern, was ich unter diesem Begriff genauer verstehe und inwieweit er mit dem Begriff der „Teamfähigkeit“ zusammenhängt bzw. für Teamarbeit einen so zentralen Stellenwert besitzt.
2.3.2. Der Begriff der sozialen Kompetenz und sein zentraler Stellenwert
Der Begriff der „sozialen Kompetenz“ ist ebenso wie der Begriff der „Teamfähigkeit“ ein Modewort geworden, für das es bis heute „keine allgemein anerkannte und eindeutige, theoretisch begründete und empirisch überprüfte Definition“ (Damm-Rüger; Stiegler, 1996: S.42) gibt. Trotz der vielfältigen Varianten in der Begriffsbestimmung „teilen fast alle wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema den Grundgedanken, daß sozial kompetent handelnde Menschen fähig sein müssen, Kompromisse zwischen fremden Erwartungen und eigenen Interessen, zwischen sozialer Anpassung und Selbstverwirklichung zu finden und zu praktizieren“ (ebenda: S.43 und nach Heyse et al., 1997).
Soziale Kompetenzen umfassen damit sowohl die Fähigkeiten eines Menschen im Umgang mit sich selbst (=„Selbstkompetenz“ nach Richter, 1995: S.36), also eigene Bedürfnisse, Gefühle und Interessen wahrzunehmen und zu lenken, als auch die Art des Umgangs mit anderen, d.h. die Gefühle, Interessen und Bedürfnisse anderer wahrzunehmen, zu beachten und sich mit ihnen konstruktiv auseinanderzusetzen. Entscheidend ist nun unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, unter denen der soziale Umgang stattfindet, eine Balance zwischen diesen beiden Polen zu finden (vgl. Damm-Rüger; Stiegler, 1996: S.11 und Manager Seminare Nr. 32, Juli 98: S.90). Für diese Prozesse des Ausbalancierens sind deshalb komplexe Fähigkeiten wie Empathie[8], Rollendistanz[9], Ambiguitätstoleranz[10], Identitätsdarstellung[11] und Verständigung[12], die nach Krappmann (1971) zu den Bestandteilen der Ich-Identität[13] gehören, von größter Bedeutung.
Würde man hier die einzelnen Komponenten sozialer Kompetenz, so wie sie z.B. Damm-Rüger; Stiegler (1996: S.47) für den beruflichen Umgang mit Menschen ausführt, beschreiben, käme es zu einem ähnlichen Anforderungsprofil notwendiger Grundfähigkeiten, wie ich sie als Zusammenfassung der Merkmale von Teamfähigkeit unter dem Punkt 2.3.1. aufgeführt habe. Der Begriff „Teamfähigkeit“ läßt sich demzufolge „als eine Zusammenfassung mehrerer Facetten sozialer Kompetenz für den Spezialfall der Interaktion innerhalb einer Gruppe auffassen“ (Schuler; Barthelme, 1995: S.83).
Da bei Teamarbeit also gerade der soziale Aspekt, d.h. das soziale Miteinander auf der Grundlage von Kooperation von so entscheidender Bedeutung ist, möchte ich an dieser Stelle noch einmal genauer auf eine weitere zentrale Fähigkeit eingehen, die für jede Interaktion und Umsetzung sozialer Kompetenz Grundlage ist, und deshalb bei Stellenneubesetzungen - laut Untersuchungen von Siegrist (1995, S.41 u. 44) und Belz (1997. In: Belz; Siegrist, 1997: IV. Kursunterlagen S.8) - neben der oben beschriebenen „Kooperationsfähigkeit“ als Schlüsselqualifikation am meisten gefragt ist: die Kommunikationsfähigkeit .
Die Kommunikationsfähigkeit ist „ die Grundqualität des Menschen als ein soziales Wesen“ (Fittkau, 1990) und spielt demnach eine zentrale Rolle im zwischenmenschlichen Miteinander. Kommunikation, die sowohl auf verbaler als auch auf non-verbaler Ebene stattfinden kann, meint im Sinne der Kommunikationstheorien das Übermitteln einer Nachricht von einem Sender zu einem Empfänger, die laut Thun et al. (1989: S.18ff.) immer aus folgenden vier Aspekten besteht:
1. einem Sach- oder Inhaltsaspekt , bei dem es um die rein sachliche Information durch die Nachricht geht;
2. einem Selbstoffenbarungsaspekt , unter dem „sowohl die gewollte Selbstdarstellung als auch die unfreiwillige Selbstenthüllung “ (Thun et al., 1989: S.18) des Senders gemeint ist;
3. einem Beziehungsaspekt , der ausdrückt, wie der Sender zum Empfänger steht; und
4. einem Appell , mit dem der Sender versucht, Einfluß auf das Denken, Fühlen und Handeln des Empfängers zu nehmen.
Deshalb sind nach Fittkau (1990: S.301ff.) kommunikative Kompetenzen sowohl in der Rolle des Senders als auch in der Rolle des Empfängers immer unter diesen vier Aspekten zu betrachten. Dabei zählen zu den Senderqualitäten
1. auf der Inhaltsebene die Fähigkeit, Informationen in kurzer, klarer und deutlicher Form zu übermitteln;
2. auf der Selbstoffenbarungsebene die Fähigkeit, eigene Gefühle, Bedürfnisse, Interessen sowie Stärken und Schwächen auszudrücken und deutlich zu machen;
3. auf der Beziehungsebene geht es um die „beiden zentralen sozialen Anliegen des Menschen: „Macht“ [...] und „Liebe“ [...]. Dazu gehört die Fähigkeit zur expliziten Klärung der Machtverhältnisse in der Beziehung, der sensible Umgang mit Machtdemonstrationen, [...] und der Aufbau eines auf positiver Wertschätzung basierenden Kommunikationsklimas“ (ebenda: S.302); und
4. auf der Appellebene die Fähigkeit, auf andere Einfluß zu nehmen.
Zu den wesentlichen Qualitäten auf der Empfängerseite zählt v.a. das aktive Zuhören, dessen ganze Kunst nach Gordon darin besteht, „daß der Empfänger dem Sender die Ergebnisse seiner Dekodierung häufig und fortlaufend rückmeldet“ (1982: S.65). Dadurch lassen sich viele Mißverständnisse zwischen der Sender- und Empfängerseite vermeiden und es wird „ein Klima [geschaffen], in dem sich eine Person empathisch verstanden fühlen kann“ (ebenda: S.67). Letztlich beinhaltet kommunikative Kompetenz die Fähigkeit, Inhalts- und Beziehungsebene voneinander zu trennen.
Auch Wahren (1994) glaubt, daß „die Effizienz in der Zusammenarbeit von Gruppen [...] erheblich durch die soziale bzw. kommunikative Kompetenz der Gruppenmitglieder beeinflußt [wird]“ (S.180). Ich möchte deshalb noch mal die wesentlichen Fähigkeiten zur Kommunikation in Gruppen, so wie sie auch laut Wahren (1994: S.181f.) in der Literatur als Lern- und Trainingsinhalte zur Kommunikationsfähigkeit dargestellt werden, zusammenfassen:
- Fähigkeit zur Wahrnehmung eigenen und fremden Verhaltens
- Fähigkeit zur Wahrnehmung der Strukturen und Prozesse in Gruppen
- Beherrschung von Dialog- und Gesprächstechniken
- Fähigkeit zum Senden von „Ich-Botschaften“
- Fähigkeit zum aktiven Zuhören
- Beherrschung von Feedback-Techniken
- Fähigkeit zum konstruktiven Umgang mit Kritik und Konflikten
- Fähigkeit zur Metakommunikation[14].
2.3.3. Einstellung zur Teamarbeit
Um in einer Einrichtung oder einem Unternehmen ein teamfähiges Verhalten der Mitarbeiter zu fördern bzw. zu erzeugen, muß bei der Einstellung der Mitarbeiter zur Teamarbeit angesetzt werden. Unter Einstellung versteht man aus sozialpsychologischer Sicht eine Wahrnehmungsorientierung oder (Aus)richtungstendenz des Erkennens und Handelns, also eine zeitlich relativ stabile Haltung gegenüber einem besonderen Objekt oder einer Klasse von Objekten (nach Drever; Fröhlich, 1968). Diese Haltung kann in drei Komponenten zerlegt werden: 1. in eine kognitive Komponente (Überlegungen), 2. eine affektive (emotionale) Komponente und 3. eine Handlungstendenz. Meist ist mit der kognitiven und affektiven Komponente eine bestimmte Handlungstendenz, d.h. eine Bereitschaft, entsprechend (für oder gegen das Einstellungsobjekt) zu handeln, verbunden. „Ob es [allerdings] zur Umsetzung in eine Handlung kommt, hängt nicht nur von der Stärke der Einstellung, sondern auch von zahlreichen anderen Faktoren (soziale Beziehungen, Machtverhältnisse, Konformitätsdruck, etc.) ab“ (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 1993: S.266f.).
Wie in der Einleitung schon beschrieben entwickelt sich unsere westliche Welt v.a. in der Wirtschaft zu einer immer stärkeren Ellenbogengesellschaft mit wachsenden Individualisierungstendenzen ihrer Mitglieder. Betrachtet man unser derzeitiges Erziehungs- und Ausbildungssystem, so wird deutlich, daß es nicht geeignet ist, Teamfähigkeit zu fördern. In Schule und Ausbildung zählt individuelle Leistung; der Mensch wird von klein auf zu einem Einzelkämpfer und zu Wettbewerbsverhalten erzogen und somit dazu angehalten, fast nur noch in der ICH-Form zu denken und zu handeln. Sog. „Wir-Tugenden“ wie gegenseitige Rücksichtnahme, Kooperations- und Hilfsbereitschaft, so wie sie eine konstruktive Zusammenarbeit erfordern und eine effektive Teamarbeit voraussetzen, werden nicht nur nicht mehr erlernt, sondern auch nicht gefördert, teilweise eher noch gesellschaftlich bestraft (nach Schneider; Knebel, 1995). Doch gerade weil Teamarbeit auf den erwähnten „Wir-Tugenden“ aufbaut und das erhöhte Leistungspotential nur durch deren erfolgreiche Anwendung zum Tragen kommt, ist eine Beeinflussung der Einstellung in diese Richtung unabdingbar. Auch Untersuchungen von Schachter et al. (1951) bestätigen, daß ein starker Zusammenhalt einer Gruppe, so wie er bei Teamarbeit angestrebt wird und notwendig ist, nur dann zu positiven Leistungen führt, wenn die Gruppe eine positive Einstellung zum Leiter der Gruppe und zum Gesamtunternehmen hat. Ansonsten wirkt diese sog. Gruppenkohäsion kontraproduktiv
[...]
[1] Der Begriff „Organisation“ wird in der einschlägigen Fachliteratur als ein soziales Gebilde definiert, „das bestimmte Ziele verfolgt und formale Regelungen aufweist, mit deren Hilfe die unter die Mitgliedschaftsbedingungen fallenden Aktivitäten der Mitglieder auf diese Ziele ausgerichtet werden sollen“ (Kieser; Kubicek, 1992: S.1). Ich werde den Begriff also in der Bedeutung des „institutionellen Organisationsbegriffs“ (Schreyögg (1996: S.9ff.) verwenden, indem ich darunter „ganze Systeme“ mit folgenden Merkmalen verstehe (vgl. ebenda):
einer spezifischen Zweckorientierung
einer geregelten Arbeitsteilung und
beständigen Grenzen
Bei den institutionellen Organisationen lassen sich grundsätzlich zwei Formen entsprechend ihrer Ziele unterscheiden:
a) wirtschaftliche Organisationen/Unternehmen, die oft auch als „Profit-Organisationen“ bezeichnet werden, da sie auf Gewinn ausgerichtet sind. Ihr Angebot richtet sich nach der Nachfrage des Marktes (=Marktsteuerung);
b) soziale Organisationen, die oft als „Nonprofit-Organisationen“ bezeichnet werden, da sie ihre Angebote - im Gegensatz zu den wirtschaftlichen Organisationen - für gemeinnützige Zwecke nach dem sozialen Bedarf richten (=Bedarfssteuerung).
Obwohl wirtschaftliche Betriebe und soziale Organisationen nur teilweise und mit unterschiedlicher Wirkung denselben gesellschaftlichen Veränderungen ausgesetzt sind und teilweise durch unterschiedliche Prozesse beeinflußt werden (vgl. Engelhardt, 1995: S.45ff.), werde ich beide insoweit unter dem Begriff Organisationen zusammenfassen, als sie von denselben gesellschaftlichen Veränderungen betroffen sind. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt jedoch aus persönlichen Gründen (siehe S.4) auf den wirtschaftlichen Organisationen, so daß ich mich v.a. bei den Ausführungen zur Teamarbeit (Punkt 2.) nur auf Unternehmen beziehen werde. Bei den Rahmenbedingungen für die Persönlichkeitsentwicklung mit dem Ziel qualifizierter Teamarbeit (Punkt 5.) werde ich die beiden Bereiche trennen.
[2] Ich werde den Begriff „Gruppe“ und „Team“ in meiner Arbeit synonym verwenden; jedoch unter Punkt 2.1. kurz erläutern, wo Teamarbeit als eine Form von Gruppenarbeit einzuordnen ist.
[3] Die „Human-Relations-Bewegung“, deren Kern die Vorgehensweise, Ergebnisse und Schlußfolgerungen der Hawthorne-Studie ist, hat das Ziel, „durch Pflege der Arbeitsgruppen und der Beziehungen zwischen Management und Arbeitsgruppen das Selbstgefühl und die Bindung der Arbeitenden an die Organisation zu stärken“ (Wahren, 1994: S.128).
[4] Bei der „Hawthorne-Studie“, die zwischen 1924 und 1932 von Mayo, Roethelsberger und Dickson im Hawthorne-Werk der General Electric durchgeführt wurde, versuchte man die Auswirkungen von physischen Arbeitsbedingungen (wie z.B. Beleuchtungsverhältnisse, Farbgebung etc.) auf die Leistung der Beschäftigten zu untersuchen. Dabei stellte sich heraus, daß die Leistung der Beschäftigten mit den physischen Arbeitsbedingungen nur in dem Sinne korrelierte, als sich der Leistungseinsatz der Arbeiter durch das Interesse, das ihnen während des Experiments entgegengebracht wurde, erhöhte, da damit dem Bedürfnis nach Anerkennung im Verlauf der Untersuchungen begegnet und dieses stärker befriedigt wurde als zuvor (vgl. Wahren, 1994: S.127f.). Die Hawthorne-Studie war damit Ausgangspunkt für die Entwicklung weiterer sozialpsychologischer Studien und Theorien und gilt laut Baecker (1993) als „Faszinosum und Angelpunkt der Gestaltung von Unternehmensorganisationen“ (S.180) in Richtung Gruppen- bzw. Teamarbeit.
[5] Ein „Mentor“ ist eine Person, die eine andere Person für einen begrenzten Zeitraum auf der Basis einer persönlichen und verbindlichen Beziehung begleitet, um ihr dabei zu helfen, unter regelmäßiger Abgabe von Rechenschaft in bestimmten Lebensbereichen Aufgaben zu lösen und in Verantwortung zu wachsen (vgl. Stanley; Clinton, 1994).
[6] Das „Konzept der Schlüsselqualifizierung“ nach Richter (1995) beschreibt ein Spektrum fachübergreifender Qualifikationen, sog. „Schlüsselqualifikationen“, mit deren Hilfe im Rahmen (betrieblicher) Weiterbildung der einzelne „durch die Reflexion des eigenen Lernens auf die Werthaltung und das Menschenbild“ (S.26) Lernschritte in seiner Persönlichkeitsentwicklung vornehmen kann, mit dem Ziel, seine individuelle Handlungskompetenz zu erhöhen. Mit Hilfe der indviduellen Handlungskompetenz, die aus dem synergetischen Zusammenwirken der Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz entsteht, ist eine Person in der Lage, über diese Kompetenzen zu verfügen und „situativ angemessen, in sich stimmig, also kompetent zu handeln“ (ebenda: S.33). Der Erwerb der Schlüsselqualifikationen wird als ein lebenslanger Prozeß gesehen, der als Voraussetzung eine Lernbereitschaft erfordert.
Zur näheren Vertiefung: siehe Richter, 1995.
[7] Erläuterungen: siehe Hinführung zum Thema (Punkt 1.).
[8] Empathie ermöglicht es einer Person, sich in eine andere Person einzufühlen und sich in deren Gefühls- und Gedankenwelt hineinzuversetzen und damit um einen Versuch, die Erlebnis- und Verhaltensweisen einer anderen Person zu verstehen (nach: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 1993: S.276). Krappmann (1971) nennt diese auch „Rollenübernahmefähigkeit“ (In: Fliegel et al., 1981: S.98).
[9] Rollendistanz meint die Fähigkeit, mit eigenen und fremden Erwartungen , die an die eigene Person in einer bestimmten Position (= „Rolle“) gerichtet werden, zu reflektieren.
[10] Ambiguitätstoleranz beschreibt die Fähigkeit, widersprüchliche Bedürfnisse und Erwartungen der eigenen Person und die der Interaktionspartner auszuhalten.
[11] Identitätsdarstellung ist nach Fliegel et al. (1981) die Fähigkeit, „die eigene Person mit ihren Bedürfnissen und Interessen einbringen“ (S.99) zu können und dabei „die eigene Identität den anderen mit angemessenen Mitteln vorzutragen“ (Haeberlin; Niklaus, 1978: S.45).
[12] Die Fähigkeit zur Verständigung meint die „Beherrschung eines gemeinsamen Sprach- oder Symbolsystems“ (Fliegel et al., 1981: S.99).
[13] Die Fähigkeiten der „Ich-Identität“ (nach Krappmann, 1971) nennt Fliegel et al. (1981) „als Bestandteile sozialer Kompetenz“ (S.98f.).
[14] Unter der Fähigkeit der „Metakommunikation“ - wörtlich: „Kommunikation über die Kommunikation“- wird nach dem deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge (1993) die Fähigkeit verstanden „über einen abgelaufenen Kommunikationsprozeß und die Wirkungen, die er bei den jeweiligen Gesprächspartnern ausgelöst hat, in einen Austausch zu treten“ (S.645), um auftretende Mißverständnisse aufzudecken, unterschiedliche Sichtweisen verstehbar zu machen und Kommunikationsstile, die ansonsten dauernde Konfliktursachen darstellen würden, zu verändern.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Persönlichkeitsentwicklung für Teamarbeit wichtig?
Kenntnisse über eigene Stärken und Schwächen sind die Voraussetzung, um die eigene Kooperationsfähigkeit und soziale Kompetenz im Team zu verbessern.
Was ist das DISG-Persönlichkeitsmodell?
Es ist ein Modell nach W.M. Marston, das menschliches Verhalten in vier Grundtypen unterteilt: Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft.
Was versteht man unter „sozialer Kompetenz“?
Die Fähigkeit, durch offene Kommunikation und konstruktiven Umgang mit Konflikten effektiv mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten.
Wie hängen Persönlichkeitstypen und Teamrollen zusammen?
Unterschiedliche Typen (z.B. DISG) nehmen im Team verschiedene Rollen ein; eine heterogene Zusammensetzung führt oft zu besseren Ergebnissen.
Was war die Human-Relation-Bewegung?
Eine Forschungsrichtung, die erkannte, dass soziale Faktoren und das Wohlbefinden der Mitarbeiter die Produktivität stärker beeinflussen als rein physische Arbeitsbedingungen.
- Quote paper
- Claudia Sack (Author), 1999, Die Persönlichkeitsentwicklung als Voraussetzung für qualifizierte Teamarbeit in Organisationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269078