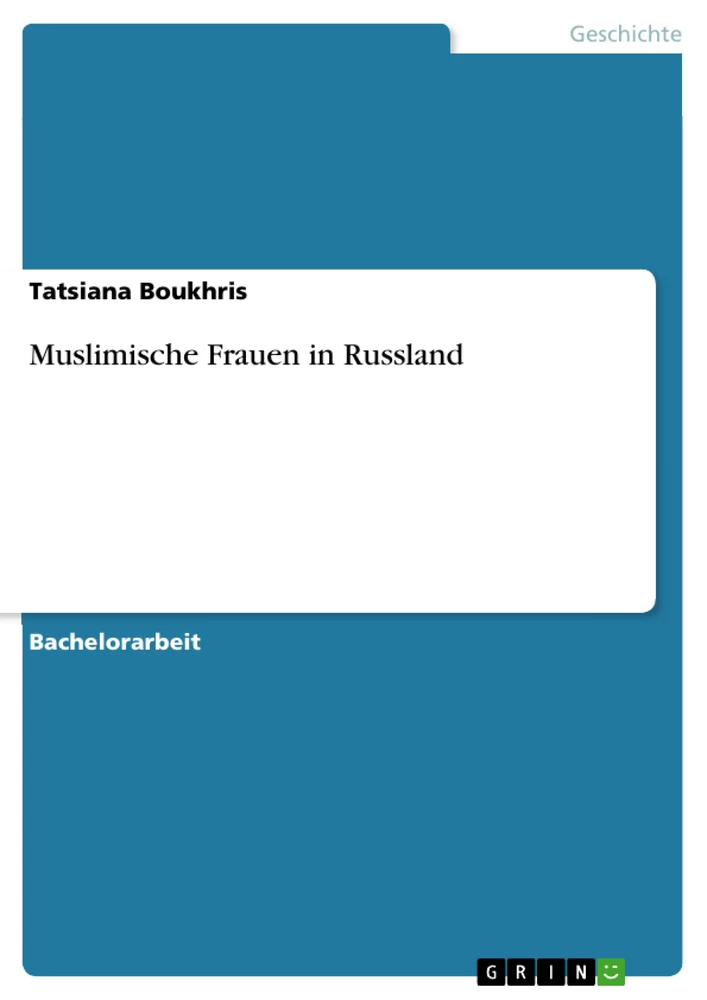Worüber denken wir nach, wenn wir einer Frau auf der Straße begegnen, die den Hijab trägt? Über die fehlende Gleichberechtigung der Geschlechter, Diskriminierung, Unterdrückung der Persönlichkeit, religiösen Extremismus oder Terrorakte in der Metro?
Wir wissen so wenig vom Leben der modernen muslimischen Frauen, dass wir oft das Bild von der unterdrückten und diskriminierten Frau als Forderung des Korans wahrnehmen und die Schuld daran der Religion geben. Das führt dazu,
dass die muslimische Frau mit Mitleid und Bedauern betrachtet wird. Immer wieder weisen die islamischen Gelehrten darauf hin, dass die Unterdrückung der
Frauen keine Forderung des Korans ist. Ob als Tochter, als Ehefrau oder als Mutter: die Frau soll gut behandelt und nicht benachteiligt werden. Dennoch, die Lage der Frau in vielen muslimischen Gesellschaften ist problematisch. Und zwar nicht nur im Lichte der westlichen Werte, sondern auch nach Mäßstäben des Islam
selbst.
Wie der Islam das Bild der Frau in der Wirklichkeit darstellt, welche Rechte der Frau in der Familie und in der Gesellschaft zugeschrieben werden, und was der Koran über Verschleierung, Gleichberechtigung und Gewalt gegen Frauen sagt, wird im ersten Teil der Arbeit dargestellt. Neben dem Koran stellen die Hadithe eine weitere wichtige Quelle für die Beurteilung der Stellung der Frau
im Islam dar. Es folgt nach der kurzen Zusammenfassung und der Darstellung der Rolle, welche die muslimische Frau im Islam spielt, der zweite Teil der Arbeit, der
den Übergang zum dritten Kapitel bildet. In diesem Teil wird die Auslebung des Islam in Russland in der Zeit der Sowjetunion und in der postsowjetischen Zeit
dargestellt. Es soll gezeigt werden, warum der Islam nicht durch den Kommunismus ersetzt wurde, nicht aus dem alltäglichen Leben unter der antireligiösen Politik verschwand, sondern viele Jahre Atheismus überlebte, und
nach dem Zerfall der Sowjetunion sein Wiederaufleben feiern konnte. Der dritte Teil beschäftigt sich mit der aktuellen Situation von modernen muslimischen Frauen in Russland. An Beispielen der muslimischen Frauen aus Usbekistan und aus Kasanj soll untersucht werden, welche religiösen und sozialen Ansichten die Stellung der Frauen in diesen Gesellschaften bestimmen. Auch das meist diskutierte Thema – Kopftuch in Russland – soll in Betracht gezogen werden.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Bild der Frau im Islam
- 2.1 Die Stellung der Frau in der vorislamischen Zeit
- 2.2 Die Stellung der Frau im Koran
- 2.3 Die Stellung der Frau in der Gesellschaft
- 2.3.1 Die Verschleierung der Frauen im Islam
- 2.3.2 Ausbildung und Ausübung eines Berufes
- 2.4 Die Stellung der Frau in der Familie
- 2.4.1 Die Eheschließung und die Pflichten
- 2.4.2 Polygamie
- 2.4.3 Ehescheidung
- 3. Kurze Zusammenfassung
- 4. Islam in Russland
- 4.1 Die Muslime zur Zeit der Sowjetunion
- 4.1.1 „Offizieller“ und „Schattenislam“
- 4.1.2 Islam in der sowjetischen Stadt Jaroslawl
- 4.2 „Islamische Renaissance“
- 4.2.1 Islam im postsowjetischen Tatarstan
- 4.3 Probleme der Gegenwart
- 4.1 Die Muslime zur Zeit der Sowjetunion
- 5. Muslimische Frauen in Russland
- 5.1 Muslimische Frauen in Usbekistan
- 5.1.1 Gleichstellung der usbekischen Frau
- 5.2 Muslimische Frauen in Kasan
- 5.3 Die Kopftuchdiskussion in Russland
- 5.3.1 Mit Hijab in einer Metropole
- 5.3.2 Konvertierte Frauen Moskaus
- 5.1 Muslimische Frauen in Usbekistan
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Situation muslimischer Frauen in Russland. Ziel ist es, ein differenziertes Bild der Realität zu zeichnen und gängige Vorurteile zu hinterfragen. Dabei wird der Einfluss des Islam, sowohl koranischer Lehren als auch gesellschaftlicher Praktiken, auf die Lebenswirklichkeit muslimischer Frauen beleuchtet. Die Rolle des Islam in Russland während und nach der Sowjetzeit bildet einen weiteren Schwerpunkt.
- Das Bild der Frau im Islam und dessen Widerspiegelung in der Realität
- Der Islam in Russland: Entwicklung während und nach der Sowjetzeit
- Die Situation muslimischer Frauen in verschiedenen Regionen Russlands
- Die Kopftuchdebatte als Beispiel für die komplexen Herausforderungen
- Der Vergleich zwischen koranischen Lehren und der tatsächlichen Lebenswirklichkeit muslimischer Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung wirft die Frage auf, welche Assoziationen der Hijab im Westen hervorruft und kritisiert die weit verbreitete, vereinfachte Sicht auf die Rolle der Frau im Islam. Sie kündigt den Aufbau der Arbeit an: Zuerst wird das Bild der Frau im Islam anhand des Korans und der Hadithe untersucht. Im zweiten Teil wird der Islam in Russland während und nach der Sowjetzeit beleuchtet. Der dritte Teil befasst sich mit der Situation muslimischer Frauen in Russland an Beispielen aus Usbekistan und Kasan, sowie der Kopftuchdebatte.
2. Das Bild der Frau im Islam: Dieses Kapitel behandelt die Stellung der Frau im Islam, beginnend mit einem Blick auf die vorislamische Zeit. Es analysiert die Rolle der Frau im Koran und in der Gesellschaft, einschließlich der Themen Verschleierung, Berufstätigkeit und die Stellung in der Familie (Ehe, Polygamie, Scheidung). Es konfrontiert westliche Stereotype mit den tatsächlichen Lehren des Islams, wobei Beispiele aus verschiedenen islamischen Gesellschaften verwendet werden um die Problematik der unterschiedlichen Auslegungen und deren Auswirkungen auf Frauen zu verdeutlichen. Die Darstellung der Geschichte von Malala Yousafzai dient als eindrückliches Beispiel für die Herausforderungen, denen sich Frauen in einigen islamischen Gesellschaften gegenübersehen.
4. Islam in Russland: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Islam in Russland während der Sowjetzeit und im postsowjetischen Raum. Es beleuchtet die Koexistenz von „offiziellem“ und „Schattenislam“ unter der atheistischen Politik, und analysiert die Gründe für das Überleben und das Wiederaufleben des Islams nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Es wird der Fokus auf den Wandel des Islam nach dem Ende der Sowjetunion gelegt und auf Herausforderungen in der Gegenwart eingegangen.
5. Muslimische Frauen in Russland: Dieses Kapitel untersucht die aktuelle Situation muslimischer Frauen in Russland anhand von Fallbeispielen aus Usbekistan und Kasan. Es analysiert religiöse und soziale Faktoren, die die Stellung der Frauen in diesen Gesellschaften beeinflussen und widmet sich der kontroversen Kopftuchdebatte in Russland, einschließlich der Erfahrungen von Frauen in Metropolen und konvertierten Frauen in Moskau.
Schlüsselwörter
Muslimische Frauen, Russland, Islam, Koran, Hadithe, Sowjetunion, Postsowjetraum, Kopftuch, Gleichberechtigung, Verschleierung, Familie, Gesellschaft, Usbekistan, Kasan, Religiöse Identität, Soziale Integration, Vorurteile, Stereotype.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Das Bild der Frau im Islam und die Situation muslimischer Frauen in Russland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Situation muslimischer Frauen in Russland. Sie analysiert das Bild der Frau im Islam, sowohl aus koranischer Sicht als auch in gesellschaftlicher Praxis, und beleuchtet den Einfluss dieser Aspekte auf das Leben muslimischer Frauen in Russland. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung des Islam in Russland während und nach der Sowjetzeit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: das Bild der Frau im Islam (vorislamische Zeit, Koran, gesellschaftliche und familiäre Stellung, Verschleierung, Berufstätigkeit, Ehe, Polygamie, Scheidung), der Islam in Russland während und nach der Sowjetzeit („offizieller“ und „Schattenislam“, „Islamische Renaissance“), die Situation muslimischer Frauen in verschiedenen Regionen Russlands (Usbekistan, Kasan, Moskau), die Kopftuchdebatte in Russland und ein Vergleich zwischen koranischen Lehren und der tatsächlichen Lebenswirklichkeit muslimischer Frauen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die das Thema einführt und die Forschungsfrage formuliert; ein Kapitel zum Bild der Frau im Islam; ein Kapitel zum Islam in Russland während und nach der Sowjetzeit; ein Kapitel zur Situation muslimischer Frauen in Russland mit Fallbeispielen aus verschiedenen Regionen; und eine kurze Zusammenfassung. Jedes Kapitel enthält eine detaillierte Beschreibung der jeweiligen Thematik.
Welche Regionen Russlands werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Situation muslimischer Frauen in verschiedenen Regionen Russlands, insbesondere in Usbekistan und Kasan. Zusätzlich werden die Erfahrungen von Frauen in Moskau im Kontext der Kopftuchdebatte analysiert.
Wie wird die Kopftuchdebatte in Russland behandelt?
Die Kopftuchdebatte in Russland wird als Beispiel für die komplexen Herausforderungen betrachtet, denen muslimische Frauen in Russland gegenüberstehen. Die Arbeit beleuchtet die Erfahrungen von Frauen in Metropolen und konvertierten Frauen in Moskau.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den Koran und Hadithe sowie auf weitere Quellen (konkret benannt wird die Geschichte von Malala Yousafzai als eindrückliches Beispiel). Die genauen Quellenangaben sind im vollständigen Text aufgeführt (hier nicht im Detail wiedergegeben).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein differenziertes Bild der Realität muslimischer Frauen in Russland zu zeichnen und gängige Vorurteile zu hinterfragen. Sie beleuchtet den Einfluss des Islam auf die Lebenswirklichkeit muslimischer Frauen und analysiert die Entwicklung des Islam in Russland im historischen Kontext.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Muslimische Frauen, Russland, Islam, Koran, Hadithe, Sowjetunion, Postsowjetraum, Kopftuch, Gleichberechtigung, Verschleierung, Familie, Gesellschaft, Usbekistan, Kasan, Religiöse Identität, Soziale Integration, Vorurteile, Stereotype.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für alle gedacht, die sich für die Situation muslimischer Frauen in Russland und das Bild der Frau im Islam interessieren. Sie richtet sich an ein akademisches Publikum, kann aber auch für ein breiteres Publikum von Interesse sein.
- Citar trabajo
- Tatsiana Boukhris (Autor), 2013, Muslimische Frauen in Russland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269102