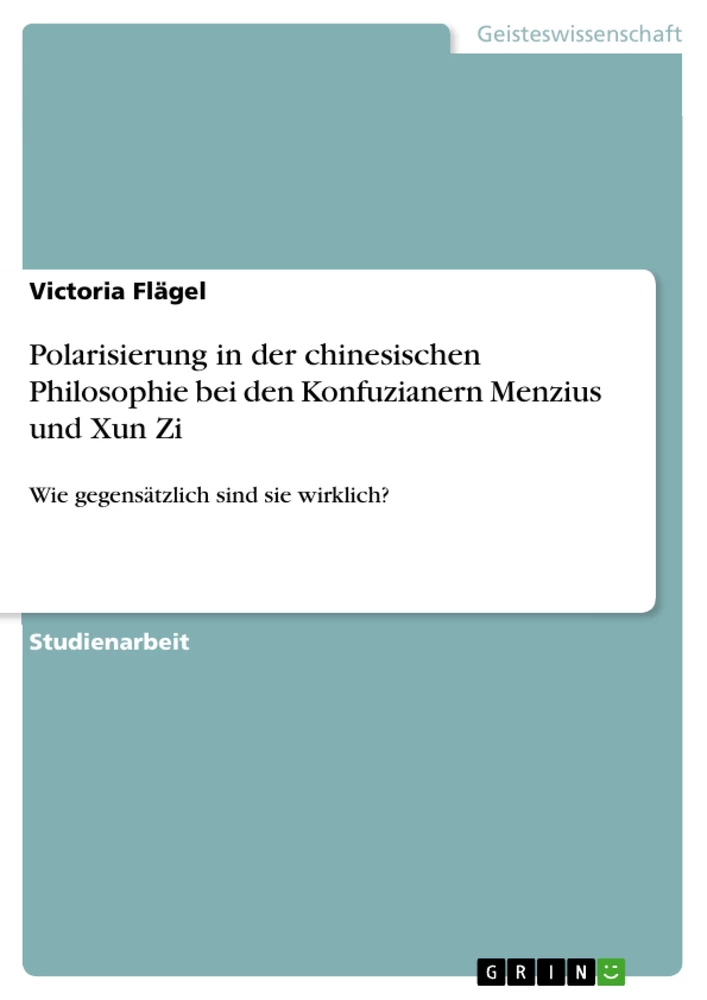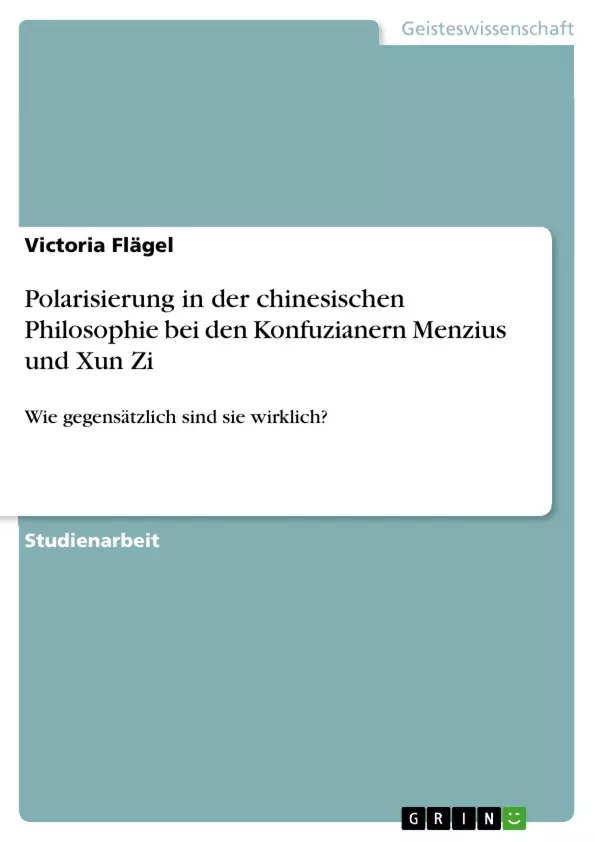Die chinesischen Denker der klassischen Zeit diskutierten ausgiebig darüber, ob sich Moral und Ethik in einer natürlichen menschlichen Anlage und Neigung zum Guten hin begründen lassen. Typisch konfuzianistisch ist die optimistische und idealisierende Bejahung dieser These. [...]
Begonnen wird mit einer Kontextualisierung. Anfangs wird eine historische Einordnung der Zeit vorgenommen, gefolgt von einer kurzen Einführung in das damalige chinesische Denken allgemein, in ihr Rechtfertigungsschema, die bevorzugten Themengebiete der chinesischen Philosophen und ihre überlieferten Werke. Der erste Philosoph, der vorgestellt wird, ist Menzius. Nach einigen kurzen Worten zu seinem Leben wird seine Staatsphilosophie vorgestellt. Daran anschließend wird seine Anthropologie, also seine Lehre vom Menschen vorgestellt. Es wird Menzius´ Auffassung von der Natur (xing) des Menschen dargelegt und Menzius´ Begründungen dafür dargelegt. Folgend wird es um Menzius´ Vorstellungen bezüglich der Freiheit bzw. Unfreiheit
des Menschen gehen. Im abschließenden Teil über diesen Philosophen wird sein Wirken und sein Einfluss auf die chinesische Philosophie dargelegt.
Nachdem in einigen Worten Xun Zis Lebensumstände erläutert worden sind, wird seine Staatsphilosophie näher betrachtet. Es geht um Xun Zis Wertschätzung der Gesetze und um seine Ablehnung von unnötiger Nostalgie. Er vertrat das gleiche Rechtfertigungsdenken wie Menzius, was allerdings auch für die klassische chinesische Philosophie üblich war. Daran anschließend wird auf Xun
Zis Anthropologie eingegangen. Dabei wird Xun Zis Begriff der Natur (xing) geklärt und die Frage gestellt, wie es trotz des pessimistischen Menschenbildes Heilige und Gutheit in der Welt geben könne. Anschließend wird auf Xun Zis Definition von „Himmel“ und „Schicksal“ eingegangen und aus seiner Ethik Folgen bezüglich der Forderungen für das menschliche Handeln abgeleitet. Anschließend wird von Xun Zis Sprachphilosophie und seiner Forderung nach genauen Definitionen benutzter Begriffe die Rede sein, worauf die Einschätzung seines Wirkens und seines Einflusses auf die chinesische Philosophie folgt.
Abschließend wird ein Fazit zu ziehen sein und die Unterschiede oder aber auch eventuelle Gemeinsamkeiten der beiden behandelten Philosophen werden erläutert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Kontextualisierung
3. Menzius
3.1 Leben
3.2 Die Staatsphilosophie
3.3 Die Anthropologie
3.4 Exkurs in die theoretische Philosophie: Freiheit und Determination
3.5 Wirken
4. Xun Zi
4.1 Leben
4.2 Die Staatsphilosophie
4.3 Die Anthropologie
4.4 Exkurs in die theoretische Philosophie: Sprachphilosophie
4.5 Wirken
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Streitpunkt zwischen Menzius und Xun Zi?
Der Kern der Debatte liegt in der menschlichen Natur (xing): Menzius glaubt an eine angeborene Neigung zum Guten, während Xun Zi ein eher pessimistisches Menschenbild vertritt.
Wie begründet Menzius seine optimistische Anthropologie?
Menzius sieht Moral und Ethik als natürliche Anlagen des Menschen an, die durch Kultivierung zur Entfaltung gebracht werden können.
Wie erklärt Xun Zi die Existenz von Gutheit trotz eines schlechten Menschenbildes?
Xun Zi argumentiert, dass Gutheit durch Gesetze, Riten und Erziehung künstlich erzeugt werden muss, um die rohe Natur des Menschen zu zähmen.
Welche Rolle spielt die Staatsphilosophie bei diesen Denkern?
Beide Philosophen leiten aus ihrem Menschenbild unterschiedliche Regierungsstile ab – von der moralischen Vorbildfunktion des Herrschers bis zur Bedeutung strenger Gesetze.
Was versteht Xun Zi unter "Sprachphilosophie"?
Xun Zi forderte die "Richtigstellung der Namen", also präzise Definitionen von Begriffen, um soziale Ordnung und klare Kommunikation zu gewährleisten.
- Quote paper
- Victoria Flägel (Author), 2012, Polarisierung in der chinesischen Philosophie bei den Konfuzianern Menzius und Xun Zi, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269266