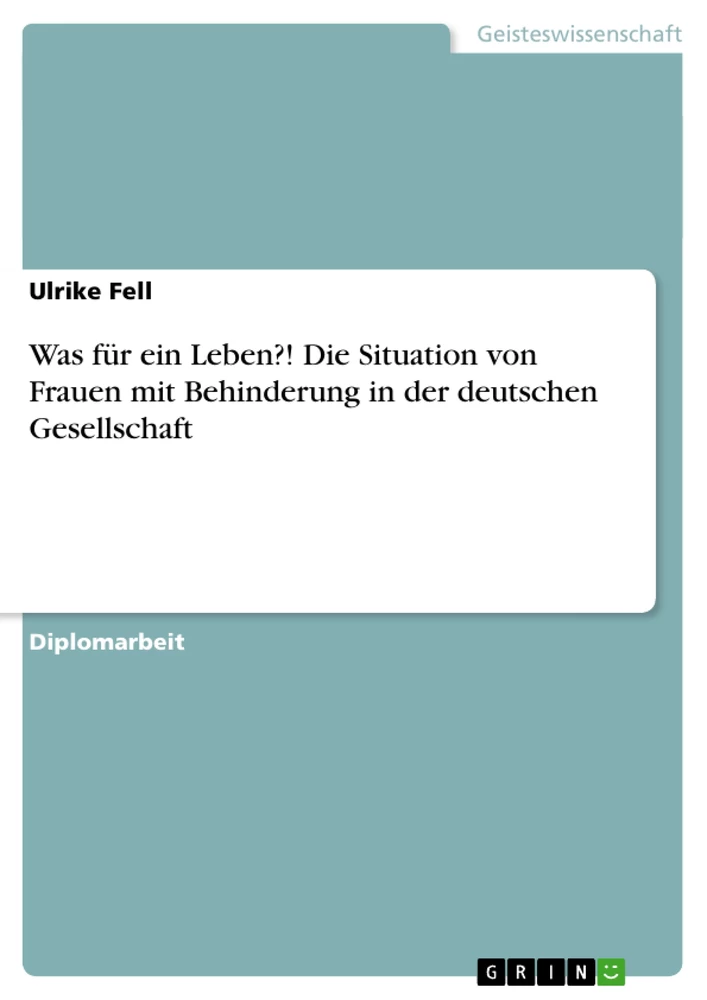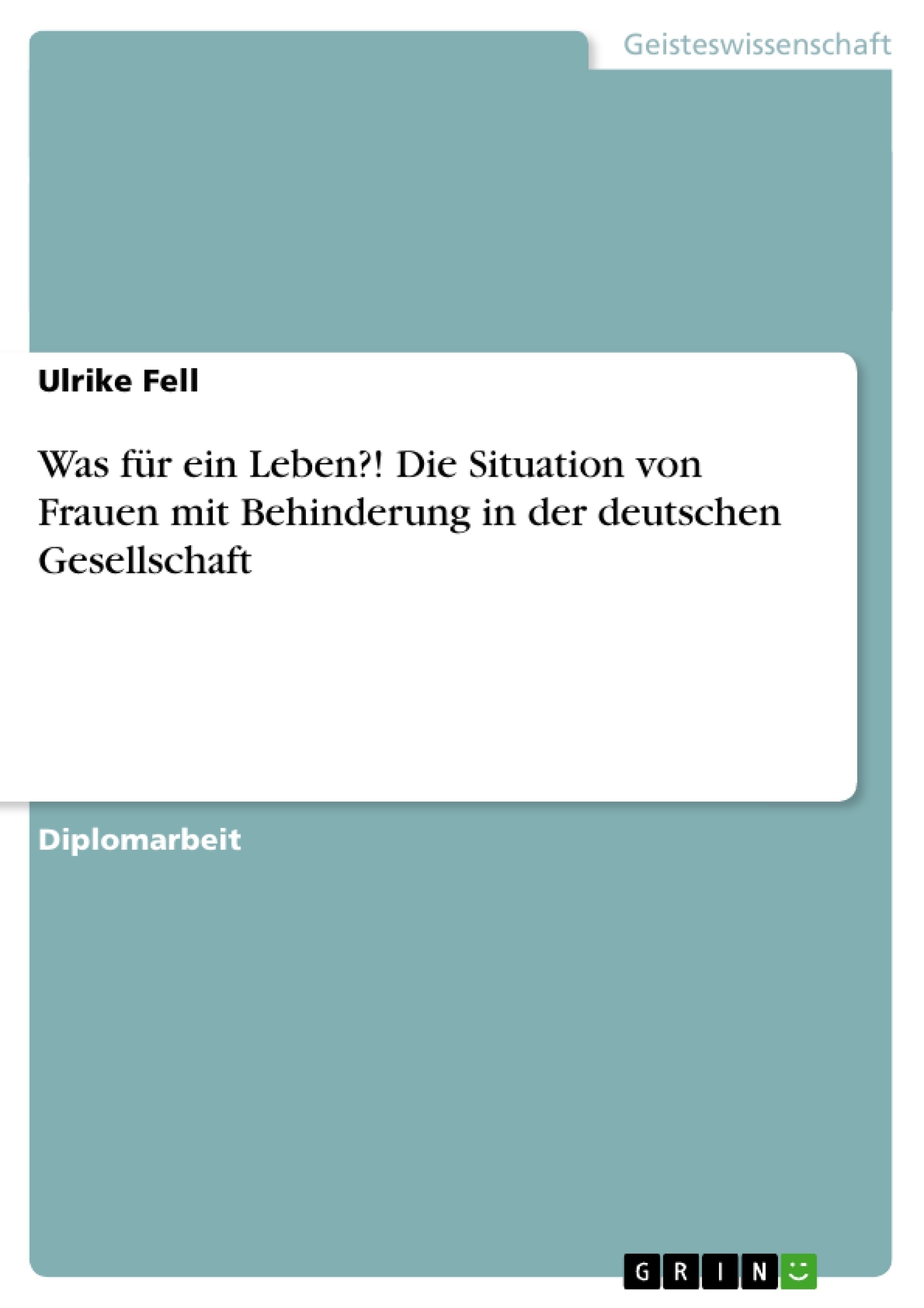Frauen mit Behinderung stellen in der deutschen Gesellschaft ein wenig beachtetes Problemfeld dar, was sich durch nachstehend erläuterte Gegebenheiten begründen lässt.
Frauen mit Behinderung werden in Fachbüchern, theoretischen Abhandlungen und auch in der Behindertenpädagogik geschlechtsneutral bzw. maskulin betrachtet: „Der Behinderte“.
Schon bei behinderten oder von Behinderung bedrohten Mädchen finden die geschlechtsspezifische Entwicklung und deren Besonderheiten wenig Beachtung 1 .
Frauen mit Behinderung wird ihr Frau-Sein, ihre Sexualität und ihre Weiblichkeit abgesprochen. Die Behinderung steht im Vordergrund und sie werden oft als Neutren angesehen 2 , die allenfalls als gute Freundinnen, aber nicht als (potentielle) Partnerinnen anerkannt werden. Diese Behandlung, die Frauen mit Behinderung von Männern mit und ohne Behinderung und Frauen ohne Behinderung erfahren, stellt für viele der betroffenen Frauen eine prägende und verletzende Erfahrung dar. Eine Frau mit Behinderung berichtet:
‚ „Studienanfang 1. Semester. Ich hab´ eine Arbeitsgruppe, da ist ein nichtbehinderter Mann drin, der schäkert immer so´n bisschen mit mir rum, und dann lachen wir auch mal zusammen und finden uns ganz nett. Mehr aber auch nicht. Und dann sagt er einfach mal, als wir Arbeitsgruppe haben: mit mir als Behinderter könnte er ja rumschäkern; da würde seine Freundin nicht eifersüchtig werden. Da hätte sie keine Angst, es könnte was passieren...“ ’
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenwärtige Situation von Frauen mit Behinderung
- Sozialisation von Mädchen mit Behinderung
- Frauen mit Behinderung und Wohnen
- Ein Leben mit Hilfebedarf
- Wohnen im Elternhaus
- Wohnen in stationären Einrichtungen
- Selbständiges Wohnen
- Frauen mit Behinderung und ihre Freizeitsituation
- Freunde
- Frauen mit Behinderung und sexuelle Partnerschaft
- Partnerin zweiter Wahl
- Behinderte Sexualität, ein gesellschaftliches Tabu
- (Un-) Möglichkeiten für Frauen mit Behinderung Sexualität zu leben
- „Dann waren sie sauer auf mich, dass ich das Kind haben wollte...“
- Sterilisation als Verhütung
- § 218
- Exkurs: Sexuelle Gewalt: die zerstörendste Gewalt für Frauen mit Behinderung
- Statistische Zahlen
- Von helfenden Händen missbraucht
- Folgen für die Frau
- Empirische Umfrage zur Situation von zehn ausgewählten Frauen mit Behinderung im Kreis Heinsberg in NRW im November 2003
- Vergleich mit der Literatur
- Auf dem Weg zur Selbstbestimmung
- Persönliche Assistenz statt Hilfe
- Persönliche Assistenz: Das Arbeitgebermodell
- Die Hürden der Finanzierung
- Weibliche Assistenz
- Mütter mit Behinderung
- Massive Barrieren bei der Realisierung des Kinderwunschs
- Möglichkeiten der Verbesserung
- Bekämpfung von (sexueller) Gewalt gegen Frauen mit Behinderung
- Konkrete Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen
- Selbstbewusst behaupten und verteidigen mit WenDo
- Finanzierung von Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskursen für Frauen mit Behinderung
- Konkrete Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen
- Persönliche Assistenz statt Hilfe
- Selbstbestimmung leben durch Peer Counseling
- Ursprung des Peer Counseling
- Peer Counseling und C. R. Rogers
- Die Methode des Peer Counseling
- Die Anwesenheit Dritter in der Beratungssituation
- Frauenspezifisches Peer Counseling durch Weiterbildung
- Gegenwärtige Beratungssituation
- Weiterbildung zur Peer Counselorin
- Gemeinsam sind wir stärker: Parteilichkeit und Identifikation
- Transfer ins Peer Counseling
- Peer Counseling und die Soziale Arbeit
- Fazit:,,Durch Deutschland muss ein Ruck gehen!“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Situation von Frauen mit Behinderung in der deutschen Gesellschaft und untersucht die besonderen Herausforderungen, denen sie im Alltag begegnen. Der Fokus liegt dabei auf den Bedürfnissen und Rechten von Frauen mit Behinderung und den strukturellen Barrieren, die ihre Selbstbestimmung einschränken.
- Die spezifischen Herausforderungen, denen Frauen mit Behinderung in der deutschen Gesellschaft gegenüberstehen
- Die Bedeutung von Selbstbestimmung und Teilhabe für Frauen mit Behinderung
- Die Rolle von Hilfestrukturen und Unterstützungsmöglichkeiten für Frauen mit Behinderung
- Die Notwendigkeit von Veränderungen in den Bereichen Wohnen, Freizeit, Sexualität und Elternschaft für Frauen mit Behinderung
- Die Bedeutung von Frauennetzwerken und Peer Counseling für die Stärkung von Frauen mit Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Problematik von Frauen mit Behinderung in der deutschen Gesellschaft und hebt die Notwendigkeit einer geschlechtsspezifischen Betrachtung hervor. Kapitel 2 analysiert die gegenwärtige Situation von Frauen mit Behinderung in verschiedenen Lebensbereichen wie Wohnen, Freizeit, Sexualität und Elternschaft. Es werden die besonderen Herausforderungen und Diskriminierungen, denen sie begegnen, beleuchtet. Kapitel 3 präsentiert eine empirische Umfrage, die die Situation von Frauen mit Behinderung im Kreis Heinsberg in NRW genauer untersucht. Kapitel 4 beleuchtet verschiedene Ansätze zur Förderung der Selbstbestimmung von Frauen mit Behinderung, wie z.B. die Einführung von persönlicher Assistenz. In diesem Kapitel werden auch die Herausforderungen bei der Realisierung des Kinderwunsches von Müttern mit Behinderung und die Notwendigkeit der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen mit Behinderung thematisiert. Kapitel 5 beschäftigt sich mit Peer Counseling und dessen Potenzial, die Selbstbestimmung von Frauen mit Behinderung zu stärken.
Schlüsselwörter
Frauen mit Behinderung, Selbstbestimmung, Teilhabe, Diskriminierung, strukturelle Barrieren, Wohnen, Freizeit, Sexualität, Elternschaft, Hilfestrukturen, Unterstützungsmöglichkeiten, Frauennetzwerke, Peer Counseling, Gewalt gegen Frauen mit Behinderung.
- Quote paper
- Ulrike Fell (Author), 2004, Was für ein Leben?! Die Situation von Frauen mit Behinderung in der deutschen Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26927