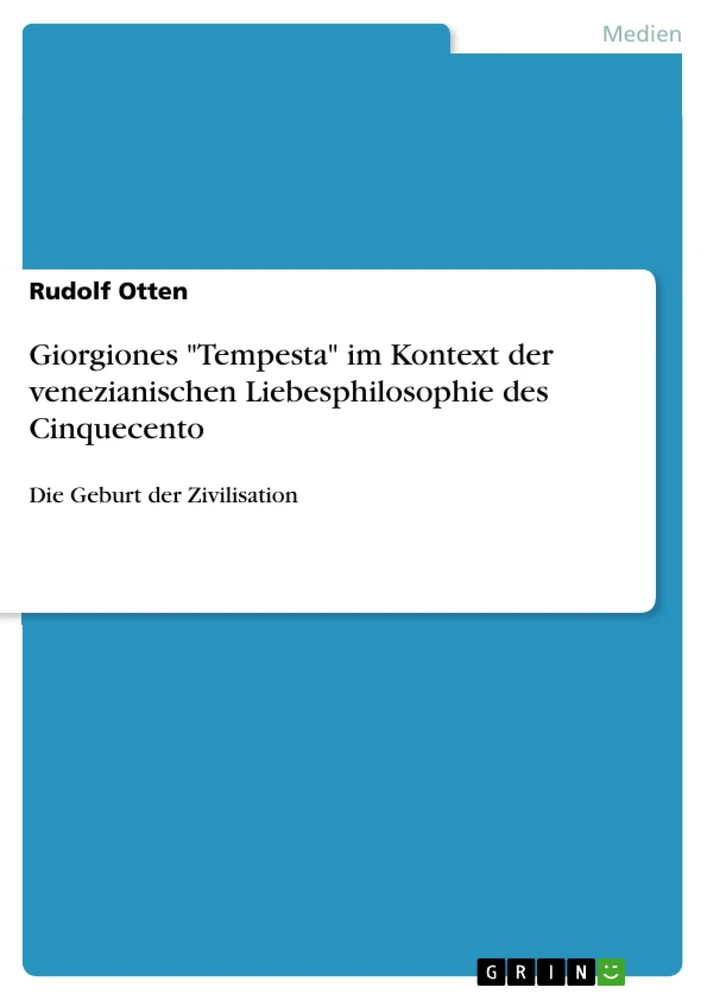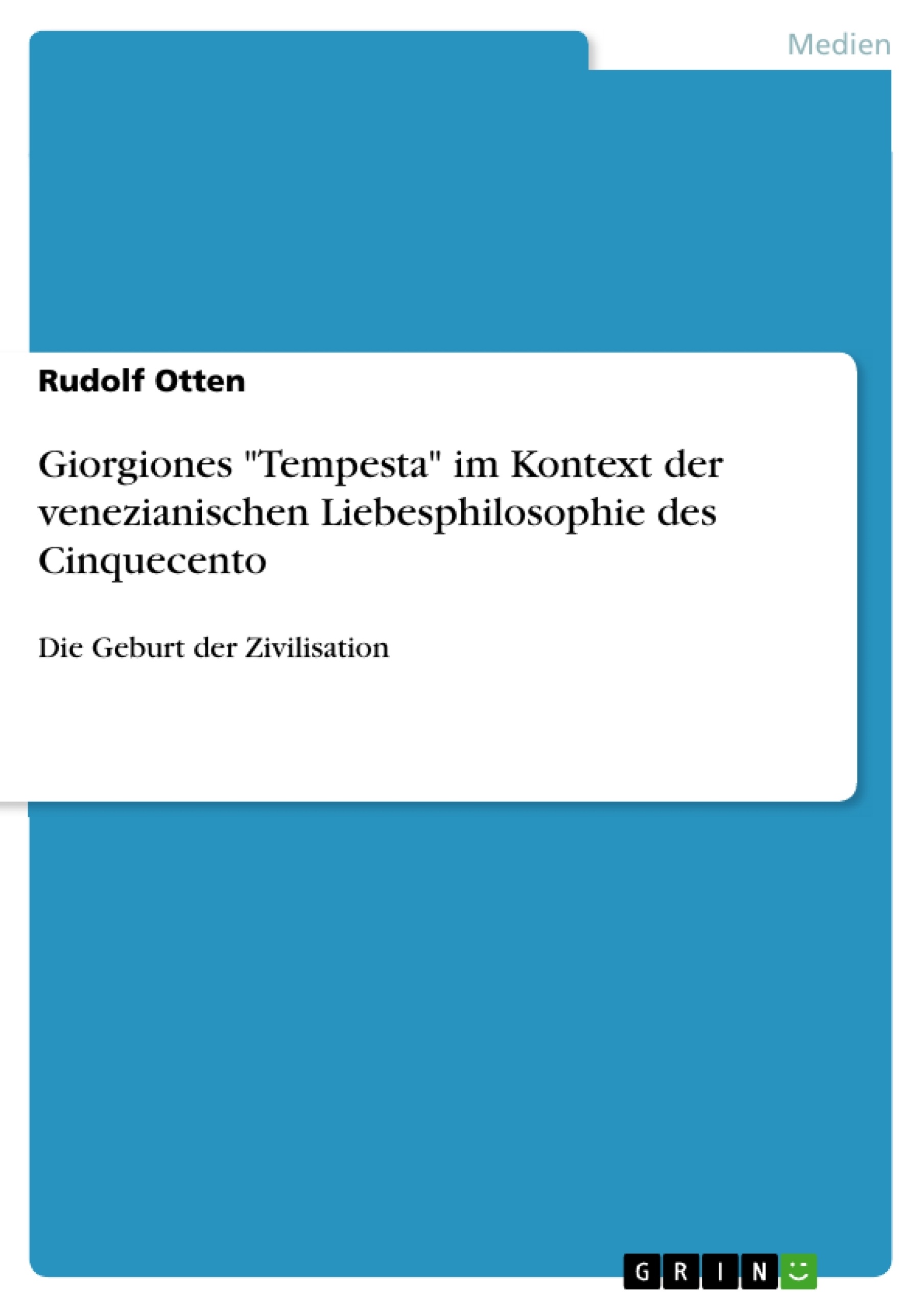Die Tempesta (Galleria dell’ Accademia, Venedig) des venezianischen Malers Giorgione gehört seit jeher zu den rätselhaftesten Gemälden der Kunstgeschichte. Über 60 Interpretationsversuche sind in den letzten 150 Jahren zu der kleinen Tafel vorgelegt worden; ein erheblicher Anteil dieser Interpretationsansätze sucht dabei nach einer literarischen Vorlage für das Bildthema der Tempesta. Ausgehend von der „Ruhenden Venus“ (Gemäldegalerie Dresden) wird in dem Aufsatz die Tempesta einer vergleichenden und konsequent narrativen Untersuchungsmethode unterworfen. Dabei zeigt sich zum einen, dass wesentlichen kompositorischen Elementen, vor allem die Verwendung von Bildachsen - sowohl bei der Dresdener Venus, als auch in der Tempesta - eine wichtige interpretatorische Bedeutung zukommt, zum anderen, dass beide Bilder nicht nur eine statische, sondern auch eine ausgreifende narrative Dimension haben, die weit über die unmittelbar sichtbaren Bildgegenstände hinausgeht.
Nach einer kurzen Darstellung der kunsthistorischen Forschungsgeschichte, die das Thema „Liebe“ in der Tempesta behandelt hat – wobei den Beobachtungen von
Bernhard Aikema (Verona) eine besondere Bedeutung zugemessen wird -, wird die
narrative Methode auf das Bild selbst angewandt. Nach dem Aufzeigen einer Reihe von „ungestellten Fragen“ der Kunstgeschichte an das Bild wird eine zunächst werkimmanente Interpretation vorgelegt, die verdeutlicht, dass das Schlüsselthema der Tempesta in den Bereich der zeitgenössischen Liebesphilosophie gehört.
Besonderes Augenmerk gilt dabei der Figur des stehenden Mannes und seiner
achsialen Beziehung zum Blitz, sowie der Figur der Frau im Kontext der dargestellten Stadt, bei der es sich um Padua handeln dürfte. Neben der statischen Ebene arbeitet der Autor eine narrative Bildebene heraus, die eine sublime aber doch eindeutig erotische Deutung des Bildes überaus wahrscheinlich machen. Im Folgenden wird der historische Kontext der Liebesphilosophie in Oberitalien des Cinquecento, ausgehend von Petrarca über Diacceto, Leone Ebreo und Pietro Bembo skizziert. Hierbei zeigt sich eine thematische Nähe der Tempesta zu einem Abschnitt von Bembos „Gli Asolani“ (Erstausgabe 1505). Der Autor geht dabei
jedoch nicht davon aus, dass dieser Abschnitt gleichsam eine literarische Vorlage für das Werk des Meisters aus Castelfranco ist, sondern dass Giorgione sein Werk als autonomen Debattenbeitrag in der Liebes- und Zivilisationsphilosophie des Cinquecento verstanden haben wollte.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Von Liebe und Methode
- Unerhörte Fragen
- Von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen
- Die Geburt der Zivilisation
- Gewitter oder „Liebessturm\"?
- Von der Natur zur Zivilisation
- Aspekte der Liebestheorie im Venedig des 16. Jahrhunderts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz befasst sich mit einer neuen Interpretation von Giorgiones „Tempesta“ und stellt diese in den Kontext der venezianischen Liebesphilosophie des 16. Jahrhunderts. Der Autor, der als Altphilologe und Historiker an die Diskussion herangeht, untersucht das Bild vor dem Hintergrund des Zueinanders von Mann und Frau und stellt dabei die Frage nach der „Geburt der Zivilisation“ aus der Liebe.
- Die Bedeutung der Liebe in der venezianischen Kunst und Philosophie
- Die Darstellung von Mann und Frau in Giorgiones „Tempesta“
- Die Rolle des Gewitters als Symbol für den „Liebessturm“
- Der Übergang von der Natur zur Zivilisation durch die Liebe
- Die Interpretation der „Tempesta“ im Kontext der Geschlechterrollen
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Der Autor stellt den Kontext seines Aufsatzes dar und hebt die Besonderheit seiner Interpretation hervor, die außerhalb des akademischen Fachdiskurses entstanden ist.
- Von Liebe und Methode: Der Autor führt die Analyse von Giorgiones „Tempesta“ ein und beleuchtet die Bedeutung der Liebe als zentrales Thema des Bildes.
- Unerhörte Fragen: Der Autor wirft Fragen auf, die bisher in der Forschung zum Bild nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
- Von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: Der Autor analysiert das Bild im Kontext der Renaissance und der damit verbundenen zeitgenössischen Philosophie und Kunsttheorie.
- Die Geburt der Zivilisation: Der Autor entwickelt seine Interpretation der „Tempesta“ als Darstellung des Übergangs von der Natur zur Zivilisation durch die Liebe.
- Gewitter oder „Liebessturm\"?: Der Autor untersucht die Bedeutung des Gewitters im Bild und interpretiert es als Metapher für den „Liebessturm“.
- Von der Natur zur Zivilisation: Der Autor erläutert seine These, dass Giorgiones „Tempesta“ die Entstehung der Zivilisation aus der Liebe zwischen Mann und Frau darstellt.
- Aspekte der Liebestheorie im Venedig des 16. Jahrhunderts: Der Autor beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Liebe in der venezianischen Philosophie des 16. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Aufsatzes sind: Giorgiones „Tempesta“, venezianische Liebesphilosophie, Cinquecento, „Geburt der Zivilisation“, Liebe, Gewitter, Geschlechterrollen, Kunstgeschichte, Interpretation, Methode, Hermeneutik.
Häufig gestellte Fragen
Was macht Giorgiones "Tempesta" so rätselhaft?
Es gibt über 60 verschiedene Interpretationsversuche, da das Bild keine eindeutige literarische Vorlage zu haben scheint und viele Symbole (Blitz, nackte Frau, Soldat) Fragen aufwerfen.
Was ist die zentrale These dieser neuen Interpretation?
Die Arbeit sieht in der "Tempesta" eine Darstellung der "Geburt der Zivilisation" aus der Liebe zwischen Mann und Frau im Kontext zeitgenössischer Philosophie.
Welche Rolle spielt das Gewitter im Bild?
Das Gewitter wird als Metapher für einen "Liebessturm" interpretiert, der eine transformative Wirkung auf die dargestellten Personen hat.
Welche Philosophen beeinflussten die Liebestheorie der Zeit?
Wichtige Einflüsse kamen von Petrarca, Pietro Bembo ("Gli Asolani") und Leone Ebreo.
Handelt es sich bei der dargestellten Stadt um einen realen Ort?
In der Forschung wird oft vermutet, dass die im Hintergrund dargestellte Stadt Padua sein könnte.
- Quote paper
- Rudolf Otten (Author), 2014, Giorgiones "Tempesta" im Kontext der venezianischen Liebesphilosophie des Cinquecento, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269281