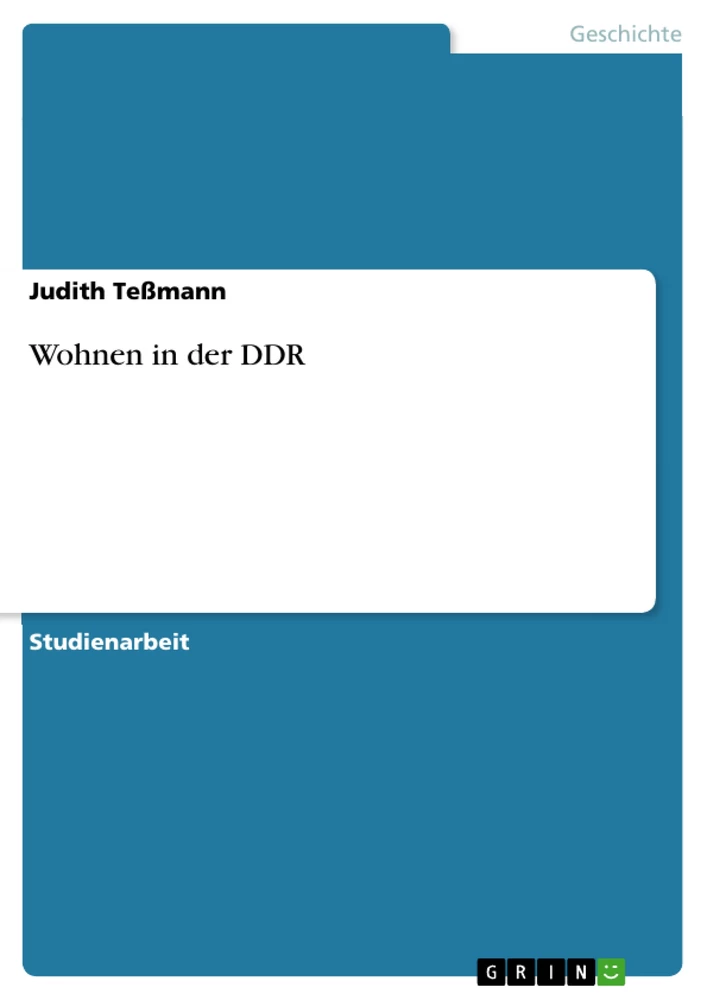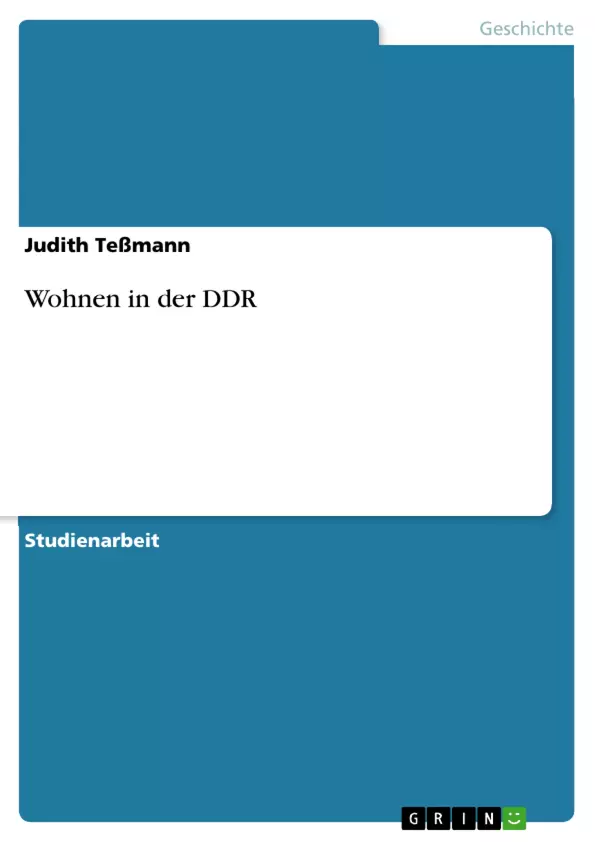Plattenbausiedlungen sind fundamentale Hinterlassenschaften der realsozialistischen Gesellschaft, welche das vorherrschende Bild der DDR bis heute prägen. Sie sind das Ergebnis einer Politik, welche versucht hat durch Architektur und Masse an Siedlungen eine soziale Ungleichheit abzuwenden. Neben der Architektonik verbindet man mit der „Platte“ ebenso eine Lebensweise, welche von guter Nachbarschaft und Kollektivierung geprägt ist. Die „Wohnungsfrage“, welche mit der Industrialisierung und der Urbanisierung im 19. Jahrhundert aufkam, konnte laut Friedrich Engels nicht im Kapitalismus gelöst werden. Folglich sah sich das sozialistische DDR-Regime dazu verpflichtet, diese Wohnungsproblematik aufzubrechen. Durch die Kursänderung Chruschtschows im Städtebau hin zur Industrialisierung des Bauens, wurde in Russland eine neue Architektur hervorgebracht, welche dem Sozialismus dienlich war. Zum einen erfüllte sie kostengünstig und schnell einer großen Masse an Menschen den Wunsch einer Wohnung, zum anderen konnte die Politik dies dazu nutzen, die Kollektivierung der Gesellschaft besser und organisierter voranzutreiben. Interessengegenstand dieser Arbeit soll genau dieser Aspekt sein. Diesbezüglich sollen folgende Fragen leitend sein. Wie vollzog sich die DDR-Baugeschichte hin zur Überhöhung des Plattenbaus? Hat die SED versucht, die Gesellschaft durch den Bau dieser Siedlungen zu kollektivieren? Lässt sich diese, von der SED proklamierte, Vereinheitlichung der Gesellschaft auch faktisch in den Siedlungen wiederfinden? Und wie vollzog sich das Spannungsverhältnis zwischen dem Kollektiv der Hausgemeinschaft und der Privatheit innerhalb der Familien? Bezüglich der Beantwortung dieser Fragen wird anfänglich ein Einblick in den historischen Kontext gegeben. Darauf basierend wird die baugeschichtliche Entwicklung der Platte dargestellt um daraufhin das Leben der Siedlungsbewohner nähergehend zu betrachten. Dies beinhaltet ebenso die Überprüfung, ob eine Kollektivierung der Hausbewohner stattfand. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Politischer und historischer Weg zur Überhöhung des Plattenbaus
- 2.1 Historischer Kontext
- 2.2 Die „Erfindung“ der Platte
- 3. Leben in der Platte
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte des Plattenbaus in der DDR, insbesondere während der Ära Honeckers. Sie analysiert den politischen und historischen Kontext der Überhöhung des Plattenbaus als dominierende Bauweise und beleuchtet den Versuch der SED, durch diese Architektur die Gesellschaft zu kollektivieren. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob diese angestrebte Vereinheitlichung in der Realität der Plattenbausiedlungen widergespiegelt wird und wie sich das Spannungsverhältnis zwischen Kollektiv und individueller Privatsphäre gestaltet hat.
- Politischer und historischer Kontext des Plattenbaus in der DDR
- Die Entwicklung der Plattenbauarchitektur und ihre ökonomischen Hintergründe
- Das Zusammenleben in Plattenbausiedlungen und der Aspekt der Kollektivierung
- Das Spannungsfeld zwischen Kollektiv und individueller Privatsphäre
- Der Einfluss der Wohnungspolitik auf die Stadtentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Plattenbaus in der DDR ein und beschreibt die Plattenbausiedlungen als prägende Hinterlassenschaften der realsozialistischen Gesellschaft. Sie betont den Versuch, durch Architektur und Massenbau soziale Ungleichheit zu verringern und erwähnt die Verbindung von Plattenbauarchitektur mit einer von Nachbarschaft und Kollektivierung geprägten Lebensweise. Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage, die sich mit dem politischen und baugeschichtlichen Weg zur Überhöhung des Plattenbaus, dem Versuch der SED zur Kollektivierung der Gesellschaft durch den Bau dieser Siedlungen, der faktischen Vereinheitlichung in den Siedlungen und dem Spannungsverhältnis zwischen Kollektiv und Privatsphäre befasst. Sie benennt die methodischen Ansätze und die wichtigsten Quellen der Arbeit.
2. Politischer und historischer Weg zur Überhöhung des Plattenbaus: Dieses Kapitel analysiert den politischen und historischen Weg zur Dominanz des Plattenbaus in der DDR. Es beginnt mit dem historischen Kontext, der den Wohnungsnotstand nach dem Zweiten Weltkrieg und die Notwendigkeit schneller und kostengünstiger Bauweisen hervorhebt. Es wird die Einflussnahme Chruschtschows auf die sowjetische und damit auch die DDR-Baupolitik beleuchtet, die die Abkehr vom teuren und aufwendigen Stalinismus hin zu einer ökonomischeren Bauweise bedeutete. Das Kapitel beschreibt die politische Entscheidung für den industriellen Plattenbau, die Standardisierung und die damit verbundene Beschränkung der architektonischen Gestaltungsfreiheit. Es werden die wichtigsten politischen Entscheidungen und Konferenzen genannt, welche die Entwicklung und Umsetzung des Plattenbaus beeinflusst haben. Die zunehmende Bedeutung des Wohnungsbaus im Vergleich zur Städtebaupolitik wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Plattenbau, DDR, Wohnungspolitik, SED, Kollektivierung, Industrialisierung, Sozialismus, Architektur, Stadtentwicklung, Honecker, Wohnungsbauprogramm, Großplattenbau, Standardisierung, Soziale Ungleichheit, Privatsphäre, Hausgemeinschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Plattenbau in der DDR"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Übersicht über eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Plattenbau in der DDR. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des politischen und historischen Kontextes der Überhöhung des Plattenbaus als dominante Bauweise in der DDR und den Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Zusammenleben in den Plattenbausiedlungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht den politischen und historischen Weg zur Dominanz des Plattenbaus in der DDR, insbesondere während der Ära Honeckers. Sie analysiert den Versuch der SED, durch den Plattenbau die Gesellschaft zu kollektivieren, und beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen Kollektiv und individueller Privatsphäre in den Plattenbausiedlungen. Weitere Themen sind die Entwicklung der Plattenbauarchitektur, ihre ökonomischen Hintergründe, der Einfluss der Wohnungspolitik auf die Stadtentwicklung und das Zusammenleben in den Plattenbausiedlungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mindestens vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum politischen und historischen Weg zur Überhöhung des Plattenbaus (mit Unterkapiteln zum historischen Kontext und der "Erfindung" der Platte), ein Kapitel zum Leben in der Platte und eine Schlussbetrachtung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie der Plattenbau in der DDR entstanden ist und welche politischen und gesellschaftlichen Ziele damit verfolgt wurden. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die angestrebte Kollektivierung durch den Plattenbau in der Realität widergespiegelt wurde und wie sich das Spannungsverhältnis zwischen Kollektiv und individueller Privatsphäre gestaltet hat.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Plattenbau, DDR, Wohnungspolitik, SED, Kollektivierung, Industrialisierung, Sozialismus, Architektur, Stadtentwicklung, Honecker, Wohnungsbauprogramm, Großplattenbau, Standardisierung, Soziale Ungleichheit, Privatsphäre, Hausgemeinschaft.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die genauen Methoden werden in der Einleitung der Arbeit beschrieben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Arbeit auf verschiedenen Quellen beruht.
Was ist der historische Kontext des Plattenbaus in der DDR?
Der historische Kontext beinhaltet den Wohnungsnotstand nach dem Zweiten Weltkrieg und die Notwendigkeit schneller und kostengünstiger Bauweisen. Die Arbeit beleuchtet auch den Einfluss Chruschtschows auf die sowjetische und damit die DDR-Baupolitik, die zu einer Abkehr vom aufwendigen Stalinismus führte.
Wie wird das Spannungsfeld zwischen Kollektiv und individueller Privatsphäre behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie sich das angestrebte Kollektiv der SED mit der individuellen Privatsphäre der Bewohner der Plattenbausiedlungen vertrug und welche Konflikte daraus entstanden sind.
- Quote paper
- Judith Teßmann (Author), 2014, Wohnen in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269350