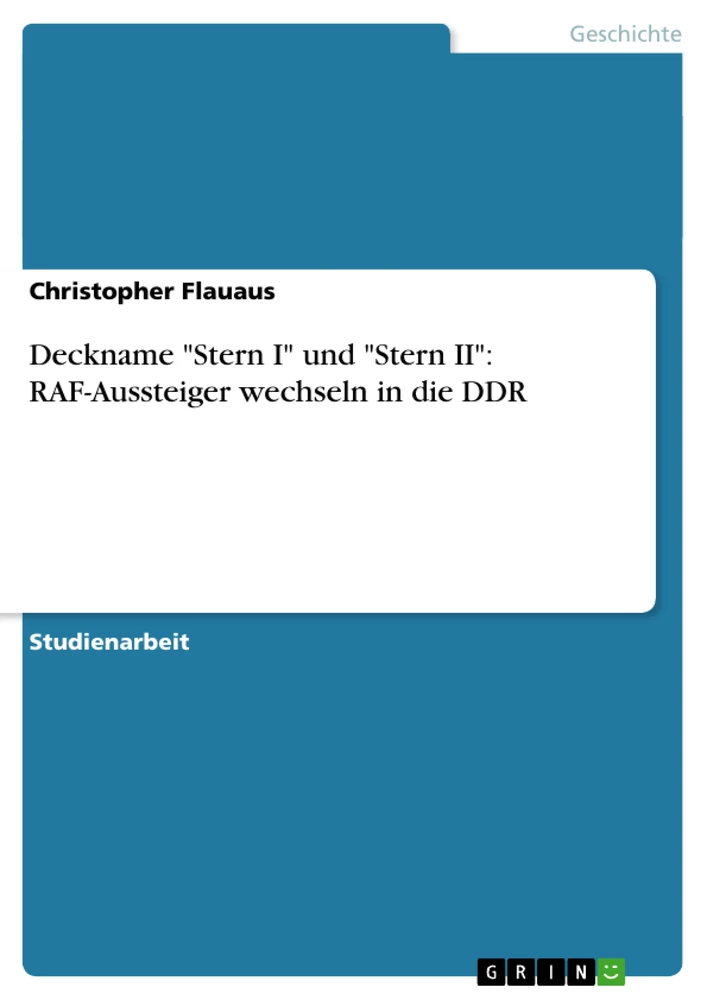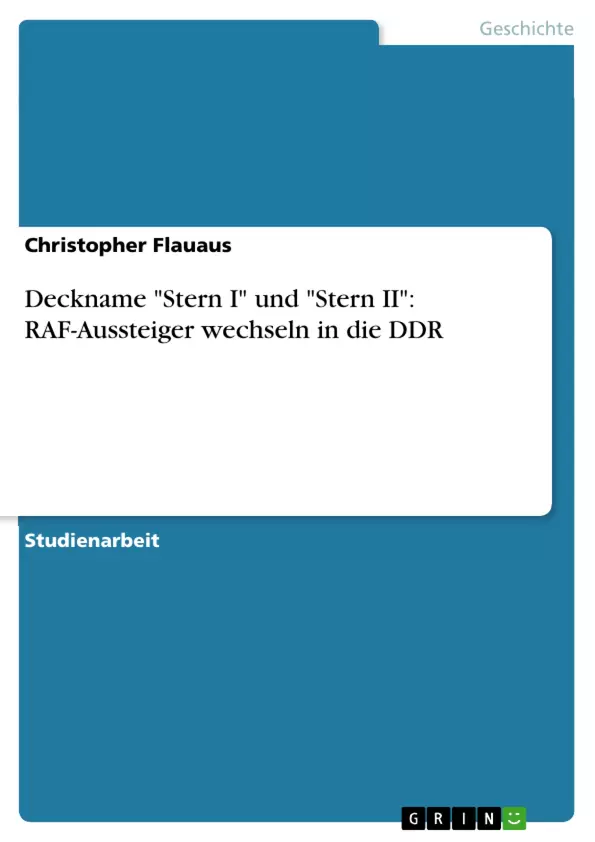Die Arbeit geht der Frage nach, wie es zum Kontakt zwischen RAF und DDR gekommen ist, was sich beide Seiten davon erhofften und weshalb der Kontakt ab 1984 schließlich eingestellt wurde. Das Ziel der Seminararbeit besteht darin herauszuarbeiten, welche Absichten DDR und RAF mit dem Kontakt verfolgten.
Im Mittelpunkt sollen die Vorgänge "Stern I" und "Stern II" stehen. Besonders bei "Stern II" wird die Intensität des Kontakts deutlich ...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.2. Der Beginn des Kontakts zwischen RAF und DDR
- 3. „Stern II“: RAF-Aussteiger beginnen in der DDR ein neues Leben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Kontakt zwischen der Roten Armee Fraktion (RAF) und der DDR, beleuchtet die wechselseitigen Erwartungen und die Gründe für den Abbruch des Kontakts ab 1984. Im Mittelpunkt stehen die Vorgänge „Stern I“ und „Stern II“, insbesondere die intensive Zusammenarbeit im Rahmen von „Stern II“. Die Arbeit konzentriert sich auf die Absichten beider Seiten und berücksichtigt dabei die Herausforderungen durch Aktenvernichtung und die begrenzte Verfügbarkeit von Quellenmaterial.
- Der Beginn des Kontakts zwischen RAF und DDR
- Die Motive der DDR (MfS) für die Kontaktaufnahme mit der RAF
- Die Motive der RAF für die Kontaktaufnahme mit der DDR
- Die Eingliederung der RAF-Aussteiger in die DDR („Stern II“)
- Der Abbruch des Kontakts zwischen RAF und DDR
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht den Kontakt zwischen der RAF und der DDR, fokussiert auf die Motive beider Seiten und die Gründe für den Abbruch des Kontakts ab 1984. Die Vorgänge „Stern I“ und „Stern II“ stehen im Mittelpunkt, wobei „Stern II“ aufgrund der intensiven Zusammenarbeit detaillierter betrachtet wird. Die Arbeit räumt ein, dass aufgrund von Aktenvernichtung und Quellenmangel nicht alle Fragen beantwortet werden können und eine umfassende Darstellung des Lebens der RAF-Aussteiger in der DDR nicht möglich ist. Die Quellenlage wird kritisch beleuchtet, wobei die Schwierigkeiten bei der Verwendung bestimmter Autoren aufgrund fehlender Fußnoten hervorgehoben werden.
1.2. Der Beginn des Kontakts zwischen RAF und DDR: Dieses Kapitel beschreibt die ersten Kontakte zwischen der Bewegung 2. Juni (später RAF) und dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR, beginnend mit einem Treffen zwischen Inge Viett und Harry Dahl im Jahr 1978. Dahl versicherte Viett die Unterstützung der DDR und betonte das Fehlen einer Zusammenarbeit zwischen der DDR- und der westdeutschen Polizei. Dieser erste Kontakt legte den Grundstein für eine langjährige Beziehung, von der beide Seiten profitierten. Das Kapitel beleuchtet auch die Herausforderungen der Forschung aufgrund der gezielten Aktenvernichtung im Jahr 1989 und diskutiert die Motive des MfS: die Gewinnung von Informationen aus der bundesdeutschen und internationalen Terrorismus-Szene sowie die Prävention terroristischer Anschläge auf die DDR. Die Aufnahme der RAF-Aussteiger wird als ein Mittel zur potentiellen Destabilisierung der Bundesrepublik dargestellt, obwohl eine direkte Zusammenarbeit zwischen RAF und MfS nicht eindeutig belegt ist. Die RAF erhoffte sich primär finanzielle und materielle Unterstützung, die die DDR jedoch aus außenpolitischen Gründen nicht leisten konnte.
3. „Stern II“: RAF-Aussteiger beginnen in der DDR ein neues Leben: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Vorgang „Stern II“, der die Eingliederung der RAF-Aussteiger in die DDR beschreibt. Angetrieben durch interne Konflikte und die gescheiterte „Offensive 77“, suchten acht RAF-Mitglieder nach einem Ausstieg. Der bereits bestehende Kontakt zwischen Inge Viett und dem MfS ermöglichte die Unterbringung der Aussteiger in der DDR. Die Entscheidung wurde auf höchster Ebene im MfS getroffen, in der Hoffnung auf Wohlwollen der noch aktiven Terroristen. Die Aussteiger reisten über Prag in die DDR und wurden in einem Jagdhaus untergebracht, wo sie neue Identitäten erhielten und ein neues Leben begannen. Das Kapitel beschreibt die detaillierte Organisation der Eingliederung durch das MfS, inklusive der Schaffung neuer Biografien, der Zuweisung von Arbeitsstellen und Wohnungen. Die letzten beiden Aussteiger, Inge Viett und Henning Beer, folgten 1982.
Schlüsselwörter
Rote Armee Fraktion (RAF), DDR, Ministerium für Staatssicherheit (MfS), „Stern II“, Aussteiger, Terrorismus, Kontaktaufnahme, Geheimdienst, Aktenvernichtung, Ost-West-Konflikt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Kontakt zwischen RAF und DDR
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Kontakt zwischen der Roten Armee Fraktion (RAF) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), insbesondere die Operationen "Stern I" und "Stern II", die Motive beider Seiten und die Gründe für den Abbruch des Kontakts ab 1984. Ein Schwerpunkt liegt auf der Eingliederung von RAF-Aussteigern in die DDR im Rahmen von "Stern II".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Beginn des Kontakts zwischen RAF und DDR, die Motive des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) und der RAF für die Kontaktaufnahme, die Eingliederung der RAF-Aussteiger in die DDR ("Stern II"), und den Abbruch des Kontakts. Es werden die Herausforderungen durch Aktenvernichtung und die begrenzte Quellenlage berücksichtigt.
Welche Rolle spielte das MfS?
Das MfS suchte Informationen über die bundesdeutsche und internationale Terrorismus-Szene und wollte terroristische Anschläge auf die DDR verhindern. Die Aufnahme der RAF-Aussteiger diente möglicherweise auch der potentiellen Destabilisierung der Bundesrepublik. Die direkte Zusammenarbeit zwischen RAF und MfS ist jedoch nicht eindeutig belegt.
Welche Motive hatte die RAF?
Die RAF erhoffte sich primär finanzielle und materielle Unterstützung von der DDR, die aus außenpolitischen Gründen jedoch nicht geleistet werden konnte.
Was war "Stern II"?
"Stern II" beschreibt die detailliert organisierte Eingliederung von acht RAF-Mitgliedern in die DDR. Das MfS sorgte für neue Identitäten, Arbeitsstellen und Wohnungen. Die Eingliederung erfolgte nach internen Konflikten und der gescheiterten "Offensive 77" innerhalb der RAF.
Wie wird die Quellenlage bewertet?
Die Arbeit räumt ein, dass aufgrund von Aktenvernichtung und Quellenmangel nicht alle Fragen beantwortet werden können und eine umfassende Darstellung des Lebens der RAF-Aussteiger in der DDR nicht möglich ist. Die Quellenlage wird kritisch beleuchtet, wobei die Schwierigkeiten bei der Verwendung bestimmter Autoren aufgrund fehlender Fußnoten hervorgehoben werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Rote Armee Fraktion (RAF), DDR, Ministerium für Staatssicherheit (MfS), "Stern II", Aussteiger, Terrorismus, Kontaktaufnahme, Geheimdienst, Aktenvernichtung, Ost-West-Konflikt.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Zusammenfassungen der Kapitel "Einleitung", "1.2. Der Beginn des Kontakts zwischen RAF und DDR" und "3. „Stern II“: RAF-Aussteiger beginnen in der DDR ein neues Leben". Diese Zusammenfassungen bieten einen Überblick über die jeweiligen Kapitelthemen und -inhalte.
- Quote paper
- Christopher Flauaus (Author), 2012, Deckname "Stern I" und "Stern II": RAF-Aussteiger wechseln in die DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269391