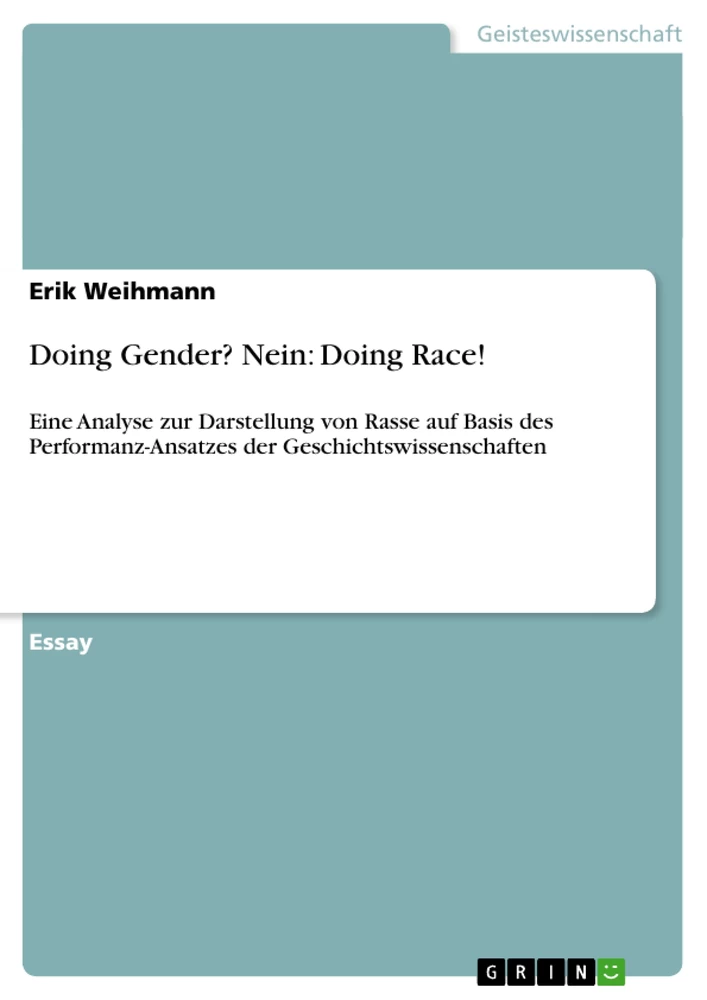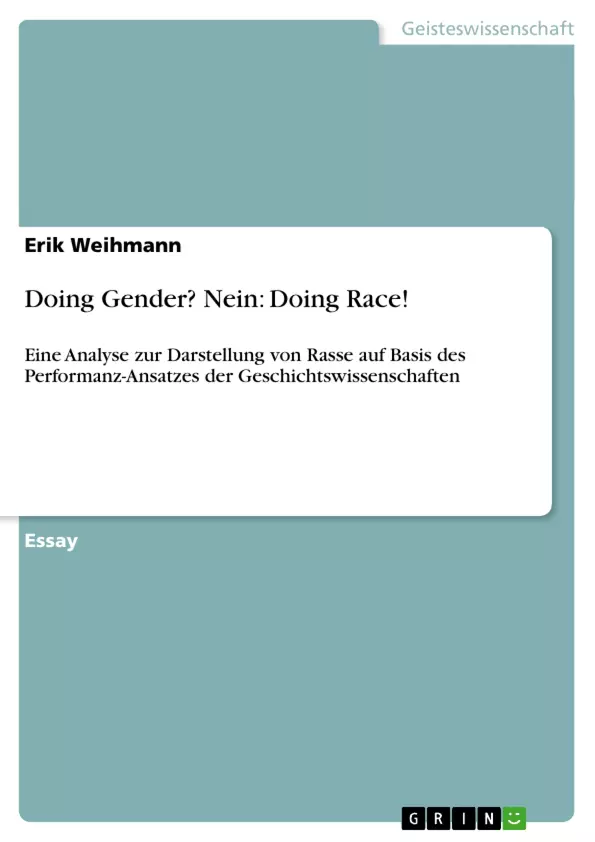Der vorliegende Essay will sich der Frage widmen wie Rasse als Ordnungskategorie in der sozialen Umwelt von Individuen in spezifischen Situationen dargestellt wird. In Anlehnung an den wegweisenden Aufsatz aus der Geschlechtersoziologie von West und Zimmerman „Doing Gender“, der hier im Einführungs- und Brückenkapitel eine zentrale Rolle einnehmen soll, lautet das diesen Essay durchziehende Schlagwort „Doing Race“.
Die Präsentation und Vermittlung dieser Ordnungskategorie soll jedoch nicht ausschließlich analog zum Doing Gender konzipiert und analysiert werden, vielmehr wird explizit auch der mit ihm verwandte Ansatz der Perfomanz (performance) einbezogen. In der Geschichtswissenschaft ist er, ausgehend von den Vereinigten Staaten mit folgender Breitenwirkung hinein den europäischen Diskurs, in den letzten 10 Jahren als neue theoretische Strömung der Historiographie kritisch diskutiert worden. Für diese Arbeit sollen Jürgen Martschukat und Steffen Patzold als deutsche Avantgardisten für die theoretische Grundlegung herangezogen werden.
Beginnend mit einer Darstellung der Funktionsmechanismen des Doing Gender und der Performanz anhand der hier resümierenden fundamentalen Arbeiten der genannten Autoren sollen Gemeinsamkeiten und ggf. Unterschiede zwischen beiden Ansätzen aufgezeigt werden. Nachfolgend und abschließend werden wir uns einem, hier aufgrund des Raumes leider nicht ausführlich behandelbarem empirischem Bereich der Darstellung von Rasse zuwenden - dem Sport, am Beispiel des Golfers Tiger Woods und das Boxers Jack Johnsons, die beide als Afroamerikaner in ursprünglich als “weiß“ klassifizierten Sportarten zu Ruhm und Ehre gelangten, aber dieser Erfolg unterschiedlich wahrgenommen und darauf reagiert wurde.
Einführung
Der vorliegende Essay will sich der Frage widmen wie Rasse als Ordnungskategorie in der sozialen Umwelt von Individuen in spezifischen Situationen dargestellt wird. In Anlehnung an den wegweisenden Aufsatz aus der Geschlechtersoziologie von West und Zimmerman „Doing Gender“, der hier im Einführungs- und Brückenkapitel eine zentrale Rolle einnehmen soll, lautet das diesen Essay durchziehende Schlagwort „Doing Race“.
Die Präsentation und Vermittlung dieser Ordnungskategorie soll jedoch nicht ausschließlich analog zum Doing Gender konzipiert und analysiert werden, vielmehr wird explizit auch der mit ihm verwandte Ansatz der Perfomanz (performance) einbezogen. In der Geschichtswissenschaft ist er, ausgehend von den Vereinigten Staaten mit folgender Breitenwirkung hinein den europäischen Diskurs, in den letzten 10 Jahren als neue theoretische Strömung der Historiographie kritisch diskutiert worden. Für diese Arbeit sollen Jürgen Martschukat und Steffen Patzold als deutsche Avantgardisten für die theoretische Grundlegung herangezogen werden.
Beginnend mit einer Darstellung der Funktionsmechanismen des Doing Gender und der Performanz anhand der hier resümierenden fundamentalen Arbeiten der genannten Autoren sollen Gemeinsamkeiten und ggf. Unterschiede zwischen beiden Ansätzen aufgezeigt werden. Nachfolgend und abschließend werden wir uns einem, hier aufgrund des Raumes leider nicht ausführlich behandelbarem empirischem Bereich der Darstellung von Rasse zuwenden - dem Sport, am Beispiel des Golfers Tiger Woods und das Boxers Jack Johnsons, die beide als Afroamerikaner in ursprünglich als “weiß“ klassifizierten Sportarten zu Ruhm und Ehre gelangten, aber dieser Erfolg unterschiedlich wahrgenommen und darauf reagiert wurde.
Doing Gender nach Candace West und Don Zimmerman
West und Zimmerman kehren der bisherigen Auffassung der Geschlechtsunterscheidung von sex als biologische determinierte Merkmalsausprägung eines Menschen und gender dem „erworbenen Geschlecht“ den Rücken, da für sie der Standpunkt, dass das Geschlecht zwar kulturell anthropologisch und psychologisch adaptiert wird und dieser Prozess mit fünf Jahren abgeschlossen sei mit der quasi Fixiertheit des gender wie es bei sex der Fall ist, nicht nachvollziehbar ist; ebenso wie die Vorstellung Erwing Goffmans, dass gender in der Interaktion nicht nur eine Rolle sei (vgl. West / Zimmerman 1987, 126). Sie vertreten die These, dass „participants in interaction organize their various and manifold activities to reflect or express gender, and [that] they are disposed to perceive the behavior of others in a similar light” (ebd., 127). Deshalb gibt es nach West und Zimmerman drei Einheiten der Analyse von Geschlecht, deren analytische Trennung wichtig ist „for understanding the relationship among these elements and their interactional work involved in 'being' a gendered person“ (ebd.). Dies wären sex, als Beschreibung der biologischen Merkmale einer Person wie Genitalien oder Chromosomen, sex category, die sich auf die alltäglich wahrnehmbare äußere Erscheinung einer Person durch Aneignung der im sozialen Leben relevanten und zuordenbaren Eigenschaften eines Geschlechts und schließlich gender als die Tätigkeit und der Prozess die dem Geschlecht zugeschriebenen Verhaltensweisen und Aktivitäten auch real und spezifisch in angemessener Weise umzusetzen (vgl. ebd.).
Um ihren Vorstoß empirisch untermauern zu können, bedienen sich West und Zimmerman an der Interaktionsordung Goffmans, der gegenseitige Wahrnehmung (displays) als „highly conventionalized behaviors structured as two-part exchanges of the statement-reply type, in which the presence or absence of symmetry can establish deference or dominance“ auffasst (vgl. ebd., 129). Wenn Menschen mit anderen in ihrer Umgebung interagieren, dann vermuten sie, dass jeder eine grundlegende Natur besitzt, die durch natürliche Zeichen gezeigt oder aufgegeben werden kann. Die menschliche Natur gibt uns die Fähigkeit zu lernen, männliche und weibliche Geschlechtsdarstellungen zu produzieren und zu erkennen, d.h. wir sind in erster Linie Personen und nicht Männer oder Frauen. Nach Goffman sind Gender Expressions optionale Darstellungen; maskuline Merkmale können angeboten werden oder nicht und sie können angenommen werden oder nicht. (vgl., ebd.). West und Zimmerman folgen zwar, dass „while it is plausible to contend that gender displays […] are optional” aber fügen hinzu “it does not seem plausible to say that we have the option of being seen by others as female or male” (ebd.). Für sie ist das Geschlecht in der Interaktion nicht nur omnipräsent, sondern wie sie in der nach dem Untersuchungsobjekt, eines zur Frau gewordenen Transsexuellen, benannten Agnes-Studien feststellen, auch omnipotent. Für Agnes spielt das reine biologische Geschlecht bei der Darstellung der Weiblichkeit keine bedeutende Rolle, da es durch die Verdecktheit der Merkmalsausprägungen nicht viel mit der Identifikation der sex category im alltäglichen Leben zu tun hat. (vgl. ebd., 132). Signifikanter gestaltet sich die sex category für Agnes, in der sie sich die „Falls-Kann“-Regel - wenn äußerliche Merkmale für ein Geschlecht vorliegen, dann entsprechende Kategorienverortung - über ihr äußerlich-feminines Auftreten und Prädisposition der kulturellen Umgebung: es gebe nur zwei Geschlechter zu nutzen macht (vgl. ebd., 132f.). Aber sex categorization ist noch keine Vervollkommnung des gender. „Women can be seen as unfeminine, but that does not make them ‘unfemale’” (ebd., 134). Für die glaubhafte (accountable) Zurechnung eines normative gender behavior ist ein gut definiertes Bündel von Handlungen, die einfach in die Interaktionen einfließen können, um sichtbare Zeichen von Männlich- oder Weiblichkeit zu produzieren, notwendig. Doing Gender besteht also in dem „tun“ dieser Handlungen in bestimmten Gelegenheiten (ebd., S. 134f.).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Doing Race“?
Analog zu „Doing Gender“ beschreibt es die soziale Konstruktion und Darstellung von Rasse als Ordnungskategorie in alltäglichen Interaktionen.
Wer sind West und Zimmerman?
Soziologen, die mit ihrem Aufsatz „Doing Gender“ die Grundlage für das Verständnis von Geschlecht als kontinuierlichem Tun schufen.
Wie wird „Rasse“ im Sport dargestellt?
Die Arbeit analysiert dies am Beispiel von Tiger Woods und Jack Johnson, die in ursprünglich „weiß“ klassifizierten Sportarten erfolgreich waren.
Was ist der Unterschied zwischen „sex“, „sex category“ und „gender“?
Sex ist biologisch, Sex Category ist die soziale Zuordnung durch äußere Merkmale und Gender ist das tatsächliche Verhalten/Handeln.
Was bedeutet „Performanz“ in diesem Kontext?
Es bezieht sich auf die Inszenierung und Darstellung sozialer Identitäten, wie sie in der Geschichtswissenschaft und Soziologie diskutiert wird.
- Arbeit zitieren
- B.A. Erik Weihmann (Autor:in), 2008, Doing Gender? Nein: Doing Race!, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269510