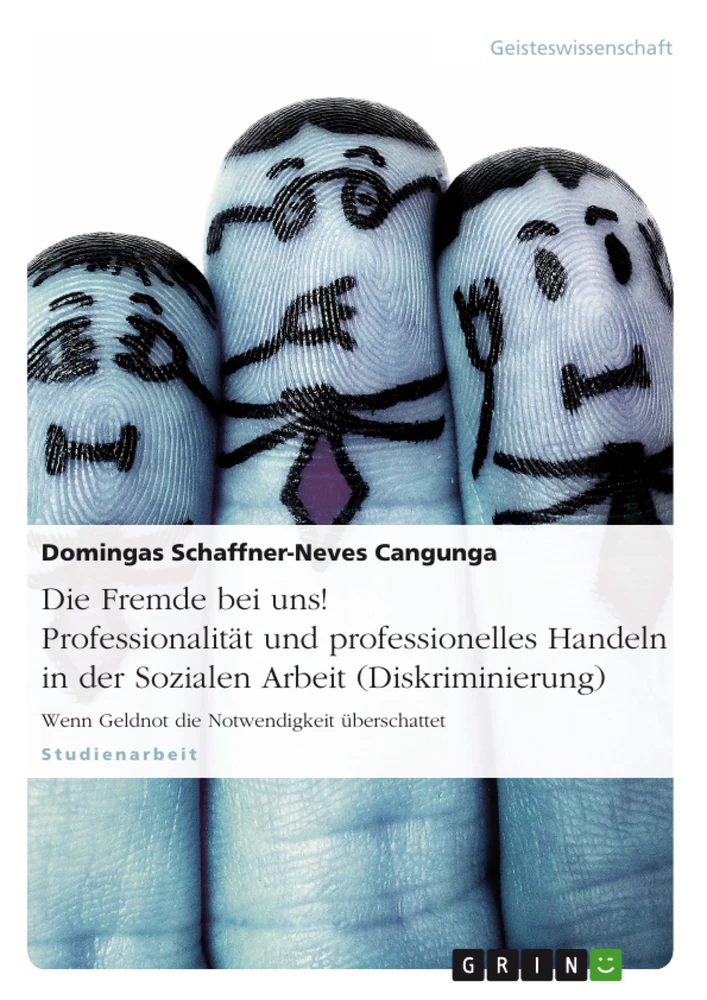Diversität am Arbeits- und Studienplatz sowie innerhalb der Zielgruppen der Sozialen Arbeit ist Bestandteil der postmodernen Gesellschaft. Randgruppen (Minderheiten) werden innerhalb der Schule öfters ausgegrenzt und sind meistens ohnmächtig gegenüber den Machtstrukturen anderer (dominierender) Gruppen von Studierenden. Zu den strukturellen Machtverhältnissen haben die benachteiligten Studierenden allein aufgrund unzureichender Sprachkenntnisse keinen oder lediglich einen begrenzten Zugang. Somit sind sie per se auf die Vernetzung mit Kommilitonen angewiesen, um während des Studiums zum Zuge zu kommen. Dominierende Gruppen wiederum haben in wenigen Fällen Interesse daran, sich auf Fremdgruppen einzulassen; manch andere empfinden es als belastend, sprachliche Hilfe zu leisten. Das persönliche Zeitbudget ist oft knapp bemessen, die eigene Leistung könnte durch die Hilfestellung gefährdet werden. Verschiedenen Aspekten zu Grunde lassen sich Spaltungen in den Alltäglichkeiten der Studierenden bzw. angehenden Soziale ArbeiterInnen feststellen, bezogen auf die Grundsätze des Be-rufskodex lassen sich diese Spaltungen aufgrund alltäglicher Spannungen nicht mit dem Verständnis der Soziale Arbeit als Profession vereinbaren.
Nach Analyse meines Lernumfelds kam ich zum Schluss, dass es bei Mitstudierenden einerseits auf persönlicher Ebene Inkompatibilität gibt, d. h. zwischen der eigenen Wertorientierung und der professionellen Identität. Viele Kommilitonen halten es für ganz normal, Mitstudierende auszuschliessen oder gar zu bevormunden. Andererseits mangelt es in der Schule selbst an strukturellen Instanzen, die es den aufgrund eines Sprachdefizits benachteiligten Gruppen ermöglichen das Sprachrohr zu erweitern. Dadurch, dass Studierende im Allgemeinen unterschiedlichen Bildungsbiographien haben, fehlt ihnen zum Teil ein praktischer Zugang zur Berufsethik der Sozialen. Gerechtigkeit und Fairness werden oft als Begriffe innerhalb der Hochschule verwendet, dennoch schein es nicht allen Studierenden bewusst zu sein, welche Rolle die eigene Person bei Stigmatisierungsprozessen spielen könnte. Es fehlt öfters so etwas wie ein kollegiales Lernen bzw. Interagieren zwischen der Studierenden des Standorts Olten.
Inhaltsverzeichnis
1 Projektbegründung
1.1 Ausgangslage
2 Projektbeschrieb
2.1 Grundzüge des Projekts
2.2 Was ist der „Train the Trainers-Kurs“ genau?
2.3 Schwerpunkte der dreitätigen Blockveranstaltung
3 Intendierte Wirkungen
3.1 Vision (längerfristige Perspektive)
3.2 Ziele (intendierte Wirkungen bis Projektende) Sollzustand
4 Settings und Zielgruppen
4.1 Settings vor der Realisierung:
4.2 Anspruchspersonen des/ Settings/des Stake Holders
4.3 Zielgruppen und Schlüsselpersonen der geplanten Intervention
5 Vorgehensweise
5.1 Strategien (Ansätze, Methoden)
5.2 Zeitlicher Rahmen
6 Projektstruktur
7 Ressourcen
7.1 Personeller Aufwand
7.2 Konzeptarbeit
7.3 Post Umsetzung
7.4 Projektdokumentation, resp. Bericht und Auswertung
8 Literatur-und Abbildverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Ausgangslage für Diskriminierung an Hochschulen?
In einer postmodernen Gesellschaft ist Diversität allgegenwärtig. Dennoch erleben Randgruppen oft Ausgrenzung durch dominierende Gruppen, häufig aufgrund sprachlicher Barrieren.
Warum ist Vernetzung für benachteiligte Studierende so wichtig?
Studierende mit Sprachdefiziten sind auf Hilfe angewiesen, um komplexe Studieninhalte zu bewältigen. Ohne Vernetzung riskieren sie den Anschluss an die Leistungsklasse.
Was ist der „Train the Trainers-Kurs“?
Es handelt sich um ein Projekt zur Sensibilisierung und Professionalisierung angehender Sozialarbeiter, um Inkompatibilitäten zwischen persönlichen Werten und Berufsethik abzubauen.
Welche Rolle spielt die Berufsethik in der Sozialen Arbeit?
Gerechtigkeit und Fairness sind zentrale Werte. Professionelles Handeln erfordert, eigene Stigmatisierungsprozesse zu erkennen und kollegiales Lernen zu fördern.
Was wird unter „Strukturmangel“ an Hochschulen kritisiert?
Kritisiert wird das Fehlen von Instanzen, die benachteiligten Gruppen eine Stimme geben und den Austausch zwischen Studierenden mit unterschiedlichen Biografien aktiv fördern.
- Quote paper
- Domingas Schaffner-Neves Cangunga (Author), 2014, Die Fremde bei uns! Professionalität und professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit (Diskriminierung), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269514