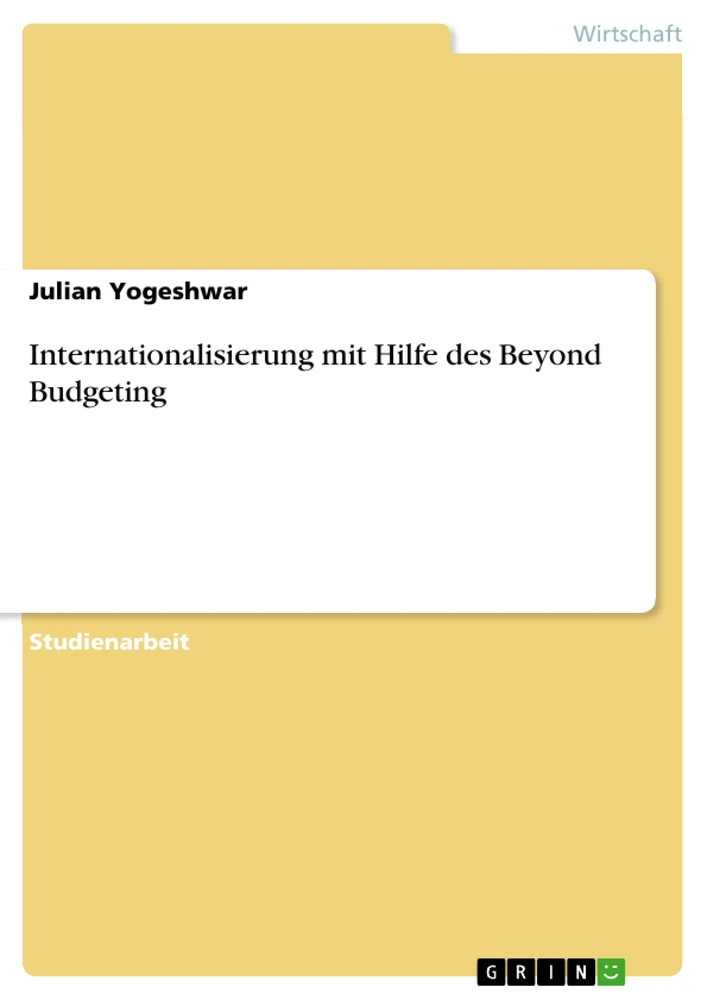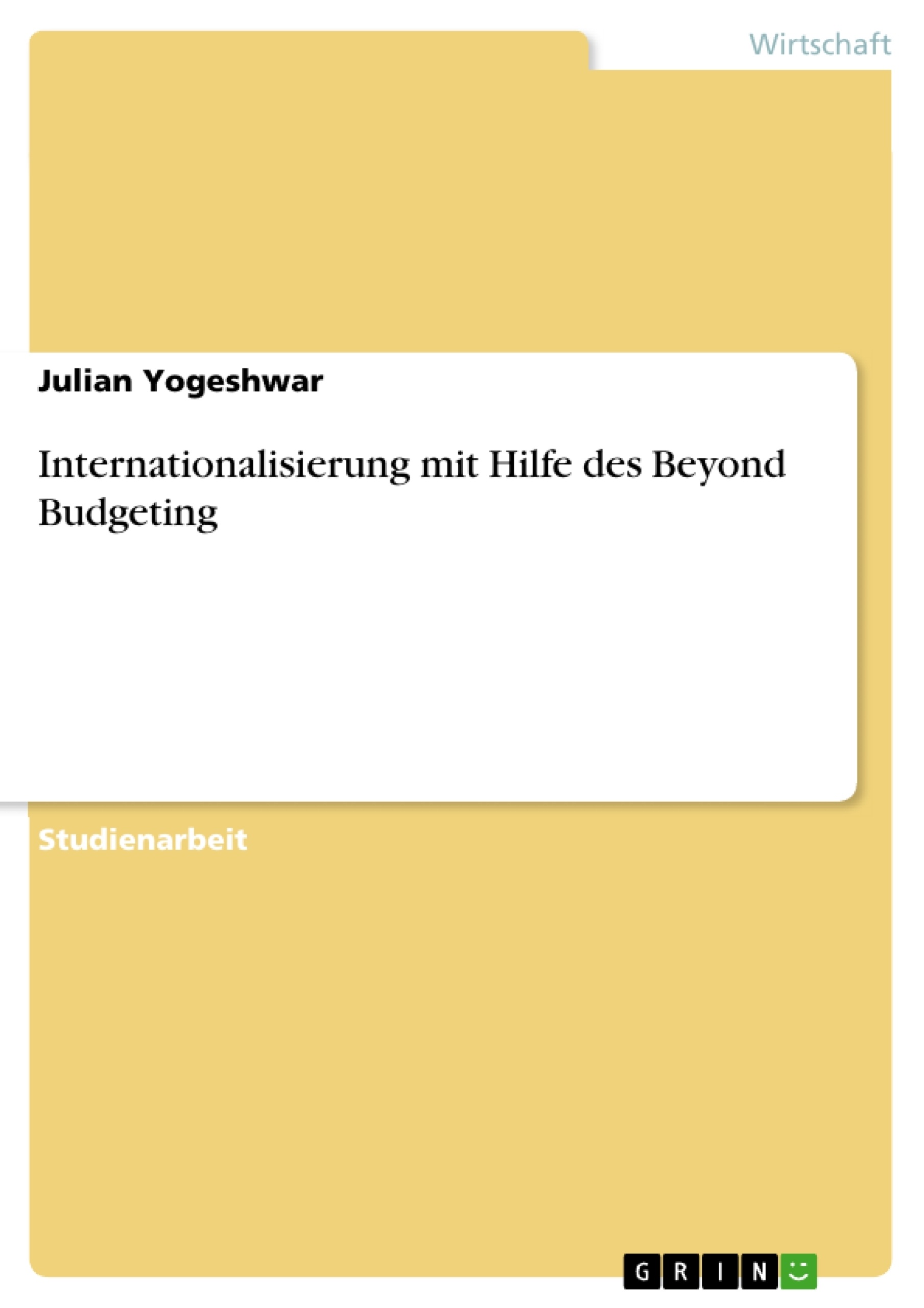Globale Veränderungen, internationale Unternehmen und weltweite Handelsabkommen prägen die heutige Wirtschaft. Der Fortschritt in der Technologie, Forschung und Entwicklung führte in den letzten Jahrzenten zu immer kürzeren Lebenszyklen der jeweiligen Produkte, wechselnden Kunden und einem hohen Preisverfall. Zunehmende internationale Verflechtungen der Weltwirtschaft erhöhen die Komplexität und erfordern daher mehr Transparenz.
Im Hinblick auf dieses Szenario ist ein flexibles Controlling für eine nachhaltige erfolgreiche Unternehmensführung unerlässlich, um am Wettbewerb teilnehmen zu können und sich zu behaupten. Ein schnelles Reagieren auf Veränderungen ist ohne die geeigneten Instrumente nicht möglich. Diesen Anspruch scheint jedoch die klassische Budgetierung, geprägt vom Taylorismus und der Zentralisation, nicht erfüllen zu können und steht deshalb immer häufiger in der Diskussion.
Für einige Manager scheint das Konzept des Beyond Budgeting eine Alternative zu sein. Beyond Budgeting bedeutet eine radikale Dezentralisierung und Auflösung der hierarischen Strukturen, wie sie im Taylorismus vorzufinden sind, um die Unternehmen an heutige Bedingungen anzupassen.
Die vorliegende Seminararbeit soll die Forschungsfrage beantworten, ob das Modell des Beyond Budgeting, als Weiterentwicklung des Scientific Management sinnvoll ist, um Unternehmen zu dezentralisieren und dadurch besser zu internationalisieren?
Zu Beginn ist es von Nöten, die Begriffe Scientific Management und Beyond Budgeting, besonders im Hinblick auf die angestrebte Dezentralisierung, näher zu erläutern.
Anschließend soll geprüft werden, inwieweit die Dezentralisierung die Internationalisierung eines Unternehmens fördert und welche Faktoren hierbei besonders zu beachten sind, um schließlich festzustellen, ob das Beyond Budgeting als geeignetes Instrument zur Dezentralisierung und folglich zur Internationalisierung verwendet werden kann.
Beispielhaft wird untersucht, ob die Implementierung des Beyond Budgeting bei Svenska Handelsbanken als positiv zu beurteilen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zielsetzung und Vorgehensweise
- 2. Scientific Management
- 2.1. Ursprung & Definition
- 2.2. Entwicklung und heutige Zeit
- 3. Beyond Budgeting
- 3.1. Hintergrund
- 3.2. Entstehung und Entwicklung
- 3.3. Prinzipien des Beyond Budgeting
- 3.3.1. Prinzipien der adaptiven Managementprozesse
- 3.3.2. Prinzipien der Dezentralisierung
- 4. Dezentralisierung
- 4.1. Notwendigkeit der Dezentralisierung im internationalen Kontext
- 4.2. Theorie XY
- 4.3. Scientific Management vs. Beyond Budgeting - conclusion
- 4.4. Beyond Budgeting am Beispiel der Svenska Handelsbanken
- 4.4.1. Facts & Figures
- 4.4.2. Dezentralisierung durch Beyond Budgeting bei Svenska Handelsbanken
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Frage, ob das Konzept des Beyond Budgeting als Weiterentwicklung des Scientific Management sinnvoll ist, um Unternehmen zu dezentralisieren und dadurch besser zu internationalisieren. Die Arbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung beider Managementkonzepte und ihre Relevanz im Kontext der Internationalisierung.
- Scientific Management und Beyond Budgeting im Vergleich
- Dezentralisierung als Schlüsselfaktor für die Internationalisierung von Unternehmen
- Die Rolle von adaptiven Managementprozessen und dezentralisierten Entscheidungsstrukturen
- Das Beyond Budgeting Modell am Beispiel der Svenska Handelsbanken
- Vorteile und Herausforderungen der Implementierung von Beyond Budgeting
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung der heutigen Wirtschaftswelt mit ihren globalen Veränderungen und dem Bedarf an flexiblem Controlling dar. Sie führt das Konzept des Beyond Budgeting als mögliche Alternative zur klassischen Budgetierung ein und definiert die Forschungsfrage der Arbeit.
- Kapitel 2: Scientific Management: Dieses Kapitel beleuchtet die Ursprünge und Definition des Scientific Managements sowie seine Entwicklung bis in die heutige Zeit. Es werden die Kernelemente des Taylorismus und seine Auswirkungen auf die Organisation und Managementlehre beschrieben.
- Kapitel 3: Beyond Budgeting: Dieses Kapitel stellt das Beyond Budgeting Konzept vor, inklusive seiner Prinzipien der adaptiven Managementprozesse und Dezentralisierung. Es erklärt den Hintergrund und die Entstehung des Beyond Budgeting Modells.
- Kapitel 4: Dezentralisierung: Dieses Kapitel untersucht die Notwendigkeit von Dezentralisierung im internationalen Kontext, beleuchtet die Theorie XY und vergleicht Scientific Management mit Beyond Budgeting in Bezug auf die Dezentralisierung. Es betrachtet das Beispiel der Svenska Handelsbanken, um die Anwendung des Beyond Budgeting Modells in der Praxis zu illustrieren.
Schlüsselwörter
Scientific Management, Beyond Budgeting, Dezentralisierung, Internationalisierung, Adaptive Managementprozesse, Svenska Handelsbanken, Taylorismus, Theorie XY, Flexible Budgetierung, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Beyond Budgeting Konzepts?
Beyond Budgeting zielt auf eine radikale Dezentralisierung und die Auflösung hierarchischer Strukturen ab, um Unternehmen flexibler für die heutigen globalen Marktbedingungen zu machen.
Warum wird die klassische Budgetierung kritisiert?
Sie gilt als zu starr, zentralistisch und geprägt vom Taylorismus, wodurch sie schnellen Veränderungen in Technologie und Kundenwünschen nicht gerecht wird.
Wie fördert Dezentralisierung die Internationalisierung?
Dezentrale Strukturen erlauben es lokalen Einheiten, schneller auf länderspezifische Gegebenheiten zu reagieren, was in einem komplexen internationalen Umfeld ein Wettbewerbsvorteil ist.
Was ist das Beispiel der Svenska Handelsbanken?
Die Svenska Handelsbanken gilt als Pionier des Beyond Budgeting. Sie nutzt dezentrale Entscheidungsstrukturen erfolgreich, um ohne klassische Budgets nachhaltig zu wachsen.
Was sind die Prinzipien der adaptiven Managementprozesse?
Dazu gehören rollierende Prognosen und relative Ziele anstelle von festen Jahresbudgets, um eine kontinuierliche Anpassung an die Marktlage zu ermöglichen.
Was versteht man unter Scientific Management in diesem Kontext?
Das Scientific Management (Taylorismus) steht für strikte Hierarchie und Trennung von Planung und Ausführung – das Gegenmodell zur Dezentralisierung im Beyond Budgeting.
- Quote paper
- Julian Yogeshwar (Author), 2013, Internationalisierung mit Hilfe des Beyond Budgeting, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269871