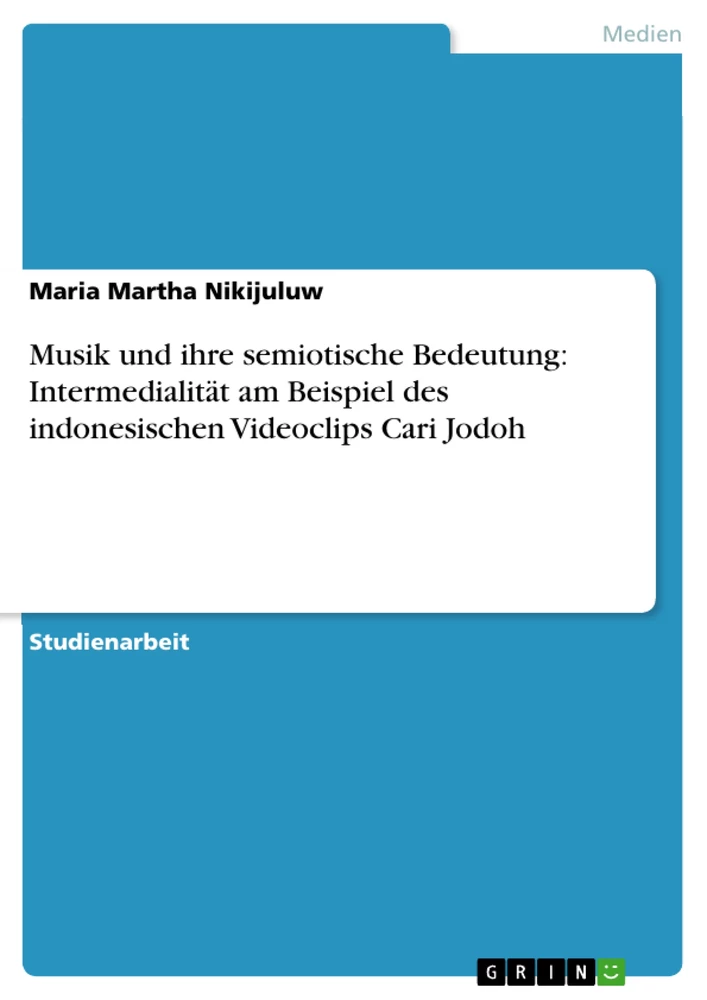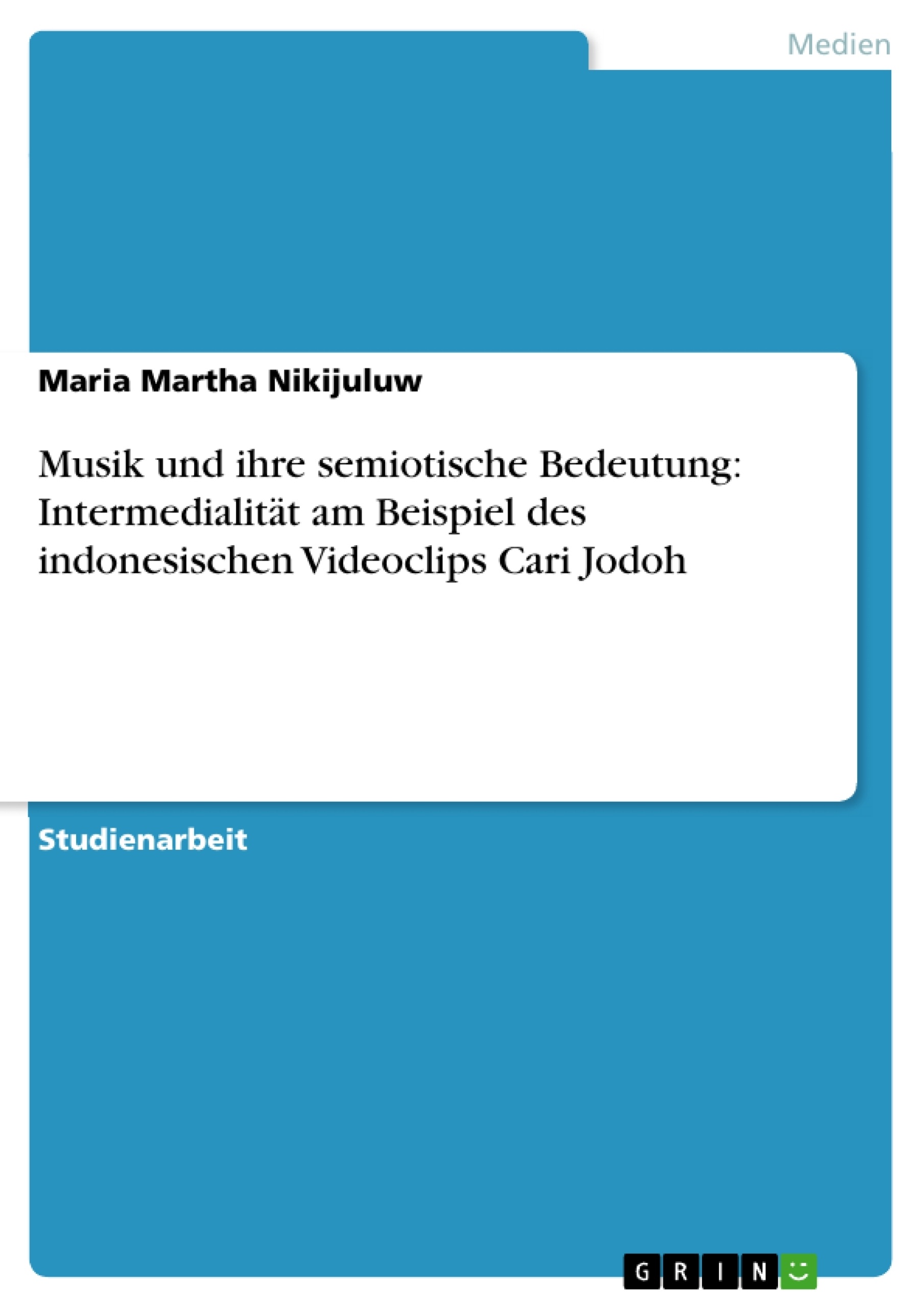Es wird angenommen, dass für die multikulturellen Volksstämme, wie sie beispielweise in Indonesien aufzufinden sind, Musik eine wichtige Rolle spielt. Ausserdem kann die Musik die kulturelle Sicht der Gesellschaft repräsentieren. Unter diesem Kriterium werde ich ein Beispiel aus der indonesischen Musik vorstellen; welche Intermedialität einbezieht und dementsprechend auf die Sprache und Kultur verweist. Zur Erklärung des Phänomens, wie die Konzeption und Aspekte der Musik in Zusammenhang mit Intermedialität stehen, wurde bekanntlich eine ganze Reihe unterschiedlicher Theorienansätze entwickelt. Einerseits ist Musik ein ästhetisches Kunstwerk, andererseits sollte sie auch eine Einheit zu der Lebensweise bauen, um die verschiedenen Aspekte aus der Kultur zu bekräftigen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Musik und Sprache: Definition und Konzeption
2.1 Musik und Sprache
2.2 Interpretation des musikalischen Textes
3. Musik und ihre semiotische Bedeutung; Intermedialität
3.1 Musik und Semiotik
3.2 Intermedialität
3.3 Was ist Intermedialität in der Musik?
4. Eigene Analyse
4.1 Intermediale Analyse am Beispiel des indonesischen Videoclips
Cari Jodoh
4.1.1 Das Lied Cari Jodoh im Vergleich zu No I Can Do
4.1.2 Der Videoclip Cari Jodoh im Vergleich zu No I Can Do
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Anlage:
1. Der Text des Liedes Cari Jodoh und Übersetzung auf Deutsch
2. Der Text des Liedes No I Can Do
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Intermedialität in der Musik?
Es beschreibt das Zusammenwirken verschiedener Medien (z. B. Musik, Text und Video), um eine gemeinsame kulturelle oder ästhetische Botschaft zu vermitteln.
Welches Beispiel wird für indonesische Musik analysiert?
Die Arbeit analysiert den indonesischen Videoclip „Cari Jodoh“ und vergleicht ihn mit dem Lied „No I Can Do“.
Wie repräsentiert Musik die indonesische Kultur?
Musik dient in Indonesien als wichtiges Medium, um die Sichtweisen multikultureller Volksstämme darzustellen und auf Sprache und Traditionen zu verweisen.
Was ist die semiotische Bedeutung von Musik?
Semiotik in der Musik befasst sich mit Musik als Zeichensystem, das über Klänge hinaus kulturelle und soziale Bedeutungen transportiert.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Musik und Sprache?
Ja, die Arbeit definiert Musik und Sprache als verwandte Konzepte und untersucht die Interpretation musikalischer Texte im kulturellen Kontext.
- Quote paper
- Maria Martha Nikijuluw (Author), 2012, Musik und ihre semiotische Bedeutung: Intermedialität am Beispiel des indonesischen Videoclips Cari Jodoh, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269894