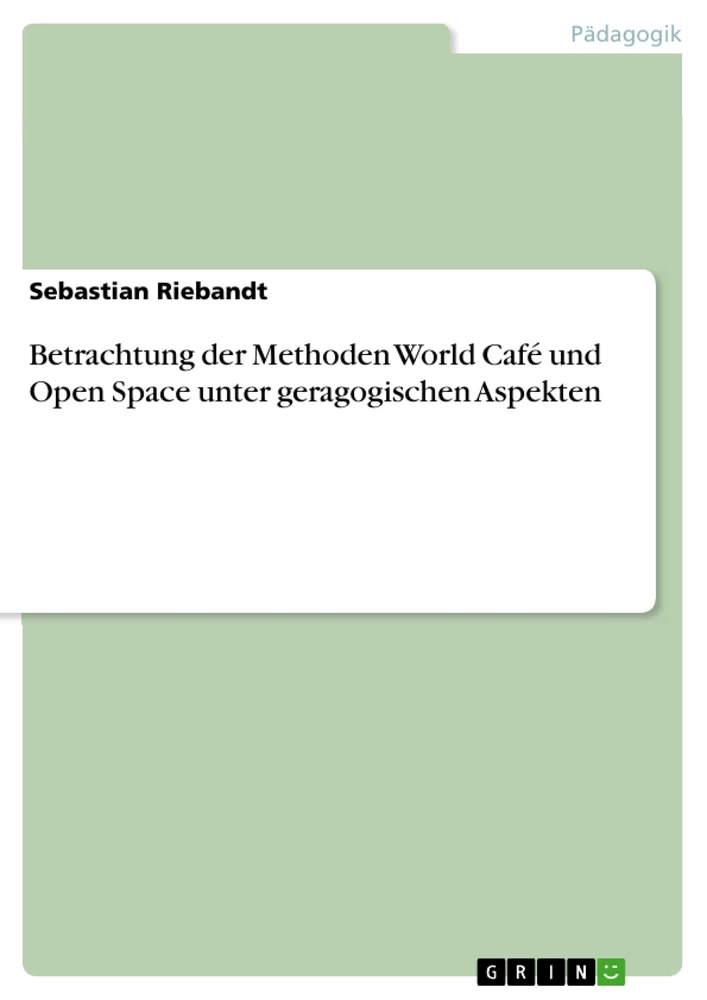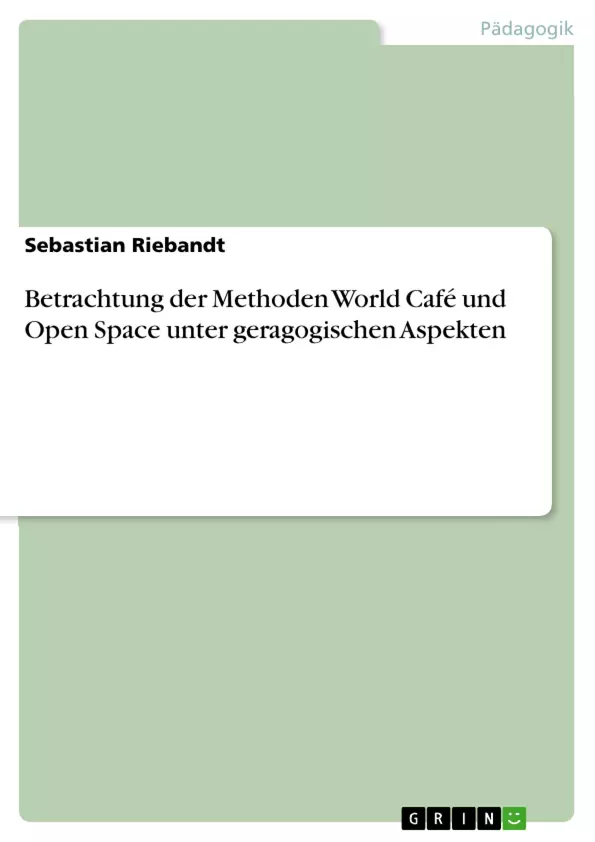Die Partizipation älterer und alter Menschen in politischen und gesellschaftlichen Prozessen gewinnt in einer alternden Gesellschaft zunehmend an Bedeutung, da die Bevölkerung mit einem Alter von über 60 Jahren, 26,6% der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Menschen stellt. Dabei stellt Teilhabe nicht nur ein Feld dar, welches einen bestimmten Teilbereich der Gesellschaft betrifft, sondern stellt ein interdisziplinäres Querschnittsthema dar, das mit Unterstützung der Geragogik einen adäquaten Prozessbegleiter findet. Bestimmte Methoden, die die Teilhabe von Menschen an Entscheidungsprozessen ermöglichen (sollen), sind bereits in der Praxis erprobt worden und finden in mannigfaltigen Gebieten Anwendung. Beispielhaft sind die konsultativ dialogorientierten Beteiligungsinstrumente des World Cafés und des Open Space zu nennen. Im Rahmen dieser Hausarbeit sollen die genannten Methoden (Instrumente) expliziert werden, der theoretische Rahmen benannt und die Methoden unter geragogischen Aspekten analysiert werden. Eine Explikation der Begriffe der politischen Partizipation und der Geragogik wird im Rahmen dieser Arbeit vorangestellt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Begriffsdefinition(en)
1.1 Partizipation
1.2 Gesellschaftliche Partizipation
1.3 Politische Partizipation
1.4 Geragogik
2. Dialogorientierte Beteiligungsinstrumente
2.1 Das World Café
2.1.1 Theoretischer Rahmen
2.1.2 Leitprinzipien des World Cafés
2.1.3 Durchführung
2.2 Der Open Space
2.2.1 Theoretischer Rahmen
2.2.2 Die vier Grundsätze des Open Space
2.2.3 Das Gesetz der zwei Füße
2.2.4 Durchführung
3. Geragogische Methodenbetrachtung
3.1 Lernsituation und Steuerung
3.2 Bildung im Alter und Lerninfrastruktur
3.3 Die Bedeutung von Krankheit
Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das World Café?
Das World Café ist eine dialogorientierte Beteiligungsmethode, bei der Teilnehmer in entspannter Café-Atmosphäre an verschiedenen Tischen über spezifische Fragen diskutieren und ihre Ergebnisse auf Tischdecken festhalten.
Wie funktioniert die Open Space Methode?
Open Space ist eine Konferenzmethode ohne feste Tagesordnung. Teilnehmer bringen ihre eigenen Themen ein und organisieren Arbeitsgruppen selbstständig nach dem „Gesetz der zwei Füße“.
Was versteht man unter Geragogik?
Geragogik ist die Wissenschaft von der Bildung im Alter. Sie befasst sich mit Lernprozessen, Bildungsangeboten und der Unterstützung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen.
Warum ist politische Partizipation im Alter wichtig?
Angesichts des demografischen Wandels stellen über 60-Jährige einen großen Teil der Bevölkerung dar. Ihre Teilhabe sichert, dass ihre Erfahrungen und Bedürfnisse in politische Entscheidungsprozesse einfließen.
Was ist das „Gesetz der zwei Füße“ beim Open Space?
Es besagt, dass jeder Teilnehmer die Freiheit und Verantwortung hat, eine Gruppe zu verlassen, wenn er dort weder lernen noch etwas beitragen kann, um einen Ort zu finden, an dem dies möglich ist.
Welche Vorteile bieten dialogorientierte Methoden für Senioren?
Sie ermöglichen eine barrierefreie Kommunikation auf Augenhöhe, fördern soziale Kontakte und nutzen das vorhandene Erfahrungswissen der älteren Generation für gemeinschaftliche Lösungen.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Riebandt (Autor:in), 2013, Betrachtung der Methoden World Café und Open Space unter geragogischen Aspekten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269900