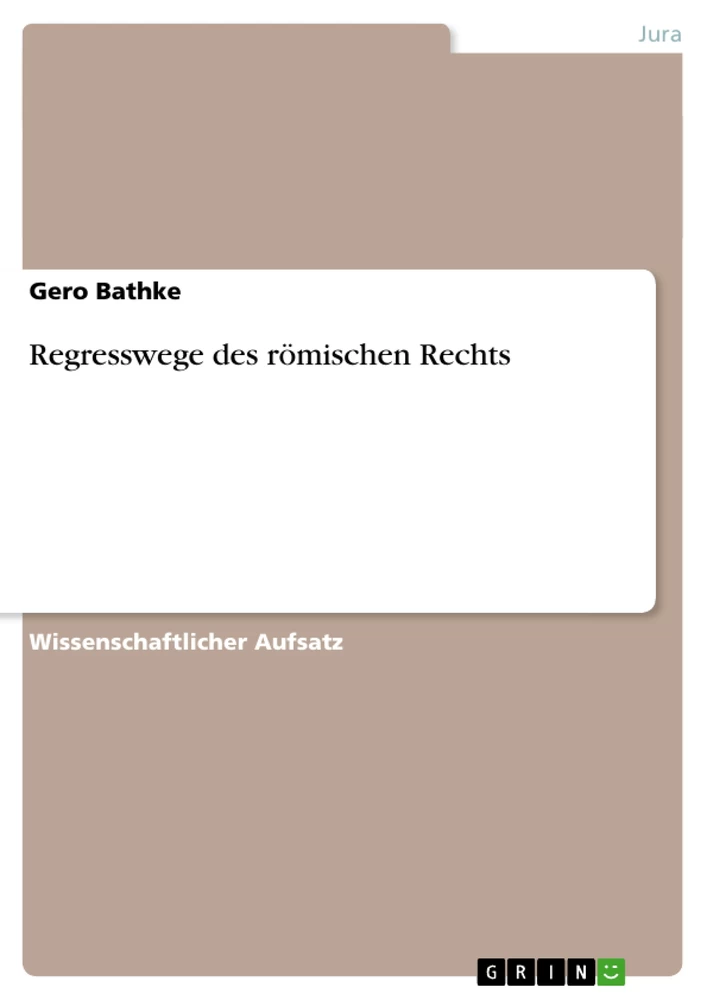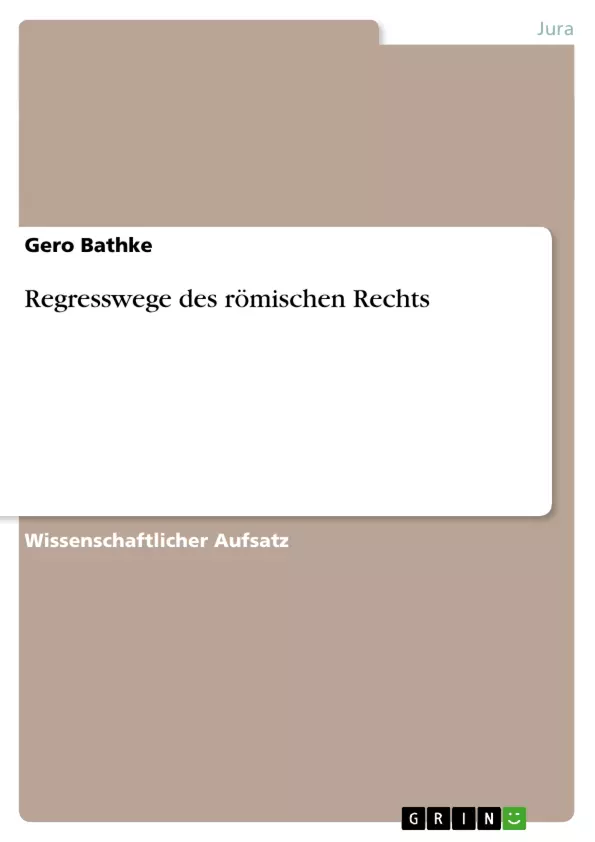Der Begriff Regress leitet sich vom lateinischen Wort ,,regressus", wörtlich übersetzt mit Rückkehr ab. Der heutige juristische Begriff Regress erfasst das in Haftung Nehmen eines Dritten durch einen Gläubiger für eine eigene Zahlungsverpflichtung des Gläubigers. Ein Bedürfnis für einen Regress ist immer dann gegeben, wenn Außenhaftung und interne Lastenverteilung nicht übereinstimmen. Dieses Bedürfnis gab es bereits im römischen Recht.
1. Einleitung
Der Begriff Regress leitet sich vom lateinischen Wort „regressus“, wörtlich übersetzt mit Rückkehr ab.
Der heutige juristische Begriff Regress erfasst das in Haftung Nehmen eines Dritten durch einen Gläubiger für eine eigene Zahlungsverpflichtung des Gläubigers. Ein Bedürfnis für einen Regress ist immer dann gegeben, wenn Außenhaftung und interne Lastenverteilung nicht übereinstimmen[1].Dieses Bedürfnis gab es bereits im römischen Recht.
2. Regress relevante Grundlagen des römischen Rechts
Zur Findung der Wurzeln des Regresses im römischen Recht ist es unabdingbar, insbesondere auch die Besonderheiten des römischen Rechts gegenüber dem heutigen Recht zu kennen. Im römischen Recht konnte ein Gläubiger seine Forderung (Obligation) im Wege einer Klage (actio) geltend machen. Für jede Obligation gab es eine eigene actio. Jede actio war im sogenannten edictum perpetuum aufgeführt und wurde von einem Prätor dem jeweiligen Kläger im Einzelfall gewährt. Die actio war damit Mittel zur Durchsetzung eines subjektiven Rechts, wobei im römischen Recht nicht zwischen dem materiellen Anspruch und seiner prozessualen Durchsetzung unterschieden wurde (sogenanntes aktionenrechtliches Denken).
Wesentlich für das Verständnis des klassischen römischen Rechtes ist das Institut der Klagekonsumption. Demnach konnte eine Rechtsverletzung nur dann erfolgreich gerichtlich geltend gemacht werden, wenn eine Klageart vorhanden war, unter deren Formeln der zu behandelnde Sachverhalt passte. Dabei war der römische Zivilprozess, das sogenannte Formularverfahren, zweistufig aufgebaut. Auf der ersten Stufe trafen sich die Parteien vor dem sogenannten Prätor, um hier den Streitgegenstand zu bestimmen und die gerichtliche Klageart zu definieren. Mit dieser so definierten Klageformel ging es dann weiter beim Richter im zweiten Verfahrensteil, dem Iudex . Dieser zweite Prozessteil war eine Tatsacheninstanz. Der Iudex hatte hier festzustellen, ob die vom Prätor in der Klageformel genannten Voraussetzungen auf den konkreten Fall zutreffen, so dass der Beklagte dann nach der festgelegten Formel verurteilt werden konnte. Die Annahme der durch den Prätor festgelegten Prozessformel durch die Parteien wurde litis contestatio genannt[2]. Mit der litis contestatio ging das ursprüngliche materielle Recht des Klägers unter und wurde stattdessen ersetzt durch das Recht, vom Beklagten die Unterwerfung unter das zukünftige Urteil zu erhalten[3]. Für die hier betrachtete Regresssituation ist noch beachtlich die Drittwirkung solcher Klagen. Mit einer Klage konnte auch die Klage gegen einen Dritten konsumiert werden konnte, etwa bei der Klage des Gläubigers gegen Hauptschuldner und Bürgen, da insoweit nach römischer Auffassung derselbe Streitgegenstand betroffen war. Es befreite somit die Klage des Gläubigers gegen den Hauptschuldner den Bürgen[4]. Dieses Ergebnis, insbesondere dem harten römischen Vollstreckungsrecht geschuldet, erstaunt gleichwohl aus heutiger Sicht, da es dem Gläubiger eine Sicherheit vorenthält (gerade z. B. im Bereich der gesamtschuldnerischen Haftung). Insoweit fand auch im Bereich der Gesamtschulden folgendes statt: Verklagte der Gläubiger einen der Gesamtschuldner, wurden mit der litis contestatio auch die Klagen gegen die übrigen Gesamtschuldner konsumiert, weil auch hier nach römischer Vorstellung sämtliche Klagen denselben Streitgegenstand betrafen[5]. Die vorbenannten Schwierigkeiten sahen auch die römischen Juristen, so dass schließlich Justitian im Jahre 531 per Konstitution die Klagekonsumption insbesondere zwischen Bürgen und Hauptschuldner aufhob[6].
[...]
[1] Selb, Mehrheiten von Gläubigern und Schuldnern (Handbuch des Schuldrechts in Einzeldarstellungen, herausgegeben von Joachim Gernhuber, Band V), Tübignen 1984, S. 23
[2] Kaser, Max/Hackl, Karl, Das Römische Zivilprozessrecht, 2. Auflage, München 1996, § 41 IV.
[3] vgl. Kaser/Hackl, aaO , § 42 III, 43
[4] Schmieder, Philipp, Duo rei, Gesamtobligation im römischen Recht, Berlin 2007, S. 230 ff
[5] Papinian D.45, 1, 116
[6] Schmieder, aaO, S. 91 ff
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Regress" ursprünglich?
Der Begriff leitet sich vom lateinischen "regressus" ab, was wörtlich "Rückkehr" bedeutet. Juristisch beschreibt er das Inanspruchnahme eines Dritten für eine eigene Zahlungsverpflichtung.
Was war die "litis contestatio" im römischen Recht?
Die litis contestatio war die Annahme der Prozessformel durch die Parteien. Sie führte dazu, dass das ursprüngliche materielle Recht unterging und durch das Recht auf Unterwerfung unter das Urteil ersetzt wurde.
Was versteht man unter "Klagekonsumption"?
Dies bedeutete, dass durch die Verklagung eines Schuldners (z.B. des Hauptschuldners) die Klage gegen einen anderen (z.B. den Bürgen) verbraucht sein konnte, da es sich nach römischer Auffassung um denselben Streitgegenstand handelte.
Wie unterschied sich das römische "aktionenrechtliche Denken" vom heutigen Recht?
Im römischen Recht wurde nicht zwischen materiellem Anspruch und prozessualer Durchsetzung unterschieden. Ein Recht existierte nur, wenn es eine entsprechende "actio" (Klageart) im Edikt des Prätors gab.
Wann wurde die Klagekonsumption zwischen Bürgen und Hauptschuldner aufgehoben?
Kaiser Justinian hob die Klagekonsumption in diesem Bereich im Jahr 531 n. Chr. per Konstitution auf.
- Quote paper
- Gero Bathke (Author), 2014, Regresswege des römischen Rechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269905