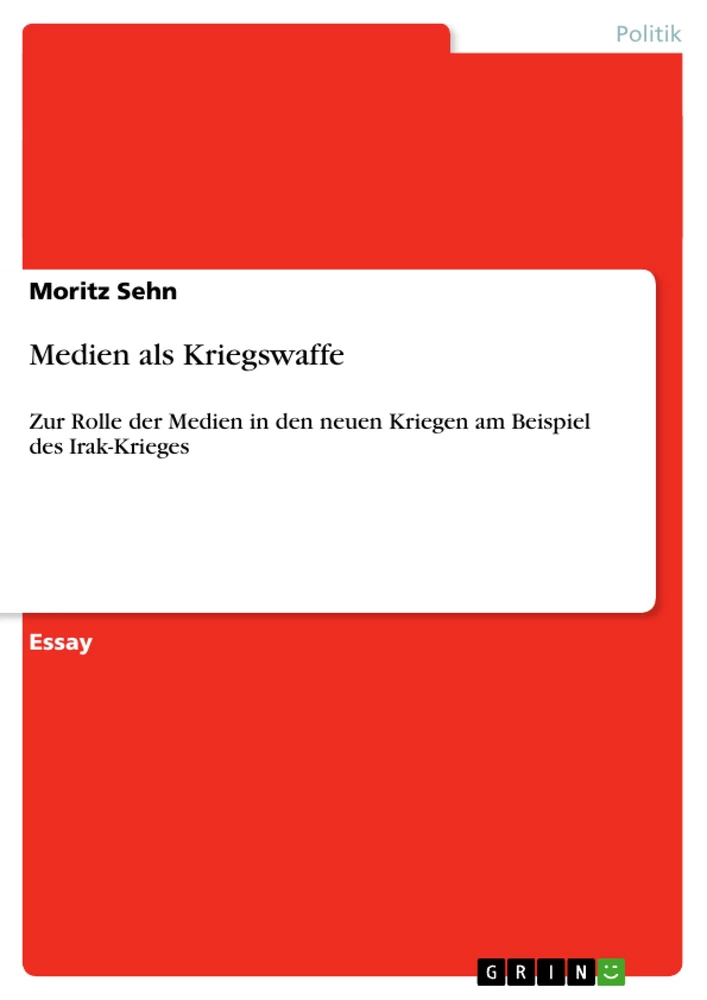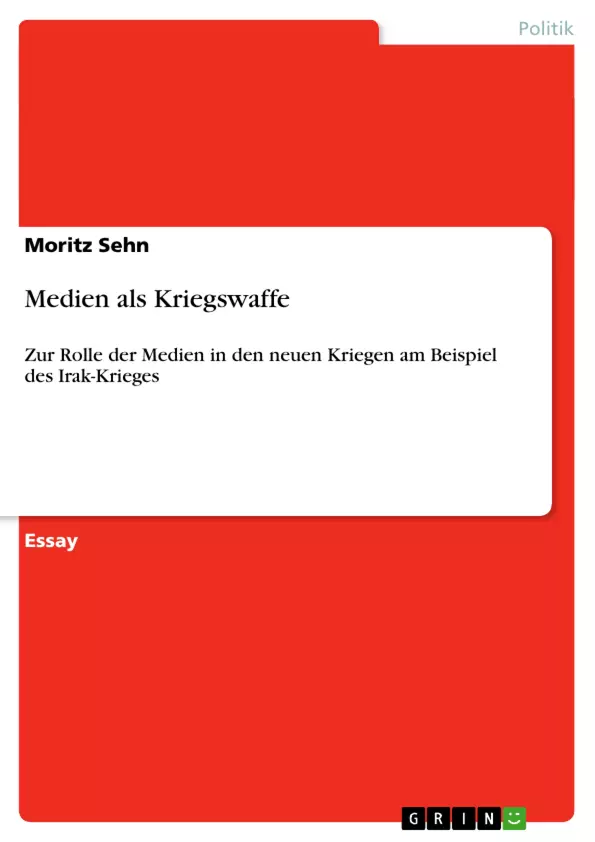Die fortschreitende Modernisierung der Welt umfasst sämtliche Teilbereiche
gesellschaftlichen Lebens – Wissenschaft, Technologie, Gesellschaft. Auch der Krieg,
als gesellschaftliches Phänomen, hat eine Weiterentwicklung vollzogen.
Bei der Auseinandersetzung mit dem Begriff des Krieges gilt die Definition des
Militärtheoretikers Clausewitz als Ausgangspunkt:
„Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres
Willens zu zwingen.“
Mit der Definition Clausewitz‘ geht die Vorstellung einher, dass Krieg prinzipiell nur
zwischen Staaten stattfindet, da diese die einzigen Akteure sind, die einen legitimen
Anspruch auf Gewaltausübung besitzen. Mit den staatlich verfassten Akteuren geht
auch eine gewisse Verrechtlichung einher: Krieg beginnt mit einer Kriegserklärung und
endet z.B. mit der Kapitulation eines Kriegsteilnehmers. So findet eine eindeutige
Abgrenzung von Krieg und Frieden statt. Eine weitere Trennungslinie lässt sich im
Hinblick auf die Bevölkerung der Kriegsteilnehmer ziehen. Es wird unterschieden
zwischen Kombattanten (z.B. Soldaten) und Nicht-Kombattanten (z.B.
Zivilbevölkerung).
Die dargestellte Sichtweise stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist aus heutiger
Perspektive nicht mehr in der Lage, sämtliche Formen des Krieges abzubilden, da sich
die modernen Ausprägungen des Krieges einem „grundlegende[n] Wandel“ vollzogen
haben.
1. Klassische Kriege versus neue Kriege
Die fortschreitende Modernisierung der Welt umfasst sämtliche Teilbereiche gesellschaftlichen Lebens - Wissenschaft, Technologie, Gesellschaft. Auch der Krieg, als gesellschaftliches Phänomen, hat eine Weiterentwicklung vollzogen.
Bei der Auseinandersetzung mit dem Begriff des Krieges gilt die Definition des Militärtheoretikers Clausewitz als Ausgangspunkt:
„Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen.“
(Clausewitz, Carl von: Über die Natur des Krieges. In: ders.: Vom Kriege. Berlin: Ullstein Verlag, 20085. S. 27.)
Mit der Definition Clausewitz‘ geht die Vorstellung einher, dass Krieg prinzipiell nur zwischen Staaten stattfindet, da diese die einzigen Akteure sind, die einen legitimen Anspruch auf Gewaltausübung besitzen. Mit den staatlich verfassten Akteuren geht auch eine gewisse Verrechtlichung einher: Krieg beginnt mit einer Kriegserklärung und endet z.B. mit der Kapitulation eines Kriegsteilnehmers. So findet eine eindeutige Abgrenzung von Krieg und Frieden statt. Eine weitere Trennungslinie lässt sich im Hinblick auf die Bevölkerung der Kriegsteilnehmer ziehen. Es wird unterschieden zwischen Kombattanten (z.B. Soldaten) und Nicht-Kombattanten (z.B.Zivilbevölkerung).
Die dargestellte Sichtweise stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist aus heutiger Perspektive nicht mehr in der Lage, sämtliche Formen des Krieges abzubilden, da sich die modernen Ausprägungen des Krieges einem „grundlegende[n] Wandel“1 vollzogen haben.
Die sogenannten ‚neuen‘ Kriege zeichnen sich durch eine Privatisierung (und damit Beteiligung nicht-staatlicher Akteure), und eine Asymmetrie hinsichtlich der beteiligten Akteure aus: Staatliche und nicht-staatliche Akteure.2
Durch die Beteiligung nicht-staatlicher Akteure wird besonders die ursprüngliche Verrechtlichung geschwächt, da das Völkerrecht nicht auf kriegerische Auseinandersetzungen mit Beteiligung nicht-staatlicher Akteure ausgelegt ist.
Mit der Transformation des Krieges selbst, verändert sich auch die mediale Berichterstattung: von ihrer eigentlichen Aufgabe, der Information der Bevölkerung, hin zu einem Bereich der militärischen Kriegsführung.
2. Entwicklung der medialen Berichterstattung im Krieg
William Howard Russel gilt als der erste Kriegsberichterstatter überhaupt und markiert so den Anfang der professionellen Information über das Kriegsgeschehen. Zuvor waren Berichte heimkehrender Soldaten die einzige Informationsquelle, um Neuigkeiten über das Kriegsgeschehen zu erfahren. Mit Russel etablierte sich erstmals eine Form des Journalismus, die objektiv vom Kriegsgeschehen berichtete – allerdings wurden kritische Berichte mit fehlendem Patriotismus begründet, so dass eine unabhängige und objektive Information der Öffentlichkeit nach wie vor nicht gegeben war. Erst mit der Etablierung der Massenmedien, wie z.B. dem dynamischen Zeitungsmarkt fand eine Tendenz zur tatsächlichen Information statt. Allerdings wurde durch den immensen Konkurrenzdruck der Fokus der Verlage auf die Ökonomie, statt auf journalistische Qualität gelegt, so dass besonders reißerische Artikel über Gerüchte besonders starken Anklang fanden.
Die bewusste Instrumentalisierung der Medien, um den Rückhalt für eine kriegerische Auseinandersetzung zu wahren bzw. erst zu schüren, wurde im 1. Weltkrieg etabliert. Mit der Einführung eines wissenschaftlich arbeitenden Informationsministeriums lieferte Großbritannien das Vorbild für die Errichtung des NS-Propagandaapparates im Sinne Göbbels‘.
[...]
1 Pradetto, August: Neue Kriege. In: Handbuch Militär und Sozialwissenschaft. Hrsg. von S.B. Gareis und P. Klein. Wiesbaden: VS Verlag, 2006. S. 215.
2 Vgl. Münkler, Herfried: Die neuen Kriege. Reinbeck bei Hamburg: Rowolth, 2004. Seite 10f.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Medien im modernen Krieg als Waffe eingesetzt?
Medien dienen heute nicht mehr nur der Information, sondern werden gezielt zur Propaganda, zur psychologischen Kriegsführung und zur Sicherung des Rückhalts in der Bevölkerung instrumentalisiert.
Was unterscheidet "klassische" von "neuen" Kriegen?
Klassische Kriege fanden zwischen Staaten statt; neue Kriege sind oft asymmetrisch, privatisierte Konflikte mit Beteiligung nicht-staatlicher Akteure (Warlords, Terrorgruppen).
Wer war der erste Kriegsberichterstatter?
William Howard Russel gilt als Pionier der Kriegsberichterstattung, der erstmals professionell und kritisch von der Front berichtete.
Wie entwickelte sich die Kriegspropaganda historisch?
Bereits im 1. Weltkrieg wurden wissenschaftlich arbeitende Informationsministerien (z.B. in Großbritannien) geschaffen, die später als Vorbild für den NS-Propagandaapparat dienten.
Was bedeutet "Asymmetrie" im Kriegskontext?
Es beschreibt Konflikte zwischen ungleichen Gegnern (z.B. eine staatliche Armee gegen eine Guerillagruppe), bei denen oft unkonventionelle Mittel und Medien eingesetzt werden.
- Arbeit zitieren
- Moritz Sehn (Autor:in), 2014, Medien als Kriegswaffe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269940