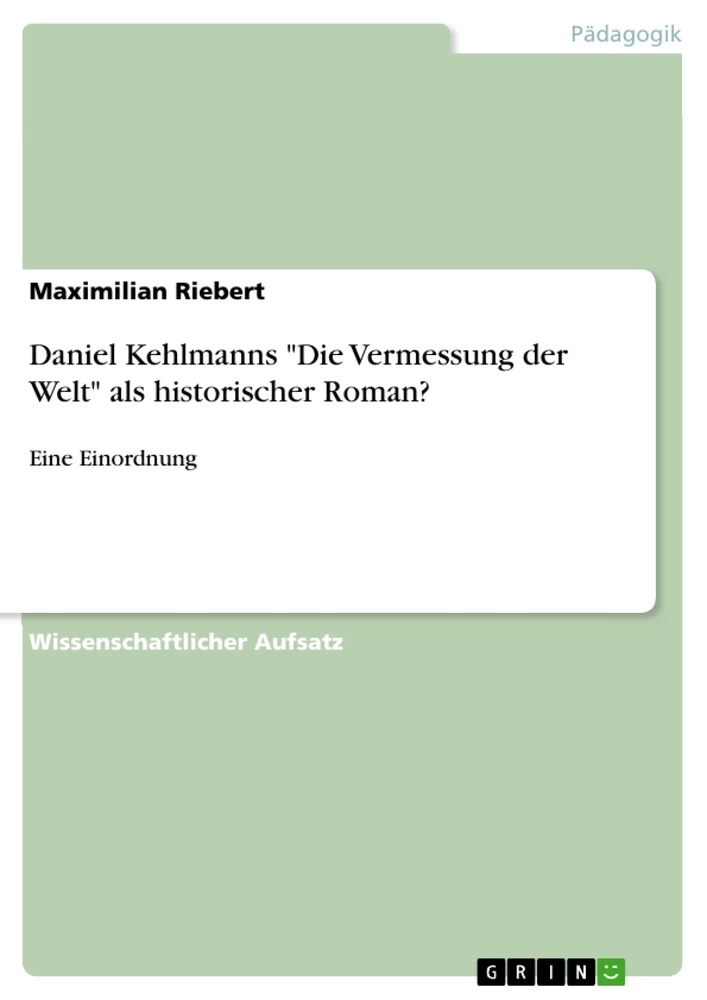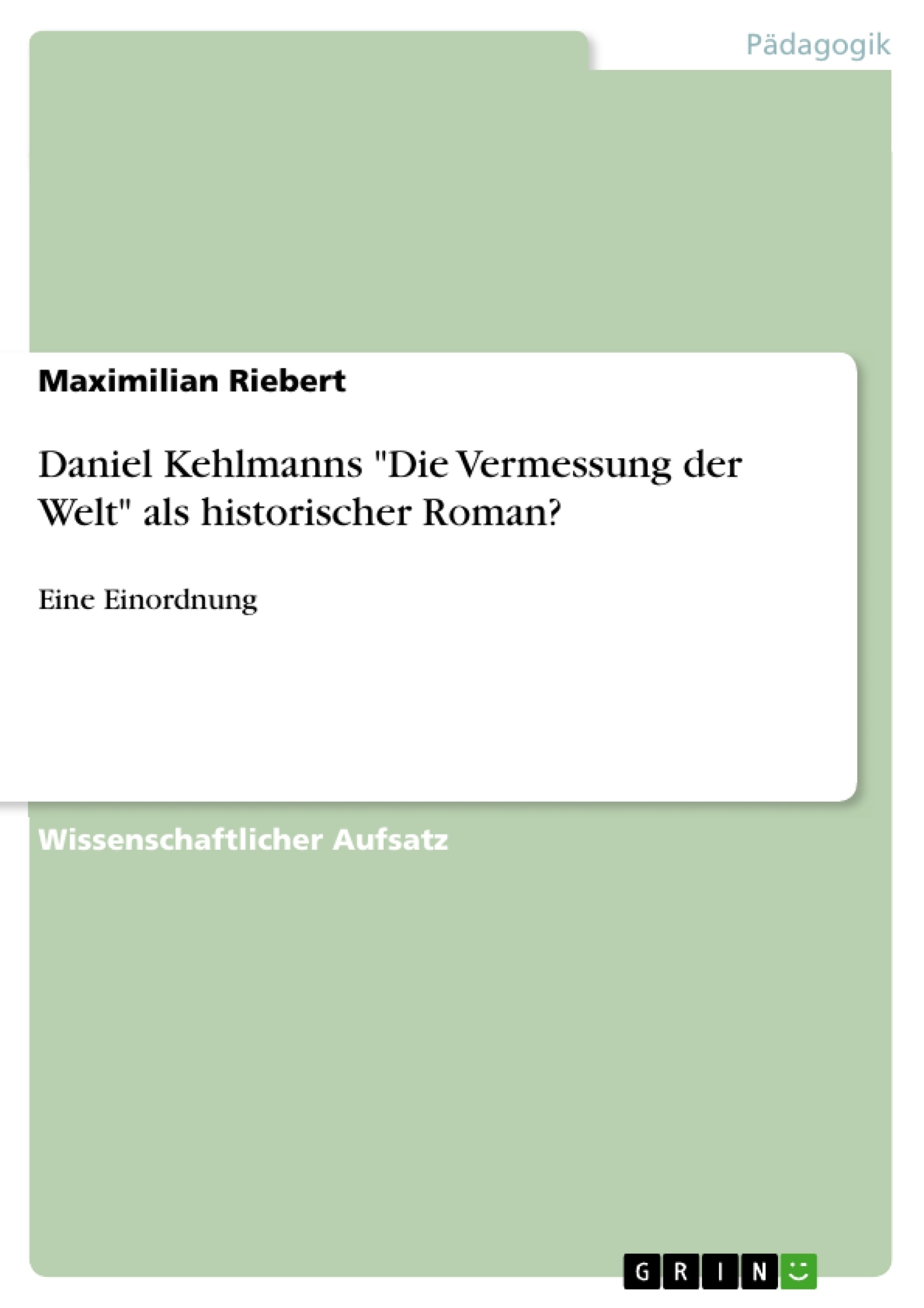Daniel Kehlmann hat mit seinem Roman „Die Vermessung der Welt“ einen Bestseller veröffentlicht, der – ungewöhnlicherweise – auch bei der deutschen Literaturkritik Anklang fand und teilweise überschwänglich gelobt worden ist. Neben der biografischen Darstellung von Carl Friedruch Gauß und Alexander von Humboldt liegt der Wert von Kehlmanns Roman in der Illustration der Zeitumstände: der Strapazen, die eine Expedition wie die von Humboldt mit sich brachte, vor allem aber auch die – wenn auch lakonische – Schilderung der politischen Umbrüche im Europa der Sattelzeit und Restauration.
Mithilfe dieser Themen gelingt es ihm, so stimmen die Kritiker überein, trotz der zeitlichen Distanz zum Dargestellten, „typisch Deutsches“ zu persiflieren, aber auch heutige Technik-Gläubigkeit zu kritisieren, indem er zwei Koryphäen beim Scheitern an der „Vermessung der Welt“ zeigt.
Aufgrund der Handlungszeit des Romans firmiert „Die Vermessung der Welt“ bei sämtlichen Besprechungen unter dem Begriff „historischer Roman“. Der Autor selbst jedoch sagt über seine Arbeit: „das ganze Buch gibt sich im Ton als sachliches historisches Werk, ist jedoch im Grunde nichts weniger als das“. Aufgrund von Alfred Döblins Diktum „Der historische Roman ist erstens ein Roman und zweitens keine Historie.“ möchte man ihn dennoch in der Gattung der historischen Romane verorten, so wie Schoerken sie behandelt und eingeordnet hat.
Diese Ausarbeitung soll zeigen, in welcher Tradition Kehlmanns Roman steht, angefangen von Plutarchs Doppelbiographien bis hin zu Bernhard Setzweins Nietzsche-Biographie „Nicht kalt genug“. Aufgrund dessen sollen Darstellungstechnik, Wirkungsabsicht und -weise der „Vermessung der Zeit“ eingeordnet werden.
Im Zentrum soll abschließend die Frage stehen, inwiefern der Roman Geschichte vermittelt und mit welchen Mittel dies geschieht.
Inhalt
Einleitung
1. Chancen und Risiken der Geschichtsvermittlung durch den historischen Roman
2. Doppelbiographie, kulminierend in Begegnung: „Die Vermessung der Welt“ als ein Sonderfall des historischen Romans
a) Inhaltsangabe des Romans
b) Rezeption von Lesern und Kritikern
c) Versuch einer Einordnung
3. Stichproben zur Arbeitsweise des Autors:
a) Eigenaussagen aus Interviews und Betrachtung autoreferentieller Textpassagen
b) Vergleiche mit historischen Quellen
4. Schlussbewertung
Benutzte Literatur
Quellen
Literatur:
Quellen aus dem Internet:
Kundenrezensionen bei Amazon:
Anhang: Kundenrezensionen von „Die Vermessung der Welt“
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei enthält eine Inhaltsübersicht (Inhalt) mit verschiedenen Abschnitten. Es handelt sich um eine Art "language preview" für ein umfassenderes Dokument.
Welche Themen werden in der "Inhaltsübersicht" behandelt?
Die Inhaltsübersicht behandelt folgende Themen:
- Einleitung
- Chancen und Risiken der Geschichtsvermittlung durch den historischen Roman
- Doppelbiographie, kulminierend in Begegnung: „Die Vermessung der Welt“ als ein Sonderfall des historischen Romans (mit Inhaltsangabe, Rezeption und Einordnung)
- Stichproben zur Arbeitsweise des Autors (Eigenaussagen und Vergleiche mit historischen Quellen)
- Schlussbewertung
- Benutzte Literatur (Quellen, Literatur, Quellen aus dem Internet, Kundenrezensionen bei Amazon)
- Anhang: Kundenrezensionen von „Die Vermessung der Welt“
Was wird über "Die Vermessung der Welt" gesagt?
Ein großer Teil der Inhaltsübersicht widmet sich dem Roman „Die Vermessung der Welt“ und behandelt Aspekte wie eine Inhaltsangabe, die Rezeption durch Leser und Kritiker sowie eine Einordnung des Romans im Kontext des historischen Romans.
Welche Art von Quellen werden im Abschnitt "Benutzte Literatur" aufgeführt?
Der Abschnitt "Benutzte Literatur" enthält verschiedene Arten von Quellen, darunter:
- Quellen
- Literatur
- Quellen aus dem Internet
- Kundenrezensionen bei Amazon
Was ist im Anhang enthalten?
Der Anhang enthält Kundenrezensionen des Romans „Die Vermessung der Welt“.
- Quote paper
- Maximilian Riebert (Author), 2006, Daniel Kehlmanns "Die Vermessung der Welt" als historischer Roman?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270002