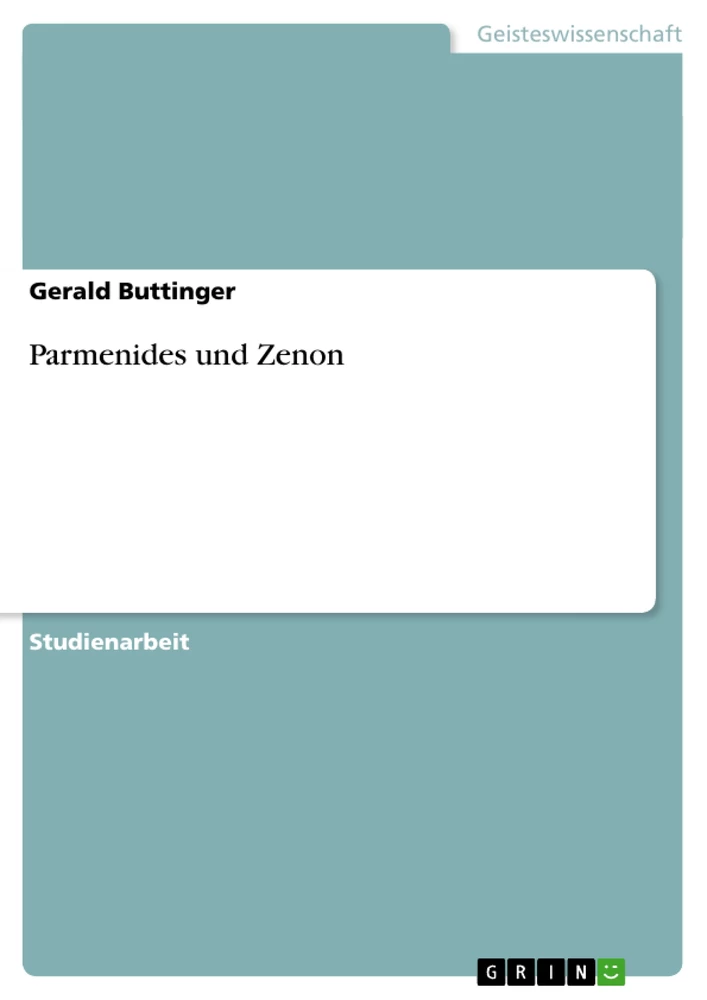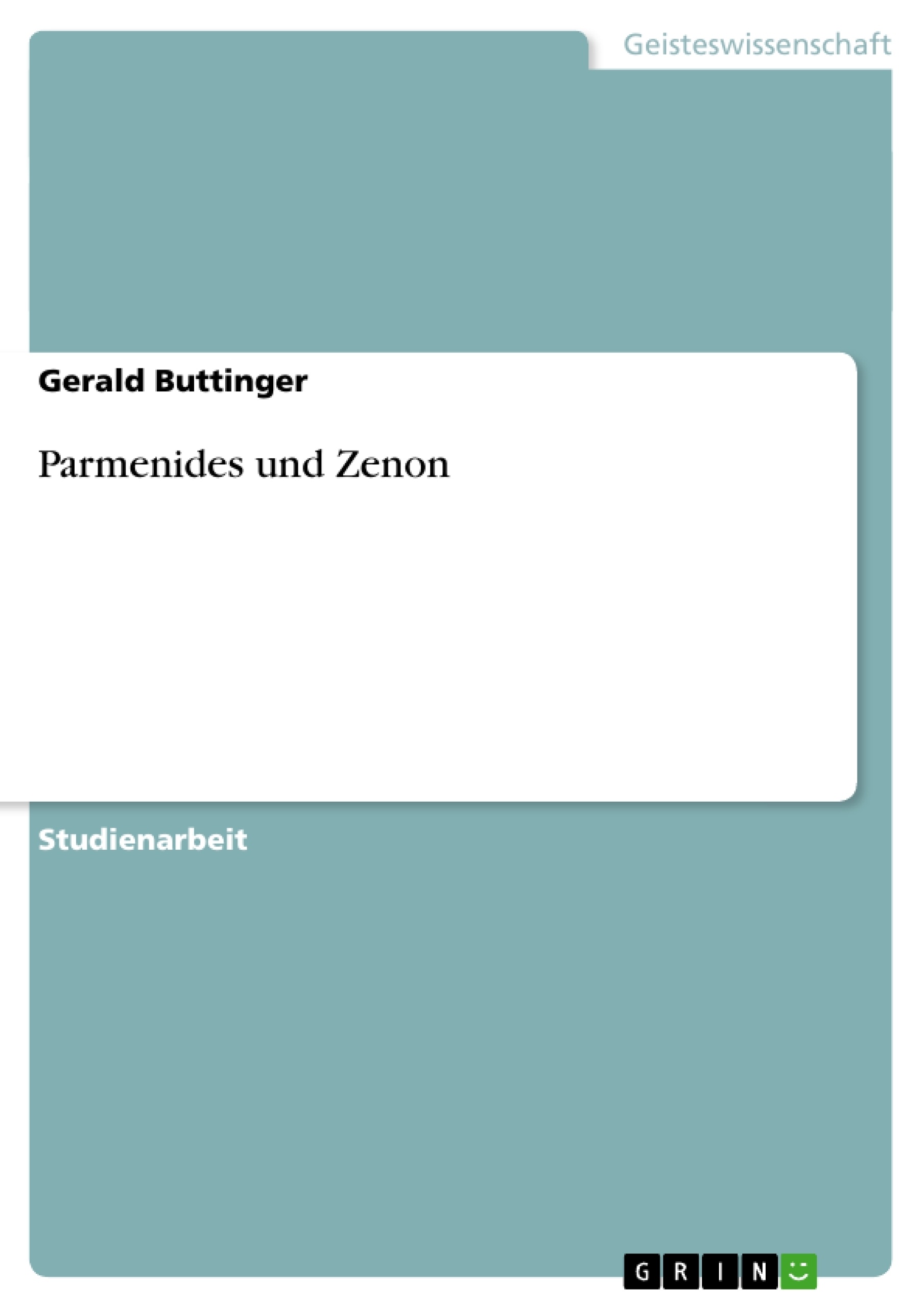Elea befand sich in Unteritalien und wurde in den Jahren 540/539 v. Chr. von ionischen Emigranten aus Phokaia gegründet, die der Perserherrschaft in Kleinasien entgehen wollten. Anfangs eher unbedeutend erlangte die Stadt durch die Gründung mehrerer Philosophieschulen großes Ansehen. 89 v. Chr. wurde die Stadt zum römischen Municipium. Heute sind von Elea nur noch Reste von Terassenanlagen und Stadtmauern zu sehen. (vgl. Brockhaus 1991, S. 600f)
1.2. Die Eleaten
Der erste Vertreter der Eleatischen Schule war Xenophanes (ca. 570-477 v. Chr.). Er war hauptsächlich Religions- und Kulturkritiker und kämpfte vehement gegen die von Hesiod und Homer geschilderten Gottheiten. Den vielen Göttern der Mythologie stellte er eine höchste Gottheit gegenüber, die als eine Einheit alles umfaßt: „Das Eine ist Alles.“ (vgl. Vorländer 1963, S. 24f)
Seine Thesen waren auch zentraler Kern der Philosophie von Parmenides und dessen Schüler Zenon, von denen diese Arbeit handelt. In der Art des Philosophierens unterschieden sich die beiden aber sehr von ihrem Vorgänger. Sie versuchten analytisch und logisch durch Beweise und Gegenbeweise ein ontologisches Weltbild aufzustellen, während Xenophanes in erster Linie Dichter und Künstler war. Parmenides und Zenon führten neue Gedanken in die antike Philosophie ein. Sie gelten als Begründer der Didaktik und der Ontologie. Ihre Beweisführung sorgte für großes Aufsehen bei ihren Philosophenkollegen. Die fast unantastbaren Theorien und besonders die faszinierenden und damals unumstößlichen Paradoxien Zenons forderten die anderen Philosophen besonders heraus, fanden aber auch viele Anhänger. Parmenides‘ Philosophie hat besonders Aristoteles und Platon beeinflußt. Letzterer hat ihm sogar den Dialog „Parmenides“ gewidmet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Stadt Elea
- Die Eleaten
- Parmenides
- Biographisches
- Das Sein
- Der Schein
- Erkenntnislehre
- Zenon
- Biographisches
- Argumente gegen die Vielheit und für die Einzigkeit des Seienden
- Argumente gegen die Bewegung und zugunsten der Unbewegtheit des Seienden
- Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Philosophen Parmenides und Zenon aus Elea und ihren zentralen ontologischen und erkenntnistheoretischen Positionen. Ziel ist es, ihre Lehren nachvollziehbar darzustellen und deren Bedeutung für die Entwicklung der antiken Philosophie aufzuzeigen.
- Das Sein als Einheit und Unveränderlichkeit
- Die Kritik an der Vielheit und der Bewegung
- Die Unterscheidung zwischen Sein und Schein
- Die eleatische Erkenntnislehre
- Der Einfluss von Parmenides und Zenon auf spätere Philosophen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung liefert einen kurzen historischen Überblick über die Stadt Elea und die eleatische Schule, in deren Kontext Parmenides und Zenon ihre philosophischen Arbeiten entwickelten. Sie stellt die Eleaten in die Tradition vorsokratischer Denker und hebt deren methodische Besonderheiten hervor, insbesondere die analytische und logische Beweisführung im Gegensatz zum poetischen Ansatz von Xenophanes. Die Einleitung bereitet den Boden für die detaillierte Betrachtung der Philosophien von Parmenides und Zenon.
Parmenides: Dieses Kapitel widmet sich dem Leben und Werk von Parmenides. Es beleuchtet seine aristokratische Herkunft und seine politische Tätigkeit in Elea. Die Diskussion seiner Lehrmeister und die Frage nach dem Einfluss von Xenophanes und Anaximander werden behandelt. Im Mittelpunkt steht die Analyse seines Lehrgedichts „Von der Natur“, das die Grundlage seiner ontologischen Lehre bildet. Die sieben zentralen Thesen zum Sein werden ausführlich dargestellt und erläutert: das Seiende ist, das Nicht-Seiende ist nicht; das Seiende ist Eines; das Eine ist ohne Mangel; das Eine ist ungeworden und unvergänglich; das Eine ist eine stetige und ungeteilte Kugel; das Eine ruht als Kugel bewegungslos und unverändert; das kugelförmige Eine ist denkend. Die Zusammenfassung thematisiert den Gegensatz zwischen dem Sein und dem Schein sowie Parmenides' Erkenntnislehre mit ihrer Betonung der erfahrungsunabhängigen, metaphysischen Erkenntnis. Das Kapitel zeigt, wie Parmenides versucht, mit seiner Weltanschauung den Phänomenen unserer Erfahrungswelt gerecht zu werden, indem er ein kosmologisches und kosmogonisches System entwickelt.
Zenon: Dieses Kapitel behandelt das Leben und Werk von Zenon von Elea, dem Schüler Parmenides. Es skizziert Zenons vielseitige Talente als Mathematiker, Physiker, Astronom und Rhetoriker. Seine Methode der indirekten Beweisführung, die auf der Erzeugung von Paradoxien beruht, wird erläutert. Der Text analysiert Zenons Argumente gegen die Vielheit und für die Einzigkeit des Seienden sowie seine berühmten Paradoxe gegen die Bewegung: die Dichotomie, Achilleus und die Schildkröte, der ruhende Pfeil und das Stadium. Die Zusammenfassung erklärt die Bedeutung der Paradoxien für die Debatte über die Natur der Bewegung und Vielheit in der Antike und deren nachhaltige Wirkung.
Schlüsselwörter
Parmenides, Zenon, Eleaten, Sein, Nicht-Sein, Einheit, Vielheit, Bewegung, Unbeweglichkeit, Erkenntnislehre, Ontologie, Paradoxien, Indirekter Beweis, Dialektik, Antike Philosophie, Vorsokratiker.
Häufig gestellte Fragen: Eleatische Philosophie (Parmenides und Zenon)
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die Philosophie der Eleaten Parmenides und Zenon. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der ontologischen und erkenntnistheoretischen Positionen beider Philosophen und deren Bedeutung für die antike Philosophie.
Wer waren Parmenides und Zenon von Elea?
Parmenides und Zenon waren Philosophen aus der griechischen Stadt Elea (im heutigen Süditalien). Parmenides, der ältere der beiden, gilt als Begründer der eleatischen Schule. Zenon war sein Schüler und bekannt für seine Paradoxien, die die gängigen Vorstellungen von Bewegung und Vielheit in Frage stellten.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind das Sein (als Einheit und Unveränderlichkeit), die Kritik an der Vielheit und der Bewegung, die Unterscheidung zwischen Sein und Schein, die eleatische Erkenntnislehre und der Einfluss von Parmenides und Zenon auf spätere Philosophen. Der Text analysiert insbesondere Parmenides' Lehrgedicht „Von der Natur“ und Zenons Paradoxien (Dichotomie, Achilles und die Schildkröte, der ruhende Pfeil, das Stadium).
Was ist die eleatische Erkenntnislehre?
Die eleatische Erkenntnislehre betont die erfahrungsunabhängige, metaphysische Erkenntnis. Wahrheit wird nicht durch sinnliche Wahrnehmung erlangt, sondern durch den Gebrauch der Vernunft und logisches Denken. Parmenides argumentierte für die Erkenntnis des Seins durch reines Denken.
Welche Bedeutung haben Zenons Paradoxien?
Zenons Paradoxien, die scheinbar unlösbare Widersprüche aufzeigen, dienten dazu, die gängigen Vorstellungen von Bewegung und Vielheit zu widerlegen und die Einzigkeit des Seins zu stützen. Sie hatten eine nachhaltige Wirkung auf die Debatte über die Natur von Raum, Zeit und Bewegung in der Antike und darüber hinaus.
Wie wird das Sein bei Parmenides beschrieben?
Parmenides beschreibt das Sein als ewig, unveränderlich, einheitlich und unteilbar. Es ist ein "Eines", das weder entstanden noch vergeht und als eine ungeteilte, kugelförmige Einheit betrachtet wird. Das Nicht-Sein wird als undenkbar und nicht existent abgetan.
Welche Methode verwendete Zenon?
Zenon verwendete die Methode des indirekten Beweises, auch reductio ad absurdum genannt. Er leitete aus den Annahmen seiner Gegner Widersprüche (Paradoxien) ab, um diese Annahmen zu widerlegen und seine eigene Position zu stützen.
Welche Rolle spielte die Stadt Elea?
Elea war der Kontext, in dem Parmenides und Zenon ihre philosophischen Arbeiten entwickelten. Die politische und soziale Situation in Elea sowie der Einfluss anderer Denker (wie Xenophanes und Anaximander) sind im Text ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Parmenides, Zenon, Eleaten, Sein, Nicht-Sein, Einheit, Vielheit, Bewegung, Unbeweglichkeit, Erkenntnislehre, Ontologie, Paradoxien, Indirekter Beweis, Dialektik, Antike Philosophie, Vorsokratiker.
- Citation du texte
- Gerald Buttinger (Auteur), 1999, Parmenides und Zenon, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27011