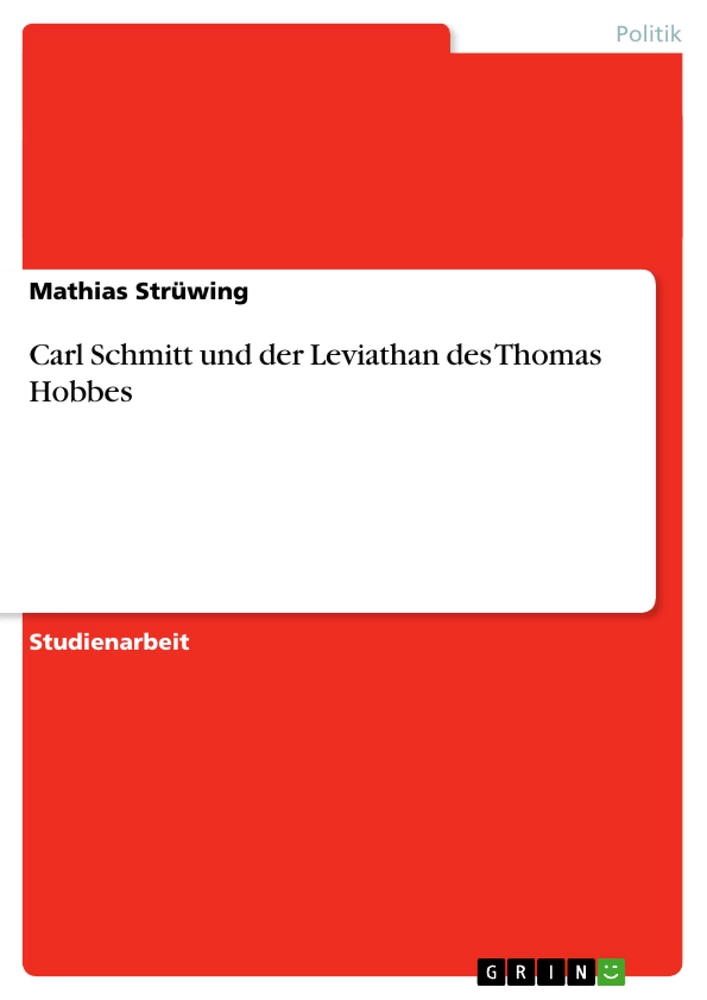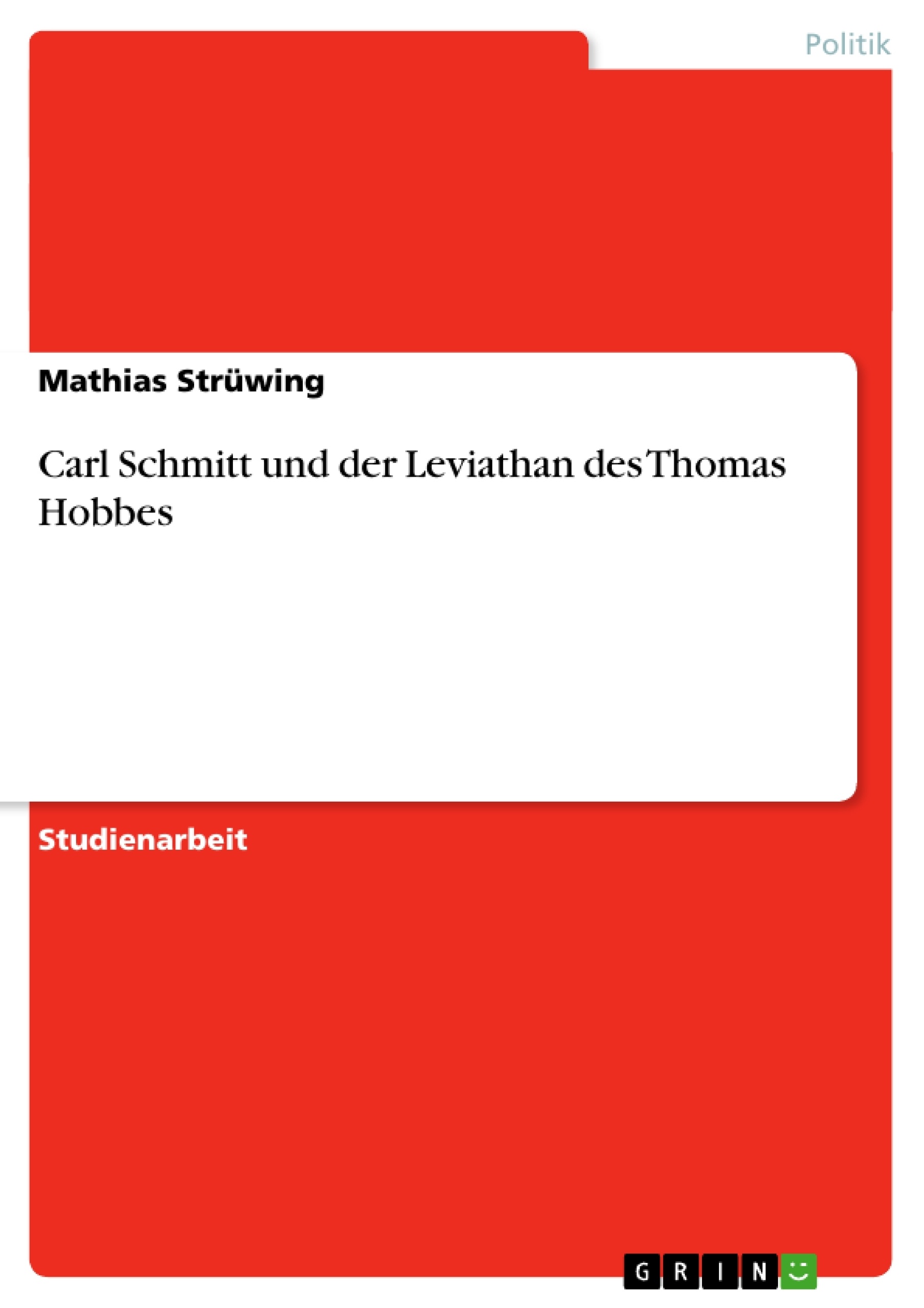1 Einleitung
In der vorliegenden Arbeit werde ich die Staatslehre des Thomas Hobbes und die Kritik daran von Carl Schmitt nebeneinander stellen und kritisch betrachten. Dazu bediene ich mich der Suhrkamp-Ausgabe des hobbesschen Leviathans in der Übersetzung von Iring Fetscher und des Buches „Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes“ von Carl Schmitt. Bedingt durch die Aufgabenstellung kam kaum mehr Literatur zur Anwendung.
Thomas Hobbes war und ist einer der provokantesten Autoren seiner Zeit, insbesondere weil er radikal mit der bisher vorherrschenden Moralphilosophie brach und stattdessen begann, geradezu naturwissenschaftlich zu argumentieren. Seine Werke beschäftigen sich mit Ursache und Wirkung, die Gesellschaft und ihre Elemente folgen dem physikalischen Gesetz der Bewegung. Bewegung bedeutet in diesem Fall Selbsterhaltung, das zentrale Motiv des hobbesschen Menschen. Sein folgenreichstes Werk ist der Leviathan, eine Abhandlung über die Geburt eines totalitären Staates, die Grundlagen seiner Existenz, seine Form und seine Gewalt.
Carl Schmitt, einer der führenden Rechtstheoretiker nach dem Ersten Weltkrieg, wurde besonders bekannt durch eine Staatslehre, die für die Notwendigkeit einer starken staatlichen Autorität eintrat und sich für einen totalitären Staat aussprach. Er rechtfertigte damit auch das Dritte Reich und ihre Führerphil osophie. Als bekennender Nationalsozialist und Antisemit machte er dort schnell Karriere und bekleidete viele wichtige Posten.
Bei Thomas Hobbes findet Carl Schmitt viele Parallelen zu seinem Staatsentwurf. Der Philosoph von Malmesbury ist für ihn: “[…]der echte Lehrer einer großen politischen Erfahrung; einsam wie jeder Wegbereiter; verkannt, wie jeder, dessen politischer Gedanke sich nicht im eigenen Volk verwirklicht; ungelohnt, wie der, der ein Tor öffnet, durch das andere weitermarschieren[…]“ (Schmitt 1938: 132) Aber diese Bewunderung ist nicht einseitig. I n seinem Buch „Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes“ analysiert er dieses Werk, in dem er den Werdegang der dort beschriebenen Staatskonstruktion durchspielt. Dabei treten für ihn die Unzulänglichkeiten zu Tage, die letztendlich den Leviathan zum Scheitern verurteilen.
Im Rahmen dieser Ausarbeitung stelle ich zunächst die Grundlage für Schmitts Werk dar, die anthropologischen Grundlagen des hobbesschen Staates und das darauf aufbauenden Staatskonstrukt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thomas Hobbes' Leviathan
- Der Mensch nach Hobbes
- Der Naturzustand
- Der Staat
- Carl Schmitts Leviathan
- Schluss
- Literaturverzeichnis
- Zusammenfassung/Abstract
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Staatslehre von Thomas Hobbes und der Kritik von Carl Schmitt an dieser. Die Arbeit analysiert den Leviathan von Hobbes und untersucht die Kritik Schmitts an der Staatskonstruktion und deren Mängel.
- Die anthropologischen Grundlagen des hobbesschen Staates
- Das Staatskonstrukt nach Hobbes
- Schmitts Kritik an der souverän-repräsentativen Person
- Schmitts Kritik am Staat
- Die Einordnung der Schmittschen Kritik in seinen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit stellt die Staatslehre von Hobbes und die Kritik von Schmitt gegenüber. Die Hauptaussage ist, dass die Staatslehre von Hobbes als eine der ersten modernen Staatslehren von Carl Schmitt kritisiert wurde.
Thomas Hobbes' Leviathan
Die Arbeit erläutert die anthropologischen Grundlagen des hobbesschen Staates und das darauf aufbauende Staatskonstrukt. Hobbes' Vorstellung vom Menschen im Naturzustand, die Notwendigkeit eines starken Staates und dessen Funktionsweise werden dargestellt.
Schlüsselwörter
Staatslehre, Thomas Hobbes, Leviathan, Carl Schmitt, Naturzustand, Staat, Souveränität, Repräsentation, Kritik, politische Theorie, Ideengeschichte
Häufig gestellte Fragen
Was symbolisiert der "Leviathan" bei Thomas Hobbes?
Der Leviathan steht für den absolutistischen, totalitären Staat, der durch einen Gesellschaftsvertrag geschaffen wird, um Frieden und Sicherheit zu garantieren.
Welche Kritik übt Carl Schmitt an Hobbes' Staatslehre?
Schmitt analysiert Unzulänglichkeiten in der hobbesschen Konstruktion, insbesondere die Trennung von innerer und äußerer Freiheit, die den Staat letztlich schwächen könnten.
Wie beschreibt Hobbes den Naturzustand?
Der Naturzustand ist geprägt vom "Kampf aller gegen alle", in dem das Leben des Menschen einsam, armselig und kurz ist, was die Notwendigkeit eines Souveräns begründet.
Warum gilt Hobbes als Wegbereiter der modernen Staatslehre?
Weil er radikal mit der Moralphilosophie brach und den Staat naturwissenschaftlich-physikalisch als Mechanismus zur Selbsterhaltung begründete.
In welchem Kontext steht Carl Schmitts Bewunderung für Hobbes?
Schmitt nutzte Hobbes' Theorien zur Rechtfertigung einer starken staatlichen Autorität und sah Parallelen zu seinem eigenen totalitären Staatsentwurf.
- Quote paper
- Mathias Strüwing (Author), 2004, Carl Schmitt und der Leviathan des Thomas Hobbes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27032