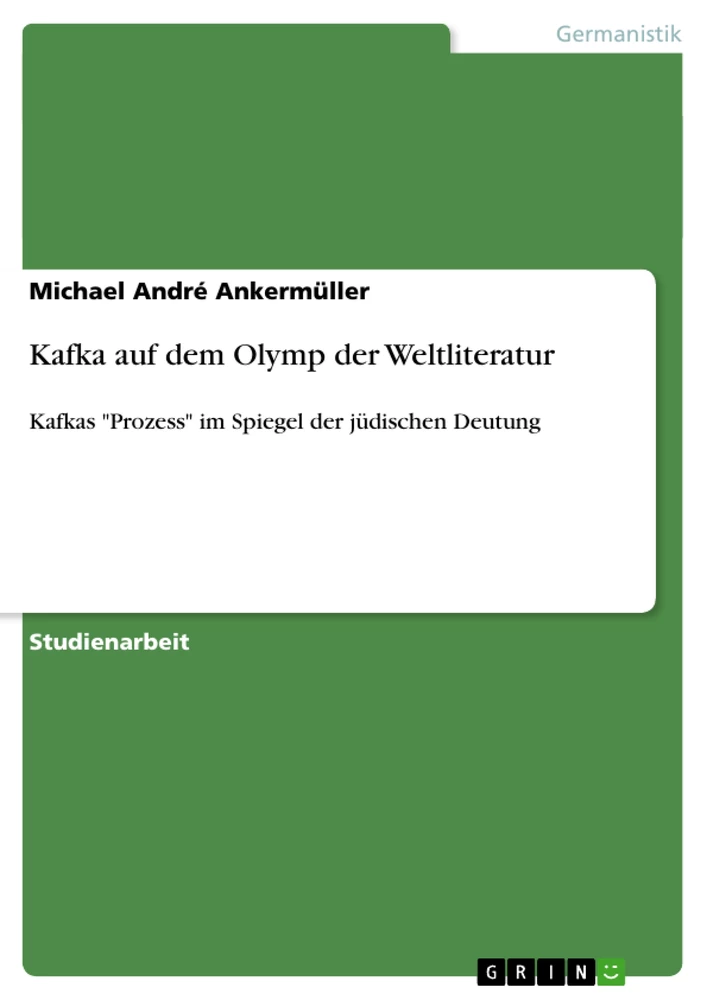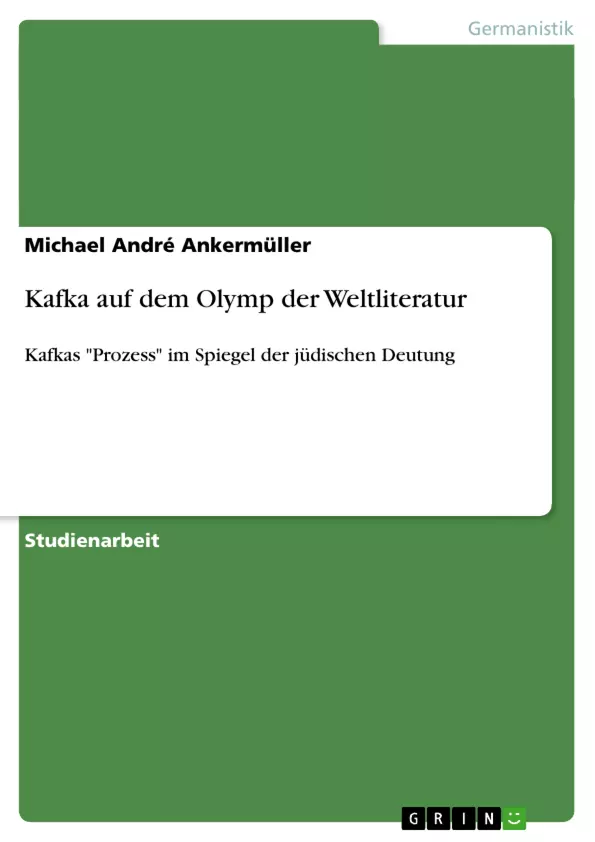Gibt es Klassiker in der Literatur, die sich überholt haben? Kann man behaupten, dass Weltliteratur völlig unabhängig von Moden, Zeiten und Geschmack ist?
Ich denke nicht. Denkt man an einzelne Werke, die man in der Schule verpflichtend lesen musste, stellen einem sich schnell alle Haare zu Berge. Auch Franz Kafka gehört mit Sicherheit mit seinem „Prozess“ oder „Der Verwandlung“ zu einem der weniger beliebten Autoren in der Oberstufe. Dennoch darf Kafka auf keinen Fall aus dem Kanon der Weltliteratur und den Lehrplänen des Gymnasiums verschwinden beziehungsweise gestrichen werden. Kann es in Deutschland im frühen 21. Jahrhundert einen Literaturkanon ohne Kafka geben? Offenkundig und mit guten Gründen „Nein“! Der Autorname Kafka ist kein Name wie jeder andere. Tatsächlich (...) gibt es zumindest im Kanon der deutschsprachigen Literaturen keinen Namen, der ähnlich funktioniert wie dieser. (...) Der Name Kafka verweist, um nur einige Züge hervorzuheben, auf eine Ikone des unendlich Rätselhaften und aufklärbar Tiefgründigen, die dennoch unmittelbare Evidenz zu stiften vermag. Kafka verweist weiter auf einen reichen Bestand biographisch, geographisch und nicht zuletzt ikono(photo)graphisch gegründeter Legenden, in denen der Autor selbst als mit unverkennbarem Sex-Appeal ausgestatteter Poster-Boy eines radikal konsequenten Außenseitertum anzutreten hat.
Inhaltsverzeichnis
1. Franz Kafka und wieso gerade er einen Platz an der Sonne der Weltliteratur verdient hat?
2. Franz Kafka und Kafkas „Prozess“ im Spiegel der jüdischen Deutung
3. Literaturverzeichnis
1. Franz Kafka und wieso gerade er einen Platz an der Sonne der Weltliteratur verdient hat?
Gibt es Klassiker in der Literatur, die sich überholt haben?
Kann man behaupten, dass Weltliteratur völlig unabhängig von Moden, Zeiten und Geschmack ist? Ich denke nicht. Denkt man an einzelne Werke, die man in der Schule verpflichtend lesen musste, stellen einem sich schnell alle Haare zu Berge. Auch Franz Kafka gehört mit Sicherheit mit seinem „Prozess“ oder „Der Verwandlung“ zu einem der weniger beliebten Autoren in der Oberstufe. Dennoch darf Kafka auf keinen Fall aus dem Kanon der Weltliteratur und den Lehrplänen des Gymnasiums verschwinden beziehungsweise gestrichen werden.
Kann es in Deutschland im frühen 21. Jahrhundert einen Literaturkanon ohne Kafka geben? Offenkundig und mit guten Gründen „Nein“!
„ Der Autorname Kafka ist kein Name wie jeder andere. Tatsächlich ( … ) gibt es zumindest im Kanon der deutschsprachigen Literaturen keinen Namen, derähnlich funktioniert wie dieser. ( … ) Der Name Kafka verweist, um nur einige Züge hervorzuheben, auf eine Ikone des unendlich Rätselhaften und aufklärbar Tiefgründigen, die dennoch unmittelbare Evidenz zu stiften vermag. Kafka verweist weiter auf einen reichen Bestand biographisch, geographisch und nicht zuletzt ikono(photo)graphisch gegründeter Legenden, in denen der Autor selbst als mit unverkennbarem Sex- Appeal ausgestatteter Poster- Boy eines radikal konsequenten Außenseitertum auzutreten hat.1 Gibt es also literarische Inhalte von absoluter überragender Bedeutung, deren obligatorischer Charakter nicht in Zweifel zu ziehen ist? Scheinbar „Ja“, allerdings nur scheinbar. Denn warum ist Kafka für die deutsche Literatur so wichtig?
Offenbar existiert eine kulturelle Selbstverständlichkeit, eine gesellschaftliche Vereinbarung, dass die nachwachsende Generation sich mit Kafka beschäftigen und dabei- innerhalb eines bestimmten Spielraums, durch Kafkas kafkaeskes Schreiben, denken lernen muss oder vielmehr soll. Kafka gehört definitiv zu den großen kanonischen Inhalten der deutschsprachigen Literatur und ist nicht nur eine Frage persönlichen Geschmacks.
Diese unfassbare Tiefe, in die man fällt, wenn man beginnt, sich auf Kafka einzulassen ist unbeschreiblich. Ähnlich wie „ Der Prozess“ erscheint es, wenn man sich mit Kafka auseinandersetzt. Ständig ist man auf der Suche nach dem Sinn, welcher hinter den Worten Kafkas steht, so wie Josef K. versucht in seinem Prozess den Grund seiner Anklage zu erkennen und sich zu verteidigen.
Kafkas Literatur ist sowohl phantastisch als auch zugleich brutal realistisch, humorvoll und erschreckend zugleich. Das unglaublich ästhetische, konkrete, voll von Wiedersprüchen geprägte Schreiben Kafkas ist unbeschreiblich.
Nicht vielen Autoren gelingt es, durch Sätze einen gedanklichen Irrgarten entstehen zu lassen, in dem man sich nur verlaufen kann und alles Erdenkliche dafür tun muss, um von dort wieder herauszufinden. Leichter getan, als gesagt. Sobald man die erste richtige Abzweigung in Kafkas Irrgarten genommen hat, stehen unendlich weitere Möglichkeiten zum Weiterlesen beziehungsweise Weitergehen zur Wahl. Entscheidet man sich für den einen Weg und lässt dabei die anderen mögliche Wege außer Acht, wird man wohl wichtige Informationen, um Kafka zu verstehen vernachlässigen und befindet sich wieder an der Ausgangsposition und muss von Vorne anfangen. Demnach ist es vielleicht sogar besser, es sich im Irrgarten Kafkas so gemütlich wie möglich zu machen. Wenn man einmal damit begonnen hat, nicht mehr den Ausgang finden zu wollen, das heißt die absolute Interpretation Kafkas, sondern den Text als Text auf sich wirken zu lassen ist man auf dem richtigen Weg. Gerade deshalb ist Kafka so unglaublich unbeliebt und ungeliebt in der Schule geworden, weil das Wiederkauen von bestehenden Interpretationen, die in der Sekundärliteratur vorgebetet werden, keinen Spaß macht.
Ein Appell an alle Lehrer: Es gibt nicht den richtigen Schlüssel um das Schloss Kafka aufzusperren, sondern unzählige. Die Pflicht besteht vielmehr darin, mehrere Schlüssel auszuprobieren. Oder macht es etwa Spaß, einem Zauberer zuzuschauen, der seine Zaubertricks verrät, bevor er beginnt zu zaubern?
Und ja, genau das legitimiert Kafkas Position im Kanon der Weltliteratur und macht ihn so präsent. Kafka wird niemals von der Literatur überholt werden, zumal Lesen trotz Playstation und 3D-Kino ein fester Bestandteil unserer Kultur bleiben wird. Die vorliegende Arbeit möchte sich nur einer möglichen Herangehensweise an das Romanfragment der Prozess nähern. Sie möchte eines der zentralen Deutungsmotive vorstellen. Die Arbeit konzentriert sich auf den jüdischen Deutungsaspekt, wobei hier bereits auf gar keinen Fall der (auto-)biographische Deutungsaspekt Kafkas vernachlässigt werden darf.
2. Franz Kafka und Kafkas „Prozess“ im Spiegel der jüdischen Deutung
Es lässt sich nur schwer abstreiten, dass Franz Kafka zweifellos zu den weltweit meistgelesenen und schleierhaftesten deutschsprachigen Autoren unserer heutigen Zeit gehört. Der Gang in der Bibliothek durch die Regalmeter zahlloser Veröffentlichungen über Kafka betont seine konstante Aktualität.
Dieser zweite vorliegende Abschnitt versucht sich der Frage anzunähern, welche jüdischen Motive in Franz Kafkas Prozess zu finden und zu interpretieren sind? Eine einseitige, jüdische Interpretation des Werkes ist eigentlich aus der Sicht der Kafka Forschung unzulässig, jedoch ist eine „vollständige“ Interpretation in der vorliegenden Arbeit nicht möglich und würde den Rahmen gänzlich sprengen und doch wieder an den Anfang zurückführen.
Franz Kafka schrieb in Zeiten weltanschaulicher Kontroversen um Judentum, Zionismus und der jiddischsprachigen Welt des Ostjudentums. Das Judentum war existentiell für das schriftstellerische Schaffen Kafkas, auch wenn es niemals eindeutig in seinem Werk zur Sprache kommt. Es ist nicht Thema, nicht Motiv oder Stoff, der von ihm zum Gegenstand literarischer Darstellung gemacht wird- es ist selbst Literatur oder doch zumindest Bedingung der Literatur. Es bleibt eine unbekannte Größe und soll es auch bleiben.2
Das Judentum und Franz Kafka sind in der Tat ein schwieriges Thema, jedoch für die Kafka Forschung ein zentrales und ausschlaggebendes Thema. Natürlich weiß man, dass Kafka Jude war, wie wichtig aber die jüdische Kultur des Dichters für sein Leben und Werk war, weiß man nicht so genau.3 Die Lebenswelt von Franz Kafka war jüdisch. Aufgewachsen in einem jüdischen Umfeld verbrachte er sein Leben ausschließlich mit Juden. Kafka gehörte zu jener Generation von Juden, die sich mit dem Auflösungsprozess des befindendem Judentum der Eltern auseinandersetzen musste. Ihm war klar, dass er Jude war- welcher Sinn hinter diesem Jude Seins lag, war ihm- wie vielen anderen- unklar.4
Genau dieser Zusammenhang, wie etliche andere Faktoren bestimmen die Interpretation von Kafkas Prozess mit. Jedoch wird dieser Kontext als interpretationsrelevant im Lauf der Lesegeschichte mit unterschiedlicher Intensität herangezogen und konkurriert mit anderen Kontexten seiner Werkbiographie. Kafka als rein jüdischen Autor zu sehen, wird ihm nicht gerecht. Mal mehr, mal weniger gilt sein Schaffen als „jüdisch“.5
Immer sollte man sich vor Augen halten, dass zwar die biographischen Daten und autobiographischen Texte vielfach Zeugnis von Kafkas intensiver Auseinandersetzung mit Judentum, Zionismus und dem Ostjudentum schreiben- und damit immer auch mit dem Antisemitismus und Nationalismus seiner Jahre, dennoch solch erwähnte präzise Kontexte im Prozess nicht eindeutig zu finden sind.6
Kafkas Lektüre beweist fast durchgehend ein anhaltendes Interesse an jüdischen Themen, an jiddischer Literatur, an jüdischer Religion, an religionsgeschichtlichen und religionsphilosophischen Werken überhaupt. Für den Interpreten bedeutet das, dass er diese Mitte kennen muss, um ansatzweise das Mysterium Kafka entschlüsseln zu können. In der Regel fokussieren jüdische Deutungen jüdisch-religiöse Fragestellungen und Themen, wie sie in Kafkas Texten regelmäßig auftauchen, zum Beispiel die Suche nach verlorenen jüdischen Ursprüngen oder nach jüdischer Authentizität, nach dem Gesetz und seinen Modalitäten und nach Quellen der Reinheit oder einer wahren jüdischen Existenz.
[...]
1 Brecht, C.: Ein Fall für sich, in: Claudia Liebrand / Franziska Schößler (Hg.): Textverkehr. Kafka und die Tradition, Würzburg, 2004, S. 18.
2 Baioni, G.: Kafka- Literatur und Judentum, Stuttgart, 1994, S. 3.
3 Grözinger, E.: Franz Kafka und das Judentum, Frankfurt am Main, 1987, S.7.
4 Ebd., S. 10-11.
5 Engel, M. / Auerochs, B. (Hg.): Kafka Handbuch- Leben- Werk- Wirkung, Stuttgart, 2010, S. 50.
6 Ebd., S. 54.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Franz Kafka ein fester Bestandteil der Weltliteratur?
Kafka gilt als Ikone des Rätselhaften und Tiefgründigen. Sein Werk ist zeitlos, da es existenzielle Fragen des Menschseins auf eine Weise anspricht, die auch im 21. Jahrhundert relevant bleibt.
Was bedeutet der Begriff "kafkaesk"?
"Kafkaesk" beschreibt eine Situation, die auf unheimliche Weise bürokratisch, absurd und bedrohlich wirkt, ähnlich wie die Erlebnisse der Protagonisten in Kafkas Romanen.
Welche Rolle spielt das Judentum in Kafkas Werk "Der Prozess"?
Obwohl es nicht explizit genannt wird, sehen viele Forscher jüdische Motive wie die Suche nach dem Gesetz, die Auseinandersetzung mit Schuld und die Suche nach Authentizität als zentral an.
Warum haben Schüler oft Schwierigkeiten mit Kafka?
Die Vieldeutigkeit seiner Texte und das oft im Unterricht praktizierte "Wiederkauen" vorgegebener Interpretationen können den Zugang erschweren, wenn der Text nicht als offenes Rätsel erlebt werden darf.
Gibt es eine "richtige" Interpretation von Kafkas Texten?
Nein, es gibt unzählige Schlüssel zu seinem Werk. Die Arbeit plädiert dafür, den Text auf sich wirken zu lassen, statt nach einer einzigen, absoluten Wahrheit zu suchen.
- Citation du texte
- B.A. Michael André Ankermüller (Auteur), 2011, Kafka auf dem Olymp der Weltliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270346