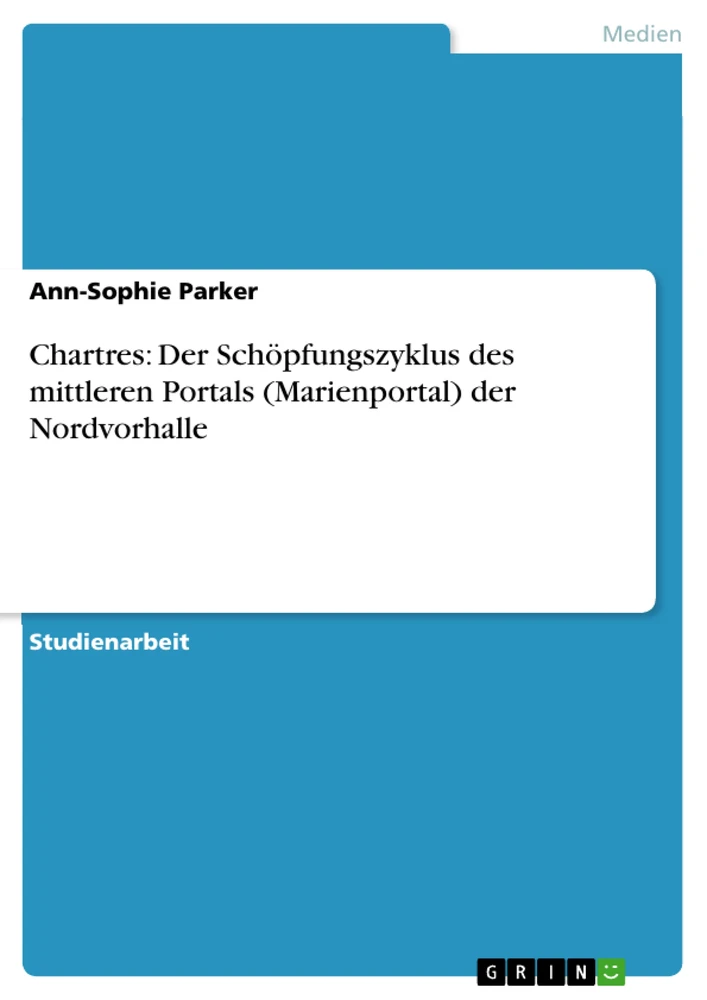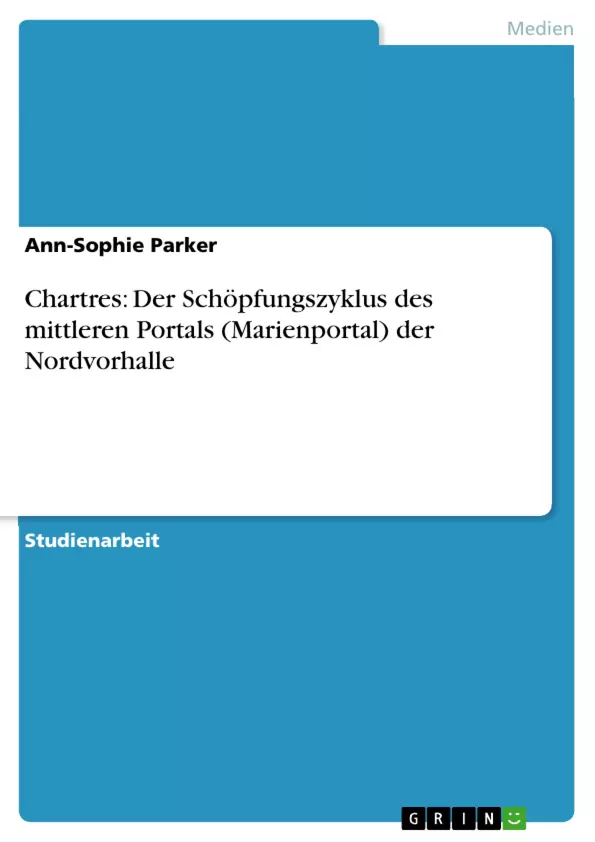Am 11. Juni 1194 entstand, zufolge wissenschaftlichen Überlieferung, ein Großbrand in der Stadt Chartres und zerstörte einen Großteil der dort ansässigen Kathedrale. Nur die Kirchenfront und ihre Krypta blieben von den Flammen bewahrt. Wie aus zeitgemäßen Urschriften abzuleiten ist, betrauerte man keinesfalls nur die Schädigung der Kirche. Man bangte außerdem das Flammenmeer habe jene Überreste zunichtemachte, die der Region bisher ihre Stellung als Wallfahrtsort unangreifbar machte: Ein Hemd, von dem man unterstellte, dass es damals die Ehrwürdige Jungfrau Maria besessen habe. Bis zum Augenblick des Feuers wurde diese Reliquie in der Krypta der Kirche sichergestellt und sollte dereinst intakt wieder entdeckt werden. Retrospektiv würde es spärlich verblüffen, wenn eine Stadt, anschließend sie abermalig von massiven Bränden gepeinigt wurde, sich in eine schöpferische Entkräftung desertierte. In der Problematik von Chartres war diesbezüglich überhaupt nichts zu beobachten. Im Gegensatz, man erachtete den Brand als ein heiliges Mittel, als ein Zeichen dahingehend, dass die Heilige Jungfrau einer voluminöseren Kathedrale benötigte. Infolgedessen machte man sich geschwind wiederholt an die Aufgabe. Das Resultat ist eine Konstruktion, die ebenfalls gegenwärtig noch zu einem der beachtlichsten Mariendenkmäler Frankreichs gehört.
Obwohl es keine schriftlichen Informationsquellen existieren, die uns einen treuen Auskunft über den exakten Bauprozess der Kirche zeigen könnte, wissen wir dank des Chronisten Guillaume le Breton Bescheid, dass die Bauarbeiten schon 1220 die Kathedrale größtenteils beendet wurden.
In meiner Arbeit möchte ich den Genesiszyklus an den Archivolten der Nordvorhalle näher beschreiben, analysieren und auf einige daraus resultierenden Fragestellungen eingehen. Bedeutend für jeglichen Auslegungen ist, dass es sich bei den ersten beiden Artikeln der Genesis keineswegs um einen beispiellosen, stetig stringenten Erzählzusammenhang geht, jedoch um zwei unterschiedliche Darlegungen, die durchaus nicht auf Anhieb zusammen in Gleichförmigkeit zu schaffen sind. Gleich zu Anfang möchte ich deshalb betonen, dass die zu bearbeitende Thematik vielfältig und weitreichend ist. Eine weitere intensivere Bearbeitung von bestehenden Fragestellungen würde den Rahmen der Arbeit sprengen.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Anliegen
- Die Vorhallen
- Die Darstellung der Schöpferfiguren der Genesisarchivolten in Chartres
- Der erste Tag der Schöpfung
- Der "Fremdling" (2. Bildstein, linke Archivolte)
- Offene Fragen
- Auf den Punkt gebracht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der künstlerischen Gestaltung des Schöpfungsaktes in der sakralen Kunst des Christentums, insbesondere am Beispiel der Genesisarchivolte an der mittleren Nordvorhalle der Kathedrale von Chartres. Ziel ist es, die Einflüsse von inhaltlichen, pragmatischen und künstlerisch-ästhetischen Aspekten auf die Gestaltung des Marienportals zu analysieren.
- Die Bedeutung der Schöpfung im Christentum
- Die Darstellung des Schöpfungsaktes in der sakralen Kunst
- Die Genesisarchivolte in Chartres als Beispiel für die künstlerische Gestaltung des Schöpfungsaktes
- Die Analyse von inhaltlichen, pragmatischen und künstlerisch-ästhetischen Aspekten in der Gestaltung des Marienportals
- Vergleiche mit anderen Kunstwerken zum Thema Schöpfung, wie der Cotton Genesis und dem Mosaik in San Marco
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zum Anliegen
Dieses Kapitel führt in das Thema Schöpfung im Christentum ein und beleuchtet die Bedeutung der Schöpfung für den christlichen Glauben. Es werden die vielfältigen künstlerischen Darstellungen der Schöpfung in der sakralen Kunst des Christentums und die Ursachen für diese Vielfalt betrachtet. Die Kathedrale von Chartres wird als Beispiel für die intensive Auseinandersetzung mit der Schöpfungsdarstellung in Sakralbauten vorgestellt. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse des Schöpfungszyklus in der Kathedrale von Chartres, wobei ausgewählte Akte der Schöpfung und ihre künstlerische Gestaltung im Vordergrund stehen.
2. Die Vorhallen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung der Vorhallen in sakralen Bauten von der Antike bis zum Mittelalter. Es werden Einflüsse der Architektur des Alten Reiches der Ägypter, der Antike und der römischen Architektur auf die mittelalterliche Portalarchitektur beleuchtet. Die Bedeutung der Vorhallen im mittelalterlichen Sakralbau als Räume für kultische Handlungen und als Symbole für die Verlagerung der Götterverehrung hin zu Christus wird erläutert.
Häufig gestellte Fragen
Was geschah 1194 in Chartres?
Ein Großbrand zerstörte weite Teile der Kathedrale. Das Überleben der Reliquie (das Hemd Mariens) wurde als Zeichen gedeutet, eine noch größere Kathedrale zu bauen.
Was ist das Thema des mittleren Nordportals?
Die Arbeit analysiert den Schöpfungszyklus (Genesiszyklus) an den Archivolten der Nordvorhalle, insbesondere die Darstellung der Schöpferfiguren.
Wer ist der "Fremdling" an der Archivolte?
Dies bezieht sich auf eine spezifische Schöpferfigur am 2. Bildstein der linken Archivolte, deren Deutung in der kunstgeschichtlichen Analyse untersucht wird.
Welche Rolle spielten Vorhallen im Mittelalter?
Vorhallen dienten als Übergangsraum für kultische Handlungen und symbolisierten den Weg vom Weltlichen zum Heiligen.
Wie wird die Schöpfung in Chartres künstlerisch dargestellt?
Die Darstellung kombiniert inhaltliche, pragmatische und ästhetische Aspekte und zeigt die verschiedenen Phasen der Schöpfung in detaillierten Steinmetzarbeiten.
- Arbeit zitieren
- Ann-Sophie Parker (Autor:in), 2012, Chartres: Der Schöpfungszyklus des mittleren Portals (Marienportal) der Nordvorhalle, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270743