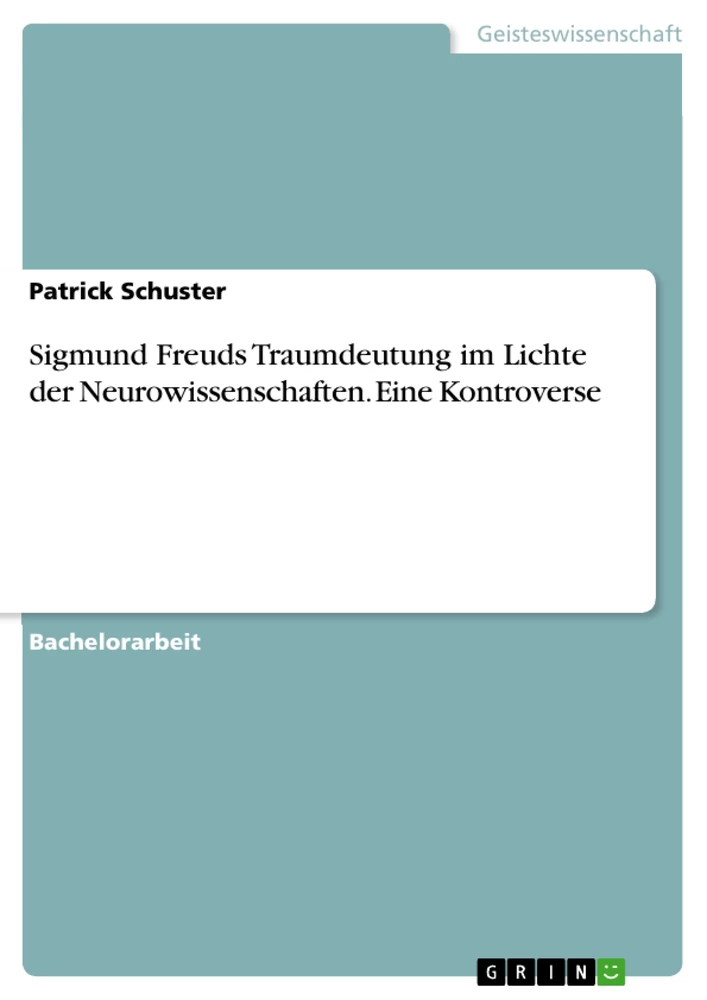Sigmund Freud sorgt bis heute mit seinem 1900 erschienen Werk „Die Traumdeutung“ für viele Diskussionen, auch innerhalb der Neurowissenschaften. Für Freud drücken sich im Traum unbewusste Wünsche aus, die durch einen psychologischen Mechanismus zensiert werden, damit der Träumer nicht aufwachen muss. Damit ist der Traum der „Hüter des Schlafs“. Der neurowissenschaftliche Traumforscher Allan Hobson postuliert 1977 seine „Aktivierungs-Synthese Theorie“, die sich explizit gegen die Freud’schen Thesen richtet. Nach Hobson entstehen Träume durch einen physiologischen Prozess des Gehirns (hauptsächlich im Hirnstamm) und haben keine spezifische psychologische Bedeutung. Für ihn sind Freuds Thesen mit seinen Erkenntnissen nicht in Einklang zu bringen und dessen Theorie nicht mehr als eine psychoanalytische Spekulation. Der Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker Mark Solms übt hingegen scharfe Kritik an Hobsons Theorie. Er postuliert 1997 die Ergebnisse einer Studie, die er an Patienten mit Hirnläsionen durchführte: Solms beobachtet, dass regelmäßig ganz andere Regionen des Gehirns am Traumprozess beteiligt sind, als Hobson behauptet. Er sieht seine Ergebnisse - neben weiteren aktuellen Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften - zudem sehr gut mit den Freud’schen Aussagen über den Traum im Einklang. Es beginnt ein wissenschaftlicher Streit rundum die Freud’schen Theorien zum Traumgeschehen, welche in den Neurowissenschaften bis Dato für veraltet galten. Im Jahr 2009 ersetzt Allan Hobson seine ehemals paradigmatische „Aktivierungs-Synthese Theorie“ durch eine neue Konzeption, der „Theorie des Protobewusstseins“. Dieses Modell weist – im Gegensatz zu seiner ursprünglichen Theorie - einige Ähnlichkeiten mit Freuds Annahmen auf.
Inhaltsverzeichnis
ABSTRACT
1 EINLEITUNG
2 FREUD (1900): DIE TRAUMDEUTUNG
3 DIE HOBSON-SOLMS KONTROVERSE
3.1 Hobson (1977): Die Aktivierungs-Synthese Theorie
3.2 Solms (1997): Traum und REM-Schlaf
3.3 Hobson (2009): Theorie des Protobewusstseins
3.4 Solms (2012): Hobson versus Freud
4 FAZIT
5 LITERATURVERZEICHNIS
6 ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- Quote paper
- Patrick Schuster (Author), 2013, Sigmund Freuds Traumdeutung im Lichte der Neurowissenschaften. Eine Kontroverse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270778