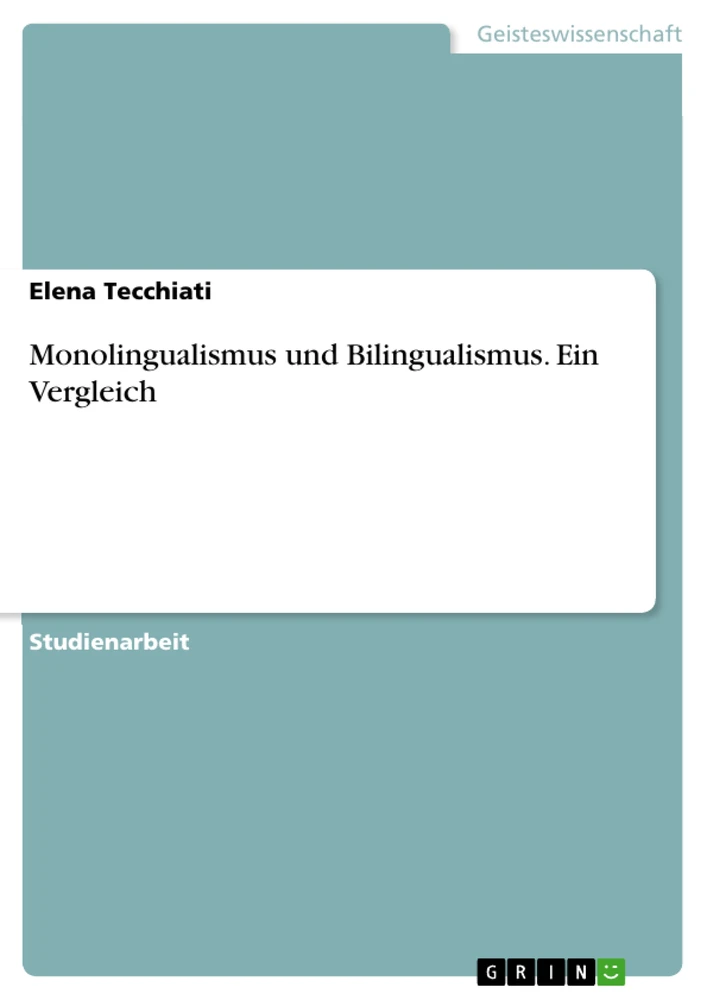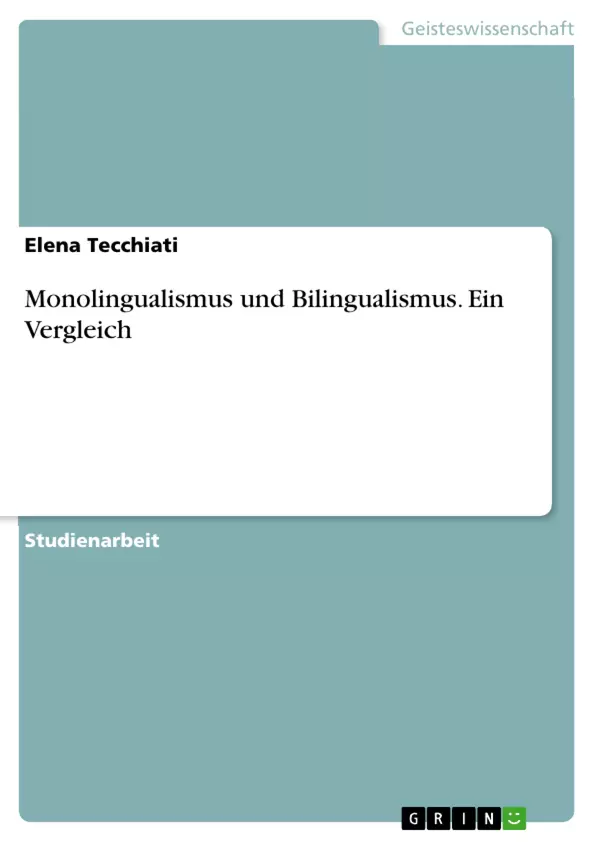Der erste und fundamentale Unterschied zwischen Mono- und Bilingualismus zeigt sich in der Hirnaktivität während der kognitiven Verarbeitung der zwei fremden Sprachen. Zahlreiche Studien haben weiterhin gezeigt, dass ein großer Unterschied zwischen einsprachig und zweisprachig erzogenen Kindern, die mindestens zwei Sprachen regelmäßig ausgesetzt sind, die Aufmerksamkeits- und Kontrollfähigkeit ist, d.h. die Fähigkeit, jenen Informationsfluss zu hemmen, der für die Erledigung einer zu einem bestimmten Zeitpunkt in Bearbeitung befindlichen Aufgabe nicht notwendig ist. Diese Fähigkeit hängt allerdings später (vermehrt im Vorschulalter) von der Beherrschung der beiden Sprachen ab und es kann schlimmstenfalls dazu führen, dass die Kinder Ausdrucksprobleme aufweisen, wenn sie die zwei unterschiedlichen Sprachen nicht perfekt beherrschen. Nach Ansicht anderer Forscher ist nicht anzunehmen, dass bilingual erzogene Kinder die zwei Sprachen gleichermaßen perfekt beherrschen. Es wird vielmehr postuliert, dass sich beim Spracherwerb eine Basissprache entwickeln würde, die dann Grundlage für die andere zu erlernende Sprache werde.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Definition von Bilingualismus
- 3. Monolingualismus, Bilingualismus und Hirnaktivität
- 4. Auswirkungen auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen
- 4.1. Bei nonverbalen Kommunikationsmodi
- 4.2. In der präverbalen Entwicklungsphase
- 5. Probleme und Grenzen des Bilingualismus
- 5.1. Basissprache und weitere Sprachen
- 6. Fazit
- 7. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Unterschiede zwischen einsprachigen und zweisprachigen Menschen, wobei der Fokus auf die kognitiven Fähigkeiten, insbesondere der Aufmerksamkeits- und Kontrollfähigkeiten liegt. Es werden verschiedene Definitionen von Bilingualismus beleuchtet und die Auswirkungen von Zweisprachigkeit auf die Hirnaktivität sowie die Entwicklung der exekutiven Funktionen untersucht.
- Definition und Typologie von Bilingualismus
- Unterschiede in der Hirnaktivität von Monolingualisten und Bilingualisten
- Auswirkungen von Bilingualismus auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen
- Probleme und Grenzen des Bilingualismus
- Die Bedeutung der Basissprache im Spracherwerb
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung und Fragestellung: Die Einleitung führt in das Thema Bilingualismus ein und beleuchtet die Faszination, die mit dem Erlernen mehrerer Sprachen verbunden ist. Sie thematisiert die Vorteile des Bilingualismus und die historische Entwicklung des Forschungsfeldes. Außerdem wird die Fragestellung der Arbeit dargelegt, welche sich auf die Unterschiede in den kognitiven Fähigkeiten von Einsprachigen und Zweisprachigen fokussiert.
- Kapitel 2: Definition von Bilingualismus: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Definitionen von Bilingualismus, beginnend von der ursprünglichen Wortbedeutung bis hin zu komplexen wissenschaftlichen Ansätzen. Es werden unterschiedliche Ansätze vorgestellt, die sich auf die Fähigkeit zur Kommunikation, den Lebensalltag oder die sprachliche Kompetenz beziehen. Der Fokus liegt dabei auf der Definition von Bilingualismus in Bezug auf die Fähigkeiten, die ein Sprecher in den verschiedenen Sprachen besitzt.
- Kapitel 3: Monolingualismus, Bilingualismus und Hirnaktivität: In diesem Kapitel wird der Unterschied in der Hirnaktivität zwischen Einsprachigen und Zweisprachigen beleuchtet. Es wird aufgezeigt, wie die kognitive Verarbeitung von Sprachen im Gehirn abläuft und welche spezifischen Herausforderungen sich für Zweisprachige ergeben. Der Fokus liegt dabei auf der neurobiologischen Grundlage des Bilingualismus.
- Kapitel 4: Auswirkungen auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss von Bilingualismus auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit, Kontrolle und Planung. Es werden Studien vorgestellt, die die positiven Effekte von Zweisprachigkeit auf diese Fähigkeiten belegen. Die Diskussion beinhaltet auch die Frage, inwieweit die sprachliche Kompetenz der Kinder Einfluss auf die Entwicklung dieser Funktionen hat.
- Kapitel 5: Probleme und Grenzen des Bilingualismus: Das Kapitel befasst sich mit möglichen Herausforderungen, die mit Bilingualismus verbunden sind. Es werden Fragen nach der Vollständigkeit des Bilingualismus und der Bedeutung der Basissprache im Spracherwerb aufgeworfen. Außerdem werden die Grenzen des Bilingualismus hinsichtlich der Fähigkeit, zwei Sprachen gleichermaßen perfekt zu beherrschen, thematisiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Kernthemen Bilingualismus, Monolingualismus, Hirnaktivität, kognitive Fähigkeiten, exekutive Funktionen, Sprachentwicklung, Basissprache, Sprachkompetenz und interkulturelle Kompetenz. Die wichtigsten Konzepte sind die Unterschiede in der Verarbeitung von Sprachen im Gehirn, die Auswirkungen von Zweisprachigkeit auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen und die Schwierigkeiten bei der Definition und Messung von Bilingualismus.
- Arbeit zitieren
- Elena Tecchiati (Autor:in), 2010, Monolingualismus und Bilingualismus. Ein Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270803