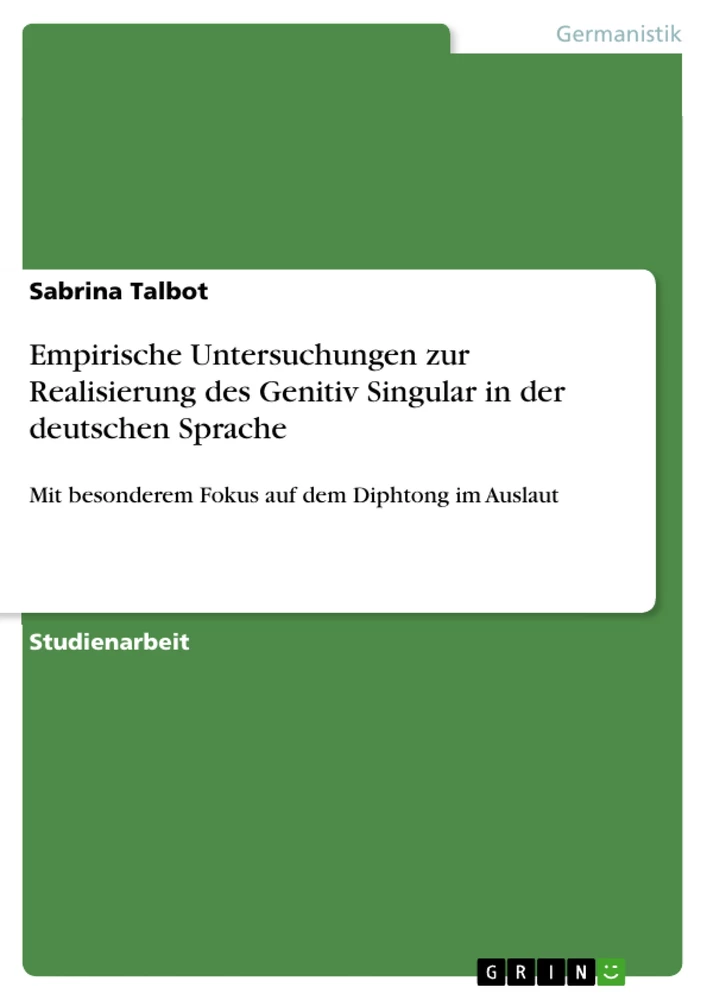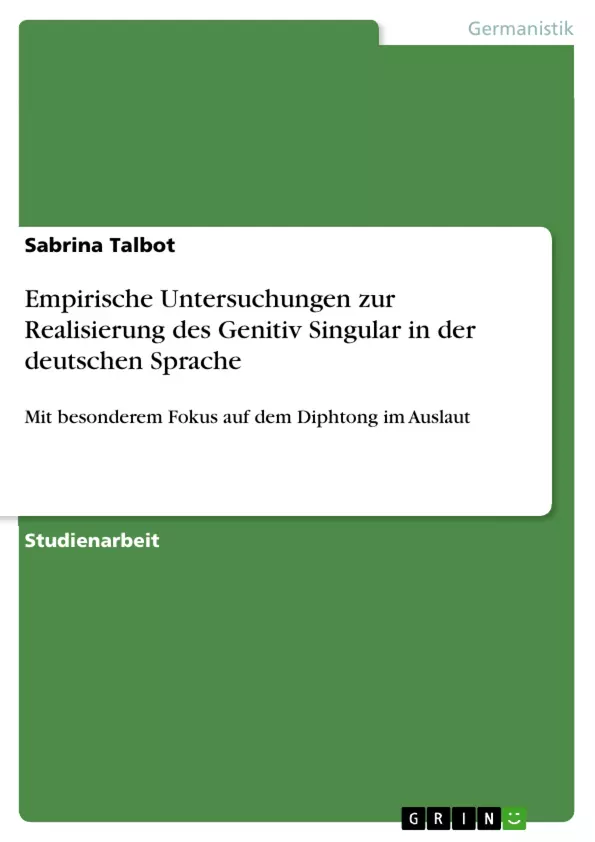Die vorliegende Arbeit soll mittels einer empirischen Untersuchung der Fragestellung auf den Grund gehen, in welchen Fällen die unterschiedlichen Endungen für den Genitiv Singular verwendet werden. Hierbei liegt der Fokus auf den Fällen, in denen ein Diphthong im Auslaut steht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Problematik der Endungsbildung
- 2.1. Zusammenhang von verbaler Sprache und Orthografie
- 2.2. Empfehlungen durch orthografische Wörterbücher
- 3. Die empirische Untersuchungsweise
- 4. Versuchsdurchführung
- 4.1. Auswertung Gruppe 1
- 4.1.1. Erwartungen
- 4.1.2. Ergebnisse
- 4.2. Auswertung Gruppe 2
- 4.2.1. Erwartungen
- 4.2.2. Ergebnisse
- 4.3. Auswertung Gruppe 3
- 4.3.1. Erwartungen
- 4.3.2. Ergebnisse
- 4.4. Gruppenvergleich
- 5. Fazit
- 6. Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht empirisch die Realisierung des Genitiv Singulars im Deutschen, mit besonderem Fokus auf Wörtern mit Diphthong im Auslaut. Ziel ist es, zu ergründen, welche Endungen ( -en/-n, -es/-s, -ens/-ns, oder die endungslose Form) in welchen Fällen verwendet werden und welche Faktoren (z.B. Wortlänge, Betonung) die Wahl der Endung beeinflussen.
- Realisierung des Genitiv Singular im Deutschen
- Einfluss des Auslauts (besonders Diphthonge) auf die Genitivbildung
- Vergleich verschiedener orthographischer Empfehlungen
- Empirische Untersuchung mittels Fragebogen und Tonaufnahmen
- Analyse der Ergebnisse in verschiedenen Wortgruppen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der Genitivbildung im Deutschen ein. Sie betont die Schwierigkeiten, die selbst sprachbewusste Personen mit der Bildung des Genitiv Singulars haben, und verweist auf die hohe Nachfrage nach sprachlicher Beratung in diesem Bereich. Die Einleitung hebt die verschiedenen Bildungsvarianten des Genitiv Singulars hervor und kündigt die empirische Untersuchung an, die sich auf Wörter mit Diphthong im Auslaut konzentrieren wird. Die Einleitung betont die komplexen Regeln der Genitivbildung und die unterschiedlichen Ansätze in der Forschung.
2. Problematik der Endungsbildung: Dieses Kapitel untersucht die Schwierigkeiten bei der Bildung des Genitiv Singulars, indem es den Zusammenhang zwischen der lautlichen und orthografischen Realisierung von Wörtern beleuchtet. Es wird analysiert, wie die Auslautstruktur eines Wortes (z.B. Wörter mit [e], [s], [ts], [ʃ] im Auslaut) die Wahl der Genitivendung beeinflusst. Der Schwerpunkt liegt auf Wörtern mit Diphthong im Auslaut, wobei die Ambiguität der Genitivbildung an Beispielen wie "Bau" verdeutlicht wird. Das Kapitel beleuchtet auch die divergierenden Empfehlungen verschiedener orthographischer Wörterbücher hinsichtlich der Genitivbildung, was die Komplexität und Variabilität der deutschen Grammatik unterstreicht.
3. Die empirische Untersuchungsweise: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Auswahl der untersuchten Substantive (Fokus auf Wörter mit Diphthong im Auslaut), ihre Einteilung in drei Gruppen nach prosodischen Kriterien (starke einsilbige Substantive, Substantive mit jambischer und trochäischer Struktur) und die Gestaltung des Fragebogens. Die Vorgehensweise bei der Datenerhebung (verbale Genitivbildung anhand von Bildern, Tonaufnahmen) wird detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf der systematischen Vorgehensweise und der Begründung der gewählten Methodik.
Schlüsselwörter
Genitiv Singular, deutsche Sprache, Diphthong, Auslaut, Nominalflexion, empirische Untersuchung, Orthografie, Wortbildung, Wörterbücher, Prosodie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Empirische Untersuchung der Genitivbildung im Deutschen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht empirisch die Bildung des Genitiv Singulars im Deutschen, insbesondere bei Wörtern mit Diphthong im Auslaut. Es werden verschiedene Genitivendungen (-en/-n, -es/-s, -ens/-ns, oder die endungslose Form) betrachtet und die Faktoren, die deren Verwendung beeinflussen, analysiert.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, herauszufinden, welche Endungen in welchen Fällen verwendet werden und welche Faktoren (z.B. Wortlänge, Betonung) die Wahl der Endung beeinflussen. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Vergleich verschiedener orthographischer Empfehlungen zur Genitivbildung.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Untersuchungsmethode. Substantive mit Diphthong im Auslaut wurden in drei Gruppen nach prosodischen Kriterien eingeteilt (starke einsilbige Substantive, Substantive mit jambischer und trochäischer Struktur). Die Datenerhebung erfolgte mittels Fragebogen und Tonaufnahmen, wobei die Teilnehmer die Genitivformen verbal bilden sollten.
Welche Wortgruppen werden untersucht?
Der Schwerpunkt liegt auf Wörtern mit Diphthong im Auslaut. Diese Wörter wurden in drei Gruppen eingeteilt basierend auf prosodischen Kriterien: starke einsilbige Substantive, Substantive mit jambischer und trochäischer Struktur.
Wie werden die Ergebnisse ausgewertet?
Die Auswertung erfolgt getrennt für jede der drei Wortgruppen (Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3), wobei Erwartungen und Ergebnisse verglichen werden. Anschließend erfolgt ein Gruppenvergleich.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Problematik der Endungsbildung, Empirische Untersuchungsweise, Versuchsdurchführung (mit Unterkapiteln zur Auswertung der einzelnen Gruppen und einem Gruppenvergleich), Fazit und Quellenangabe.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Genitiv Singular, deutsche Sprache, Diphthong, Auslaut, Nominalflexion, empirische Untersuchung, Orthografie, Wortbildung, Wörterbücher, Prosodie.
Welche Probleme werden im Bezug auf die Genitivbildung behandelt?
Die Arbeit behandelt die Schwierigkeiten bei der Bildung des Genitiv Singulars, insbesondere den Zusammenhang zwischen lautlicher und orthographischer Realisierung. Die Ambiguität der Genitivbildung und die divergierenden Empfehlungen verschiedener orthographischer Wörterbücher werden ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielen orthographische Wörterbücher?
Die Arbeit analysiert die Empfehlungen verschiedener orthographischer Wörterbücher zur Genitivbildung und zeigt deren Divergenzen auf, was die Komplexität der deutschen Grammatik unterstreicht.
- Quote paper
- Sabrina Talbot (Author), 2011, Empirische Untersuchungen zur Realisierung des Genitiv Singular in der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270950