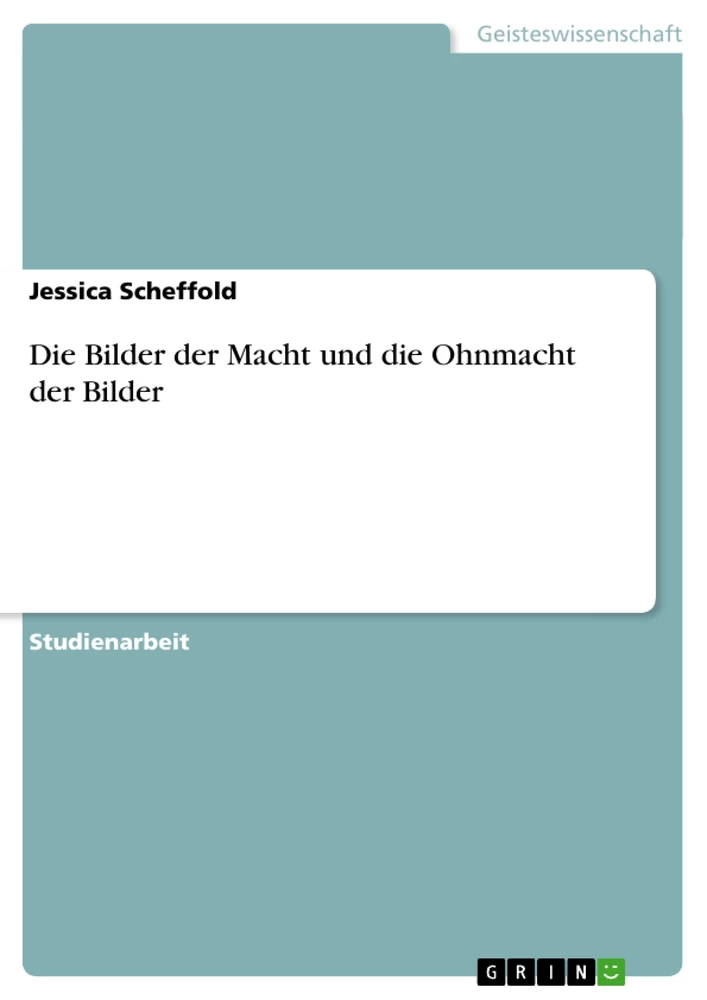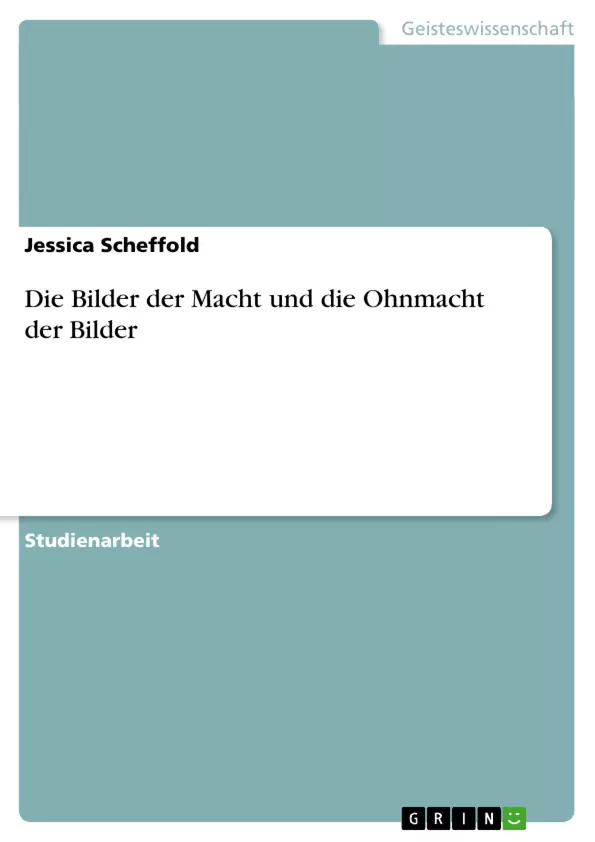In dem Text „Die Bilder der Macht und die Ohnmacht der Bilder“ schreibt Welzer (Welzer 1995, 165ff.) über den Einsatz medialer Instrumente durch das NS-Regime zur Geschichtsgestaltung und deren Interpretation. Dazu führt er aus, daß Geschichte aus Bildern bestünde, die medial konserviert, eine Überzeitlichkeit annähmen, obgleich sie lediglich mikroskopisch kleine Geschehens- oder Lebensausschnitte seien. Weiterhin beschreibt Welzer, daß diese Art der Inszenierung einen zentralen Stellenwert in der Herrschaftsstrategie der Nazis gehabt habe.
Nach allgemeineren Ausführungen über die Macht der Bilder fokussiert der Autor weiter auf die Zeit des Dritten Reiches. Welzer nimmt sodann eine Dreiteilung des Textes in „Bilder der Macht – Macht der Bilder“ und „Bilder der Ohnmacht – Ohnmacht der Bilder“, sowie „Strategien der Destrukturierung“ vor.
Im ersten Teil beschreibt er, wie das Nazi-Regime durch den Einsatz verschiedenster Medien das Volk propagandistisch zu beeinflussen suchte, um sowohl die vergangene als auch die neu zu schreibende Geschichte nach ihren Maßstäben neu zu definieren.
Im zweiten Teil stellt Welzer heraus, wie der Holocaust, also die Vernichtung der Juden im Dritten Reich, durch kontrollierte Nichtkommunikation und Nichtdokumentation quasi nebenbei geschehen sollte.
Abschließend gibt der Autor in „Strategien der Destrukturierung“ Denkanstöße, wie das vorhandene Muster der Interpretation des Gesehenen neu zu ordnen und dadurch besser zu verstehen sei. Um sich schließlich selbst zu wiedersprechen, indem er die „Verstehensgrenze“ (Welzer 1995, 189) erwähnt. Demnach könne der Holocaust nicht begriffen werden und dies sei das einzige, was noch Hoffnung aufscheinen ließe.
Ziel des nachfolgenden Textes ist es, eine Zusammenfassung der Argumentationen und Ausführungen Welzers zu geben und diese zu interpretieren.
Zudem wird die Hauptthese Welzers, daß das „Hineinreichen der Vergangenheit in die Gegenwart auf der Ebene der Bilder“ Faktum sei, auf heutige Geschehnisse übertragen. Dabei wird deutlich, wie auch in der jüngeren Vergangenheit die genannten Methoden zu Tage treten und sich die Geschichte, zumindest methodisch ähnlich, wiederholt. Auch dadurch ist ein Argument dafür gefunden, daß die NS-Zeit eben nicht als absoluter „Zivilisationsbruch“ (Welzer 1995, 166) zu sehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bearbeitung der Fragestellung
- Bilder der Macht - Macht der Bilder
- Die Inszenierung des Reichsparteitages
- Die Inszenierung der Massen und die "unablässige Wiederholung"
- Das Gesamtkonzept der nationalsozialistischen Ästhetik
- Die Macht der Bilder und die "Gestaltungszuversicht" Hitlers
- Die Rolle der Medien in der nationalsozialistischen Propaganda
- Die Bedeutung des Kinos als Massenmedium
- Bilder der Ohnmacht - Ohnmacht der Bilder
- Die Nichtdokumentation des Holocaust
- Die Problematik der Wirklichkeitskonstruktion aus Bildmaterial
- Strategien der Destrukturierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert Harald Welzers Schrift „Die Bilder der Macht und die Ohnmacht der Bilder“ und untersucht, wie das NS-Regime mediale Instrumente zur Geschichtsgestaltung und -interpretation einsetzte. Der Essay betrachtet die Macht der Bilder, die propagandistische Beeinflussung der Massen durch die Nazis, die Nichtdokumentation des Holocaust und die Strategien der Destrukturierung von Bildern. Die Arbeit befasst sich außerdem mit der Frage, inwieweit sich die NS-Zeit als ein „Zivilisationsbruch“ betrachten lässt.
- Die Macht der Bilder in der NS-Propaganda
- Die Inszenierung von Massenereignissen und deren mediale Verbreitung
- Die Rolle des Kinos und anderer Medien im NS-Regime
- Die Nichtdokumentation des Holocaust und die Konstruktion der Realität
- Strategien der Destrukturierung von Bildern und die Interpretation von Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Welzers Hauptthese vor: Die Vergangenheit dringt in die Gegenwart auf der Ebene der Bilder ein. Der Essay analysiert die Argumentation Welzers und interpretiert seine Ausführungen. Außerdem wird die These auf aktuelle Ereignisse übertragen, um zu zeigen, dass die NS-Zeit nicht als ein absoluter „Zivilisationsbruch“ zu sehen ist.
Bearbeitung der Fragestellung
Dieser Abschnitt untersucht die Rolle des „Lichtdoms“ auf dem Reichsparteitag 1936 als Beispiel für die Macht der Bilder. Er analysiert, wie die Nazis durch die Inszenierung von Massenereignissen und die „unablässige Wiederholung“ in den Medien die Massen beeinflussen konnten. Der Abschnitt zeigt auch, wie das Gesamtkonzept der nationalsozialistischen Ästhetik funktionierte und wie Hitler selbst durch künstlerische Gestaltung eine neue Gesellschaft und Geschichte zu schaffen suchte.
Bilder der Macht - Macht der Bilder
Dieser Abschnitt beschreibt die Inszenierung des Reichsparteitages und die Rolle der Medien in der nationalsozialistischen Propaganda. Er analysiert die Bedeutung des Kinos als Massenmedium und die Strategien der Nazis, um die Grenzen zwischen dem Handelnden und dem Publikum aufzuheben.
Bilder der Ohnmacht - Ohnmacht der Bilder
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Nichtdokumentation des Holocaust und der Problematik der Wirklichkeitskonstruktion aus Bildmaterial.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Macht der Bilder, NS-Propaganda, mediale Inszenierung, Massenmanipulation, Holocaust, Nichtdokumentation, Wirklichkeitskonstruktion, Zivilisationsbruch, Geschichte, Gegenwart, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzte das NS-Regime Bilder zur Herrschaftssicherung?
Das Regime setzte mediale Instrumente und Inszenierungen (wie den Lichtdom beim Reichsparteitag) ein, um die Geschichte nach seinen Maßstäben neu zu definieren und Massen zu manipulieren.
Was bedeutet "Ohnmacht der Bilder" im Kontext des Holocaust?
Welzer beschreibt, dass der Holocaust durch kontrollierte Nichtkommunikation und Nichtdokumentation quasi "nebenbei" geschehen sollte, was zu einer Leerstelle in der visuellen Überlieferung führt.
War die NS-Zeit ein absoluter "Zivilisationsbruch"?
Der Text argumentiert, dass viele Methoden der medialen Beeinflussung auch in der jüngeren Vergangenheit zu Tage treten, was gegen die Sicht der NS-Zeit als isolierten Zivilisationsbruch spricht.
Welche Rolle spielte das Kino in der Nazi-Propaganda?
Das Kino diente als zentrales Massenmedium, um durch unablässige Wiederholung und ästhetische Gestaltung die Grenzen zwischen Publikum und Geschehen aufzuheben.
Was sind "Strategien der Destrukturierung"?
Es handelt sich um Denkanstöße zur Neuordnung vorhandener Interpretationsmuster des Gesehenen, um die Geschichte und deren mediale Vermittlung besser zu verstehen.
- Quote paper
- Jessica Scheffold (Author), 2004, Die Bilder der Macht und die Ohnmacht der Bilder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27096