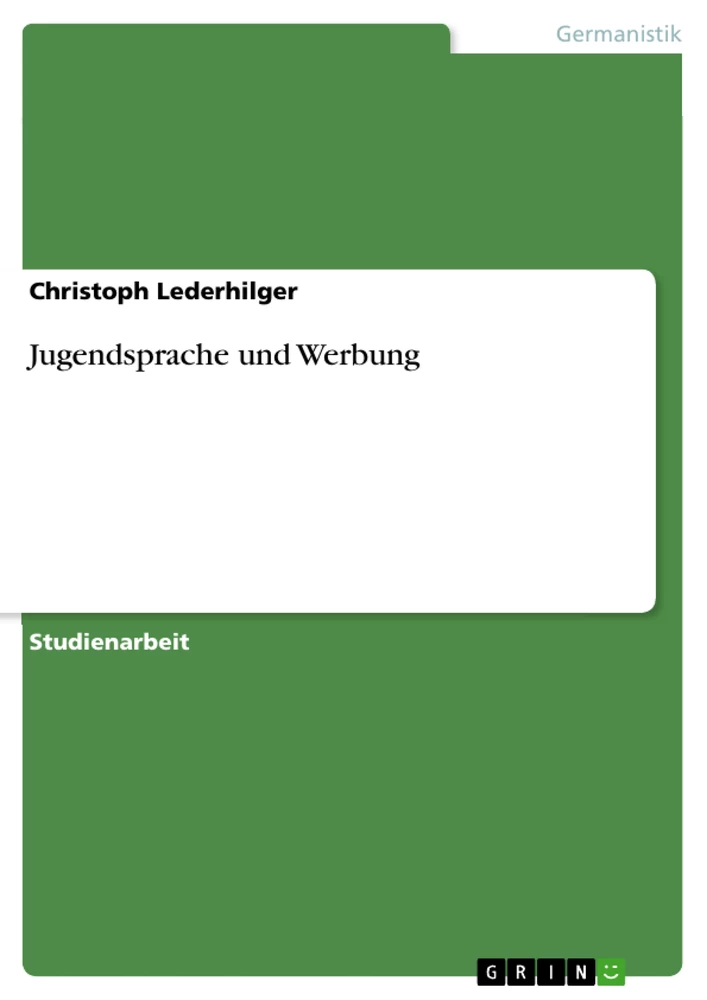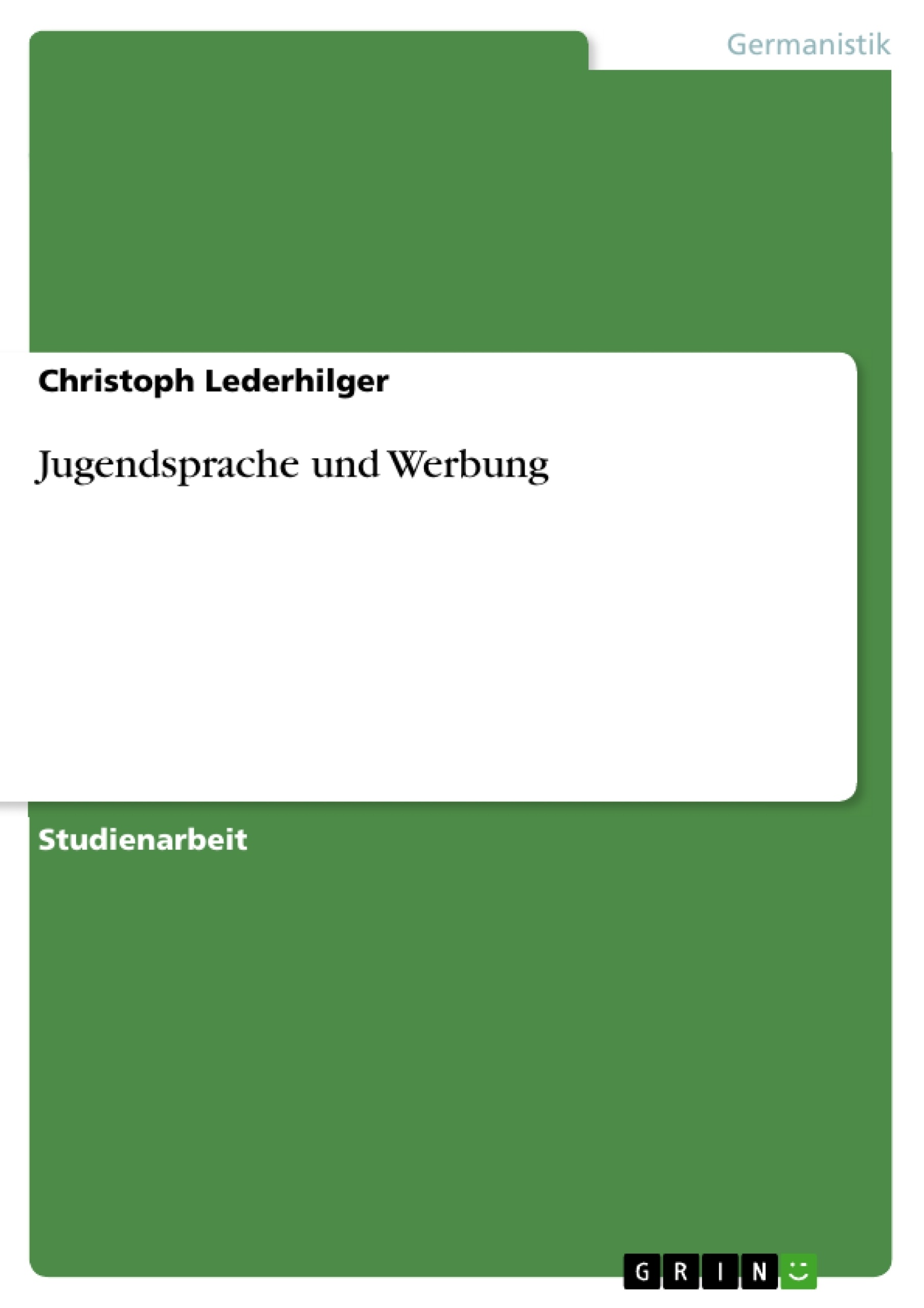Der Jugendsprache lasten längst nicht mehr so viele negative Meinungen und Einstellungen an, wie das noch vor wenigen Jahren der Fall war. Grund für diesen Umschwung dürfte die aufstrebende Jugendsprachforschung sein, welche ein noch relativ junges Forschungsgebiet der Linguistik darstellt. Als die Jugendsprache allmählich in das Zentrum des Interesses rückte, wurde oft von Sprachverfall (vgl. Neuland 2008, 3f.), was unter anderem dazu führte, dass die Jugendsprache in den Medien nur schlecht wegkam.
Gleichzeitig aber wuchs das Interesse an den Geheimnissen hinter dieser Varietät, was das Erscheinen von jugendsprachlichen Wörterbüchern und populärwissenschaftlichen Abhandlungen zur Folge hatte (vgl. Neuland 2008, 12). Durch dieses Interesse der Medien an der Jugendsprache entstand bereits zu Beginn der Forschungen ein massenmediales Umfeld. Generell ist die Jugendsprache immer im Zusammenhang mit den Medien zu sehen, da die Medien einen wichtigen Bestandteil des Jugendalltags darstellen. So wäre eine Untersuchung der Jugendsprache ohne Beachtung ihrer massenmedialen Verbreitung nicht denkbar, da die Ergebnisse aufgrund der Vernachlässigung von Faktoren verfälscht wären.
Schnell entdeckte auch die Werbung die Macht der Jugendsprache, was dazu führte, dass immer wieder jugendsprachliche Elemente in Werbungen gefunden werden können. Auf dieser Thematik soll auch der Fokus dieser Arbeit liegen.
Zuerst soll der Begriff der Jugendsprache geklärt und definiert werden, was für eine weitere Beschäftigung mit dem Thema unbedingt notwendig ist, da mit unscharfen Begriffen auch nur ungenaue Analysen durchgeführt werden können. Auch der Begriff der Werbesprache soll kurz reflektiert werden. Nach diesen elementaren Definitionen sollen einerseits die Gemeinsamkeiten zwischen Jugend- und Werbesprache, andererseits aber auch die Unterschiede zwischen ebendiesen erörtert werden, auf deren Basis schließlich eine Untersuchung aktueller Slogans durchgeführt werden kann. Dabei soll geklärt werden, in-wieweit sich die Werbung mit ihren Slogans auf Jugendsprachlichkeit und deren Praktiken stützt. Die Slogans wurden im Internet recherchiert und können im Angang eingesehen werden, wo auch die jeweilige Quelle vermerkt ist. Bei der Auswahl der Slogans wurden nur Produkte berücksichtigt, die offensichtlich Jugendliche als Zielgruppe ihrer Werbung haben.
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
2 JUGEND- UND WERBESPRACHE
2.1 GEGENÜBERSTELLUNG
2.2 SPRACHWANDEL
3 ANALYSE VON SLOGANS
4 ZUSAMMENFASSUNG
5 LITERATURVERZEICHNIS
6 ANHANG
- Arbeit zitieren
- BA Christoph Lederhilger (Autor:in), 2011, Jugendsprache und Werbung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271262