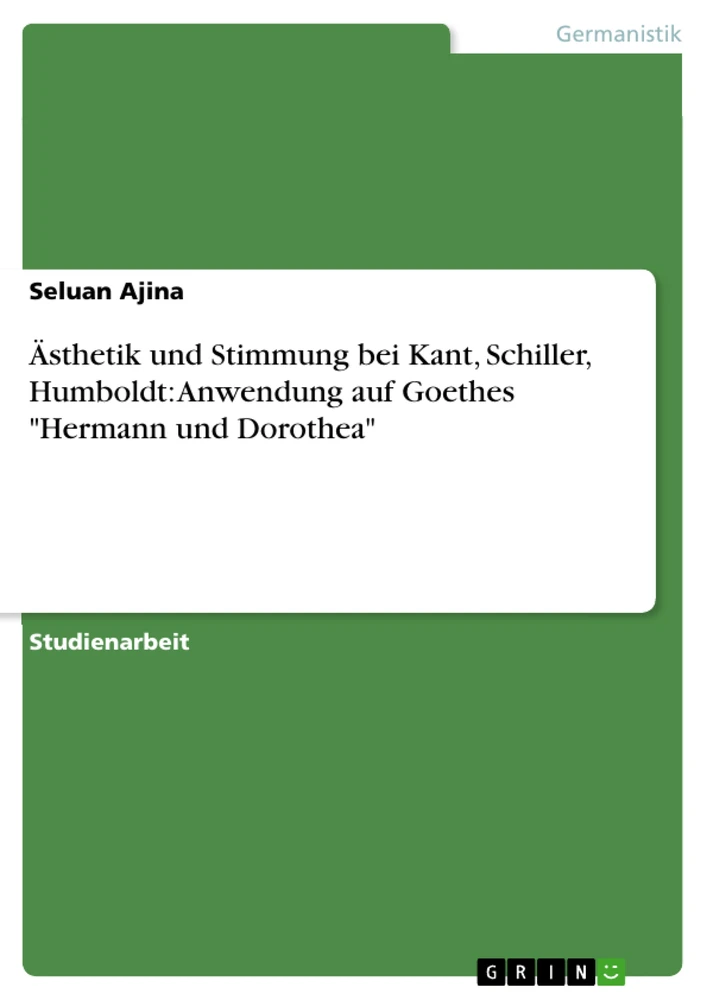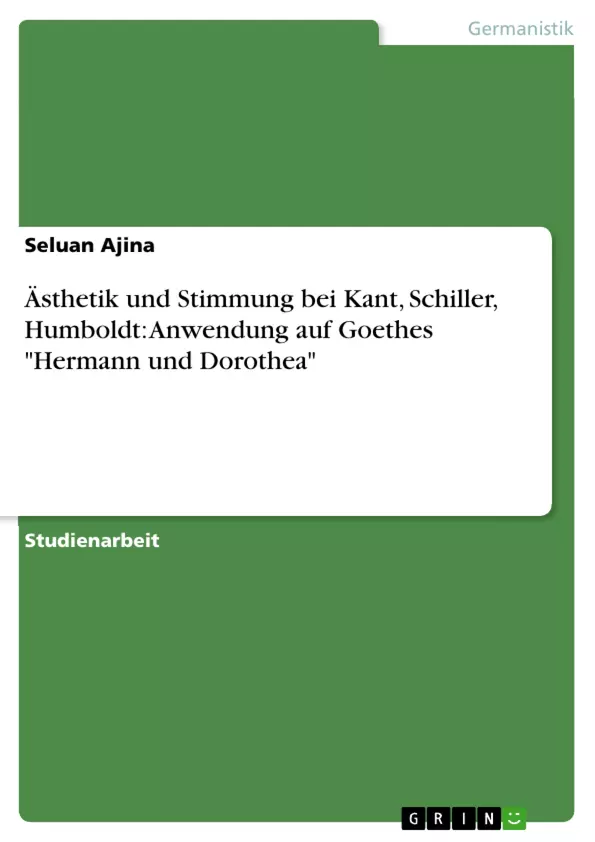"Von nichts wimmelt unsere Zeit so sehr als von Ästhetikern." (Jean Paul)
Wir müssen Jean Paul Recht geben: Im späten 18. Jahrhundert „wimmelt“ es nur so von Ästhetik-Philosophen: Kant, Schiller, Baumgarten, Hegel, Herder, Lessing und Jean Paul... die Liste liesse sich noch lange weiterführen. Es waren diese Jahre, in denen sich wichtige Leute wichtige Fragen gestellt haben: Was ist Schönheit? Was ist Kunst? Ist Schönheit universell gültig? Gibt es einen Begriff zum Schönen? Wieso ist eine Schlangenlinie schön und eine zickzackige nicht? Die Fragen gehen immer weiter, um schliesslich wieder auf die erste zurückzukommen: Was bedeutet schön?
In dieser Arbeit soll es darum gehen, der Frage nach Schönheit im ästhetischen Sinne bei Kant, Schiller und Humboldt nachzugehen und die Erkenntnis im Folgenden auf Goethes Gedicht Hermann und Dorothea anzuwenden. Es wird unvermeidlich sein, die einzelnen Theorien darzustellen und miteinander zu vergleichen, damit sie die Basis bilden für das weitere Vorgehen. Konkret verglichen werden Kants Kritik der Urteilskraft (1790), Schillers Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795) und Humboldts Über Goethes Hermann und Dorothea (1799). In ihnen werden die folgende Punkte erläutert: Kants Vorstellung des Schönen, Schillers Annahme, dass wir durch Begegnung mit dem Schönen Totalität erlangen und Humboldts Stimmungsbegriff. In einem zweiten Schritt werden diese Punkte auf das Gedicht Hermann und Dorothea zu übertragen.
Die vorliegende Arbeit bietet einen Überblick zu den prägendsten Werken ihrer Zeit (Hegel, Herder usw. mögen mir verzeihen). Sie hat zum Ziel, durchaus komplexe Theorien, möglichst verständlich und kompakt auszulegen. Sie versucht, die einzelnen Werke in einen Zusammenhang mit den anderen zu stellen und wird am Beispieltext die zentralen Aussagen der Ästhetiker prüfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG.
- 1.1 Ästhetik: ein Überblick.
- 1.2 Zum Begriff des Schönen bei Kant.
- 1.2 Zum Begriff der Totalität bei Schiller...
- 1.3 Der Stimmungsbegriff bei Humboldt..
- 1.5 Erkenntnisse.
- 2. JOHANN WOLFGANG GOETHE: HERMANN UND DOROTHEA
- 2.1 Landschaftsbeschreibung
- 2.2 Heimkehrszene
- 2.3 Dorothea.
- 2.4 Warteszene
- 3. SCHLUSS
- 3.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte von Schönheit, Totalität und Stimmung im Kontext der Ästhetiktheorien von Kant, Schiller und Humboldt. Sie untersucht, wie diese Konzepte auf Goethes Gedicht "Hermann und Dorothea" angewendet werden können, und stellt die zentralen Thesen der drei Denker in Beziehung zueinander.
- Der Begriff des Schönen bei Kant und seine Bedeutung für die ästhetische Erfahrung
- Schillers Theorie der ästhetischen Erziehung und der Erlangung von Totalität
- Humboldts Stimmungsbegriff und dessen Relevanz für die Interpretation von Literatur
- Die Anwendung dieser ästhetischen Konzepte auf "Hermann und Dorothea" durch Goethes Werk
- Ein Vergleich der ästhetischen Theorien von Kant, Schiller und Humboldt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet einen Überblick über den Begriff der Ästhetik und geht auf die zentralen Fragen der ästhetischen Philosophie ein. Der zweite Teil konzentriert sich auf Kants Kritik der Urteilskraft, beleuchtet seine Definition des Schönen und analysiert die Rolle der Einbildungskraft, der Empfindung und des Geschmacksurteils in der ästhetischen Wahrnehmung. Das dritte Kapitel behandelt Schillers Über die ästhetische Erziehung des Menschen und seine Idee der Totalität, die durch Begegnung mit dem Schönen erreicht werden kann.
Kapitel 4 befasst sich mit Humboldts Stimmungsbegriff und seiner Anwendung auf Goethes "Hermann und Dorothea". Es untersucht, wie die Stimmung in der Literatur eine wichtige Rolle spielt und wie sie durch die ästhetischen Theorien von Kant und Schiller beleuchtet werden kann.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Ästhetik, Schönheit, Totalität, Stimmung, Einbildungskraft, Geschmacksurteil, ästhetische Erziehung, Kant, Schiller, Humboldt, "Hermann und Dorothea", Goethe.
Häufig gestellte Fragen
Welche Ästhetik-Theorien werden in dieser Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht Kants „Kritik der Urteilskraft“, Schillers „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ und Humboldts Schriften zu Goethes Werk.
Was ist Kants zentraler Beitrag zum Begriff des Schönen?
Kant untersucht das Geschmacksurteil und die Rolle der Einbildungskraft bei der Wahrnehmung von Schönheit.
Was versteht Schiller unter der Erlangung von „Totalität“?
Schiller argumentiert, dass der Mensch durch die Begegnung mit dem Schönen seine innere Zersplitterung überwindet und zu einer ganzheitlichen Bildung gelangt.
Wie definiert Humboldt den Stimmungsbegriff?
Humboldt nutzt den Stimmungsbegriff, um die Wirkung literarischer Werke auf das Gemüt des Lesers zu beschreiben, beispielhaft an Goethes „Hermann und Dorothea“.
Auf welches literarische Werk werden diese Theorien angewendet?
Die ästhetischen Konzepte werden auf Johann Wolfgang von Goethes Epos „Hermann und Dorothea“ angewendet.
- Quote paper
- Seluan Ajina (Author), 2013, Ästhetik und Stimmung bei Kant, Schiller, Humboldt: Anwendung auf Goethes "Hermann und Dorothea", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271311