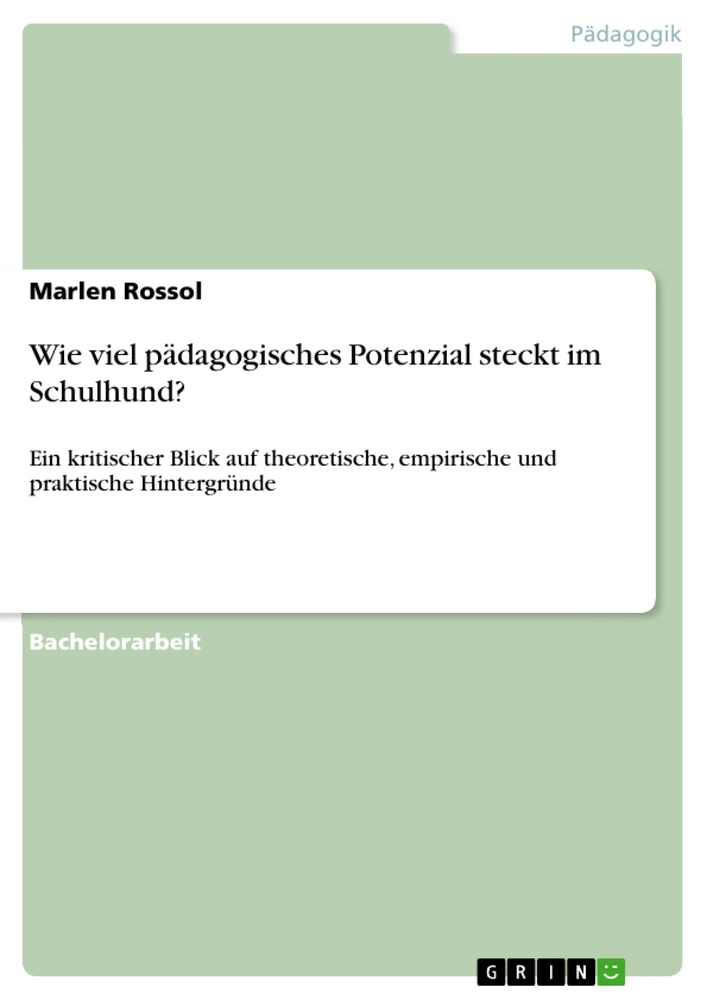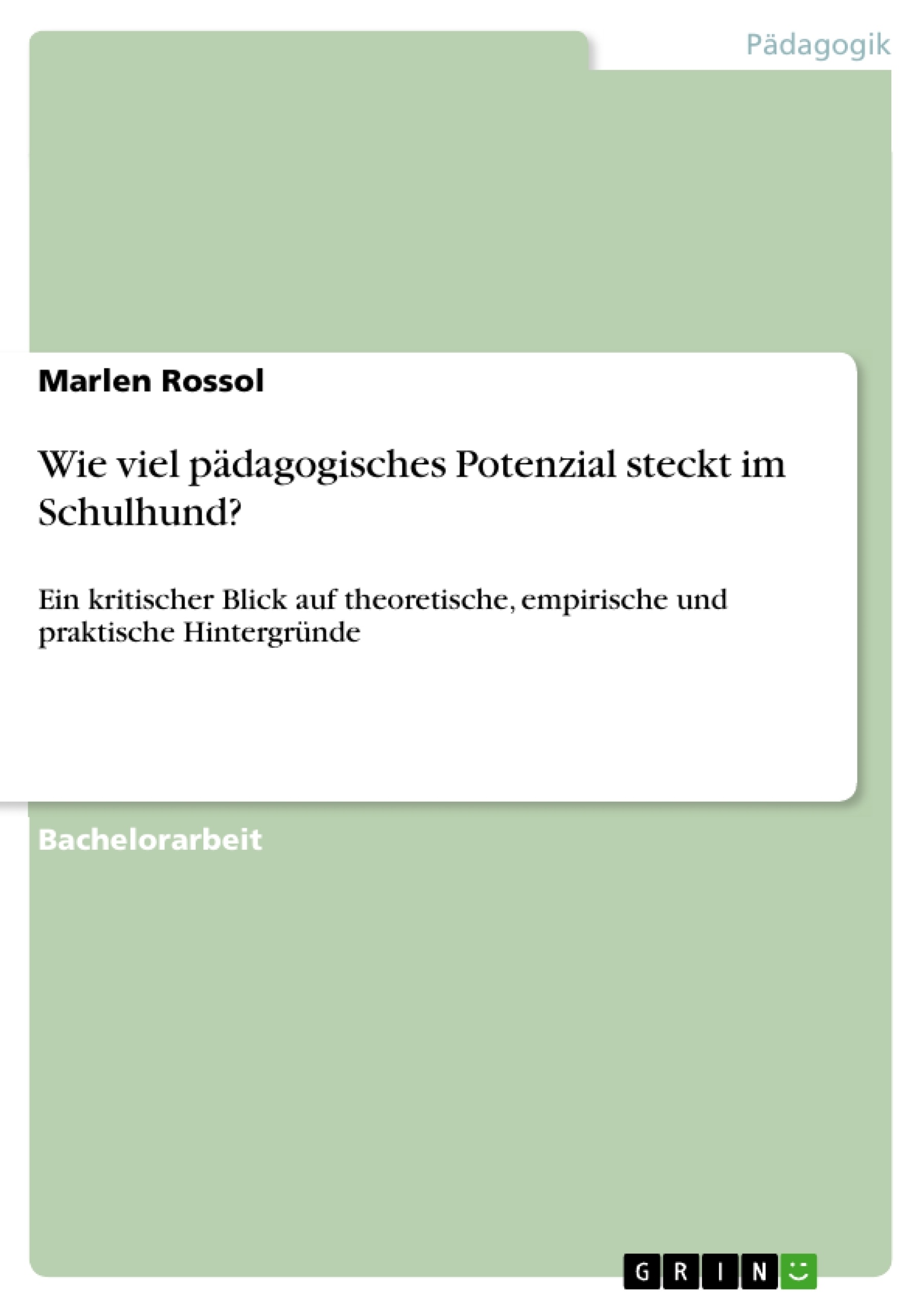Im Rahmen meiner Bachelorarbeit soll ein Blick hinter diese Aussagen geworfen werden. Es soll um das pädagogische Potenzial und damit um die Auseinandersetzung mit theoretischen, empirischen und praktischen Hintergründen in der Arbeit mit Schulhunden gehen.
Dabei soll vorerst die Verortung des Schulhundes innerhalb der Tiergestützten Arbeit thematisiert werden. So lässt sich der Schulhund von anderen Themenfeldern abgrenzen und es kommt eine gewisse Stabilität in die Begrifflichkeit. Ebenso spielt die Frage eine Rolle, was eigentlich den Einsatz eines Schulhundes aus theoretischer Sicht rechtfertigen könnte. Zu diesem Zweck soll ein kompakter Überblick über einige der in der Literatur behandelten Theorien zur Mensch-Tier-Beziehung gegeben werden.
Außerdem soll geklärt werden, ob der Einsatz eines Hundes im Klassenraum durch empirische Studien zur Wirkung von Hunden auf Menschen legitimiert werden kann. Dabei soll es spezifisch um die Auswirkungen auf den menschlichen Körper sowie auf sozial-emotionale Veränderungen im Beisein eines Hundes gehen.
Entscheidend für die Schulhund-Thematik ist überdies die Frage nach den gesetzlichen Grundlagen. Inwiefern greifen diese das Thema Schulhund auf? Welchen Einfluss hat die Gesetzgebung auf die Praxis des Schulhundes und inwieweit gibt es diesbezüglich Stimmen aus der Politik, auch aus anderen Ländern?
Ebenfalls behandelt werden sollen diverse Ausbildungsmöglichkeiten, die Pädagogen und Pädagoginnen mit ihrem Hund im Bereich des Schulhundes haben. Dabei soll vorgestellt werden, wer für die Angebote zuständig ist, was gelehrt wird und inwiefern eine solche Ausbildung nötig oder gar bindend im Einsatz von Hunden in der Schule ist oder sein sollte. Diesbezüglich wird auch ein Blick auf eine Umfrage von Lydia Agsten geworfen, die Lehrer, die mit Schulhunden arbeiten, nach deren Aus- und Weiterbildungen befragte.
Was ist, kann und soll ein sogenannter Schulhund? Ist dieser Hund in der Schule eher als eine Trendbewegung zu verstehen, die ohne jegliche Grundlage aus dem Boden geschossen ist und genau so schnell verschwindet, wie sie aufgetaucht ist? Oder hat der Schulhund tatsächlich pädagogisches Potenzial, das es wert ist gefördert und ausgeschöpft zu werden?
Diese Fragen sollen innerhalb dieser Bachelorarbeit anhand von theoretischem, praktischem und empirischem Material behandelt werden, um abschließend eine fundierte Aussage darüber treffen zu können, inwiefern tatsächlich pädagogisches Potenzial im Schulhund steckt
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Verortung des Schulhundes in der Tiergestützten Intervention
- Theorien zur Mensch-Tier-Beziehung
- Biophilie-Hypothese
- Bindungstheorie
- Hund und Wissenschaft
- Auswirkungen auf der biologisch-physischen Ebene
- Auswirkungen auf der sozial-emotionalen Ebene
- Ein Blick in die Praxis
- Gesetzesgrundlage für den Einsatz von Hunden in der Schule
- Eine Ausbildung für Mensch und Hund!
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das pädagogische Potenzial von Schulhunden. Sie analysiert die theoretischen, empirischen und praktischen Hintergründe des Einsatzes von Hunden im Schulunterricht. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte, darunter die Einordnung des Schulhundes in die Tiergestützte Intervention, die relevanten Theorien zur Mensch-Tier-Beziehung, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Auswirkungen von Hunden auf Menschen sowie die rechtlichen und praktischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Schulhunden.
- Verortung des Schulhundes in der Tiergestützten Intervention
- Theorien zur Mensch-Tier-Beziehung
- Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Auswirkungen von Hunden auf Menschen
- Rechtliche und praktische Rahmenbedingungen für den Einsatz von Schulhunden
- Pädagogisches Potenzial des Schulhundes
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema des Schulhundes vor und erläutert den persönlichen Bezug der Autorin. Sie führt die Thematik des pädagogischen Potenzials von Schulhunden ein und stellt die Forschungsfragen der Arbeit dar.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die Verortung des Schulhundes in der Tiergestützten Intervention und analysiert verschiedene Theorien zur Mensch-Tier-Beziehung, insbesondere die Biophilie-Hypothese und die Bindungstheorie.
- Hund und Wissenschaft: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von Hunden auf Menschen auf biologisch-physischer und sozial-emotionaler Ebene. Es werden wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien zu diesem Thema vorgestellt.
- Ein Blick in die Praxis: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen für den Einsatz von Hunden in der Schule. Es beleuchtet die Rolle der Gesetzgebung und untersucht verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten für Pädagogen und Pädagoginnen im Bereich des Schulhundes.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter der Arbeit sind Schulhund, Tiergestützte Intervention, Mensch-Tier-Beziehung, Biophilie-Hypothese, Bindungstheorie, pädagogisches Potenzial, wissenschaftliche Erkenntnisse, Rechtliche Rahmenbedingungen, Ausbildung, Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Schulhund?
Ein Schulhund ist ein speziell ausgebildeter Hund, der regelmäßig im Unterricht eingesetzt wird, um das Lernklima und die soziale Kompetenz der Schüler zu fördern.
Welche theoretischen Grundlagen rechtfertigen den Einsatz eines Hundes?
Zentral sind die Biophilie-Hypothese (angeborene Affinität zur Natur) und die Bindungstheorie, die die positive Wirkung von Tieren auf die menschliche Psyche erklären.
Welche biologischen Auswirkungen hat ein Hund auf Schüler?
Studien zeigen, dass die Anwesenheit eines Hundes den Blutdruck senken, Stresshormone reduzieren und zur allgemeinen Entspannung beitragen kann.
Gibt es gesetzliche Vorgaben für Schulhunde?
Ja, es müssen Hygienevorschriften, Versicherungsfragen und die Zustimmung der Schulkonferenz sowie der Eltern berücksichtigt werden.
Muss ein Schulhund eine spezielle Ausbildung haben?
Obwohl es nicht immer gesetzlich bindend ist, wird eine fundierte Ausbildung für das Mensch-Hund-Team dringend empfohlen, um Sicherheit und pädagogische Qualität zu gewährleisten.
- Citar trabajo
- Marlen Rossol (Autor), 2013, Wie viel pädagogisches Potenzial steckt im Schulhund?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271327