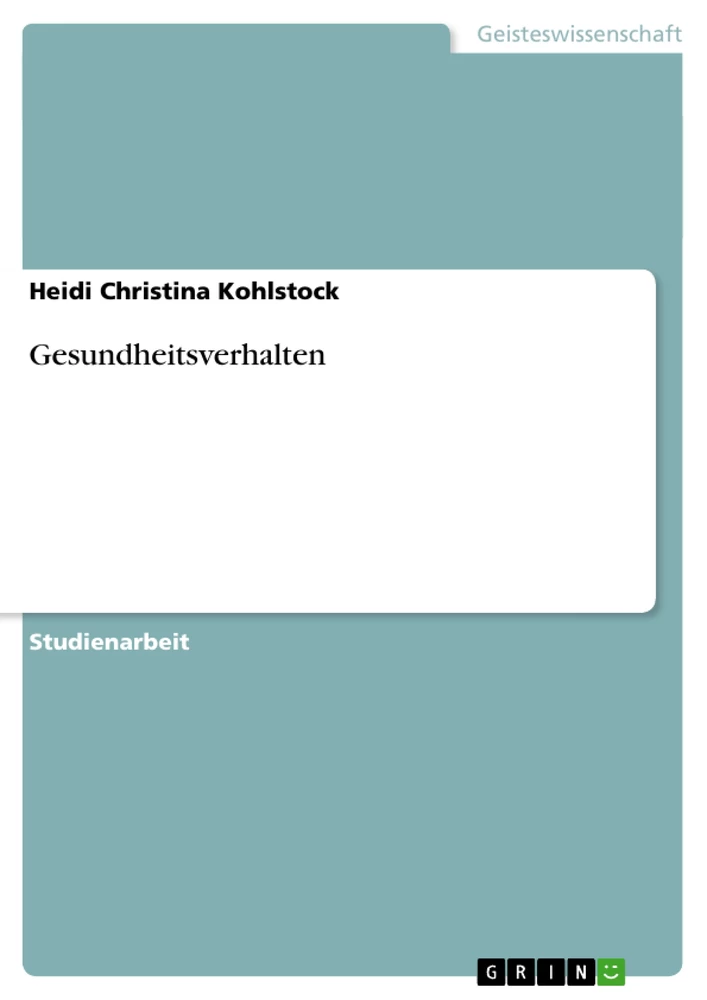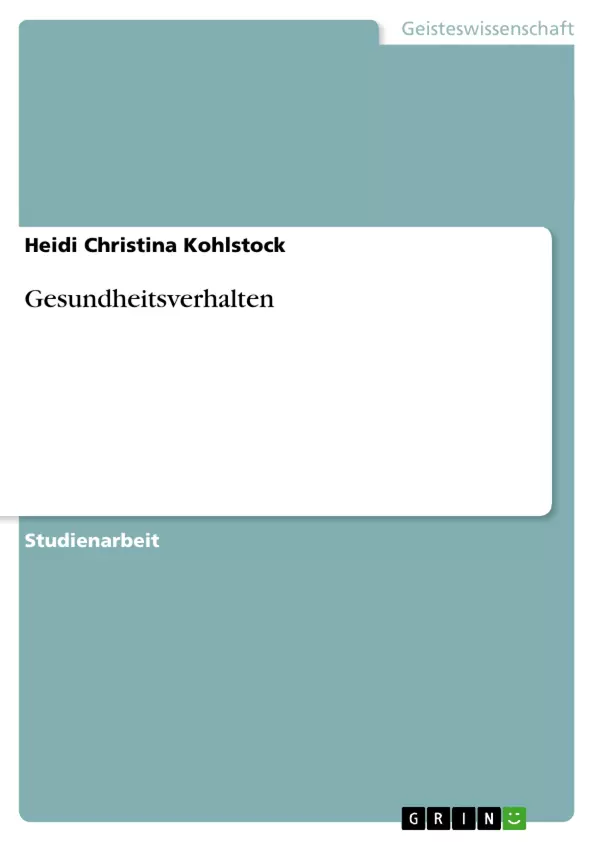Gesundheit nimmt eine enorme Rolle in der Gesellschaft ein. Sie ist zentral im Leben, denn bei Krankheit sind wir existenziell bedroht. Aus diesen Gründen ist ein ganzes Gesundheitssystem entstanden und größte Aufregungen entstehen, wenn wir Einschnitte im Gesundheitswesen bemerken. Wir haben gelernt, uns darauf zu verlassen, dass uns im Krankheitsfall kompetent geholfen wird. Nun aber bestehen in der Baden-Württembergischen CDU Konzepte, wie Krankenkassenbeiträge bei der Teilnahme an Präventionsprogrammen zu senken. Das fordert Eigeninitiative von Bürgern. Sie müssen ein Gesundheitsbewusstsein entwickeln, das von ihnen erwartet, aktiv einen positiven Beitrag zu ihrer Gesunderhaltung beizutragen. Nur: Was sind die Faktoren, mit denen sich Gesundheit beeinflussen lässt? Dieser Frage soll im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Definition Gesundheit
- 2. Krankheitsmodelle
- 3. Gesundheitsverhalten in der Gesellschaft
- 3.1 Gesundheitsressourcen
- 3.1.1 Physische Gesundheitsressourcen
- 3.1.2 Persönlichkeitseigenschaften als Gesundheitsressourcen
- 3.1.3 Verhaltensweisen als Gesundheitsressourcen
- 3.1.4 Lebensbedingungen als Gesundheitsressourcen
- 3.2 Gesundheitsrisiken
- 3.2.1 Personale Gesundheitsrisiken
- 3.2.1.1 Physische Gesundheitsrisiken
- 3.2.1.2 Psychische Gesundheitsrisiken
- 3.2.2 Verhalten als Gesundheitsrisiko
- 3.2.2.1 Überblick über gesundheitsschädliches Verhalten
- 3.2.2.2 Rauchen
- 3.2.3 Lebensbedingungen als Gesundheitsrisiken
- 3.2.1 Personale Gesundheitsrisiken
- 3.1 Gesundheitsressourcen
- 4. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Gesundheit, insbesondere die Rolle des Gesundheitsverhaltens. Ziel ist es, ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche Faktoren die Gesundheit positiv oder negativ beeinflussen und wie ein positives Gesundheitsbewusstsein gefördert werden kann.
- Definition von Gesundheit und unterschiedliche Perspektiven darauf
- Verschiedene Krankheitsmodelle und ihre Stärken und Schwächen
- Gesundheitsressourcen und -risiken im Kontext gesellschaftlicher Faktoren
- Der Einfluss von individuellem Verhalten auf die Gesundheit
- Die Bedeutung von Eigeninitiative und Gesundheitsbewusstsein
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Gesundheitsverhalten ein und beleuchtet die wachsende Bedeutung von Eigeninitiative im Kontext von Präventionsprogrammen und Gesundheitsvorsorge. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Einflussfaktoren auf die Gesundheit und den Rahmen der Arbeit dar.
1. Definition Gesundheit: Dieses Kapitel beleuchtet den komplexen Begriff der Gesundheit. Es werden verschiedene Definitionen vorgestellt, von der einfachen Abwesenheit von Krankheit bis hin zur umfassenden Definition der WHO, die physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden umfasst. Die Diskussion hebt die Schwierigkeiten hervor, Gesundheit umfassend zu definieren und eine allgemeingültige Messlatte zu setzen.
2. Krankheitsmodelle: Das Kapitel präsentiert verschiedene Krankheitsmodelle, beginnend mit dem medizinischen Modell, welches sich auf biologische Zusammenhänge konzentriert und psychosoziale Aspekte vernachlässigt. Kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen dieses Modells wird geleistet, und alternative Ansätze wie die Risikofaktorenmedizin und die Psychosomatik werden vorgestellt und bewertet, wobei deren jeweilige Stärken und Schwächen und die Gefahr der Einseitigkeit hervorgehoben werden. Die Diskussion zeigt die Komplexität des Verständnisses von Krankheit und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes.
3. Gesundheitsverhalten in der Gesellschaft: Dieser Abschnitt gliedert sich in Gesundheitsressourcen und Gesundheitsrisiken, wobei beide Bereiche sowohl personale als auch gesellschaftliche Faktoren berücksichtigen. Es werden diverse Beispiele für Ressourcen (physische, Persönlichkeitseigenschaften, Verhaltensweisen, Lebensbedingungen) und Risiken (physische und psychische Risikofaktoren, schädliches Verhalten, ungünstige Lebensbedingungen) detailliert erläutert, um ein umfassendes Bild der Faktoren zu zeichnen, die das Gesundheitsverhalten beeinflussen.
Schlüsselwörter
Gesundheitsverhalten, Gesundheit, Krankheitsmodelle, Gesundheitsressourcen, Gesundheitsrisiken, Prävention, Risikofaktoren, Psychosomatik, Wohlbefinden, Eigeninitiative, Gesundheitsbewusstsein.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Gesundheitsverhalten: Eine umfassende Übersicht"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Übersicht zum Thema Gesundheitsverhalten. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Definition von Gesundheit, eine Betrachtung verschiedener Krankheitsmodelle, eine detaillierte Analyse von Gesundheitsressourcen und -risiken im gesellschaftlichen Kontext und abschließende Schlussbemerkungen. Der Text enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Kernpunkte: Definition von Gesundheit aus verschiedenen Perspektiven (einschließlich der WHO-Definition), verschiedene Krankheitsmodelle (medizinisches Modell, Risikofaktorenmedizin, Psychosomatik) und deren Stärken und Schwächen, Gesundheitsressourcen (physische Ressourcen, Persönlichkeitseigenschaften, Verhaltensweisen, Lebensbedingungen) und Gesundheitsrisiken (personale und gesellschaftliche Faktoren, schädliches Verhalten wie Rauchen, ungünstige Lebensbedingungen), sowie die Bedeutung von Eigeninitiative und Gesundheitsbewusstsein.
Welche Krankheitsmodelle werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Krankheitsmodelle, darunter das rein biologisch orientierte medizinische Modell und seine Grenzen. Im Vergleich dazu werden alternative Ansätze wie die Risikofaktorenmedizin und die Psychosomatik vorgestellt und kritisch bewertet. Die Diskussion hebt die jeweilige Einseitigkeit und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes hervor.
Welche Faktoren beeinflussen das Gesundheitsverhalten?
Die Arbeit analysiert sowohl Gesundheitsressourcen als auch -risiken. Zu den Ressourcen gehören physische Faktoren, Persönlichkeitseigenschaften, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und günstige Lebensbedingungen. Zu den Risiken gehören physische und psychische Risikofaktoren, schädliches Verhalten (z.B. Rauchen) und ungünstige Lebensbedingungen. Der Text betont die Interaktion dieser Faktoren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zur Definition von Gesundheit, Krankheitsmodellen und Gesundheitsverhalten in der Gesellschaft (inklusive Ressourcen und Risiken). Sie schließt mit Schlussbemerkungen. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ermöglicht die gezielte Navigation durch den Text.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Gesundheitsverhalten, Gesundheit, Krankheitsmodelle, Gesundheitsressourcen, Gesundheitsrisiken, Prävention, Risikofaktoren, Psychosomatik, Wohlbefinden, Eigeninitiative, Gesundheitsbewusstsein.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein Verständnis für die Faktoren zu entwickeln, die die Gesundheit positiv oder negativ beeinflussen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Förderung eines positiven Gesundheitsbewusstseins und der Rolle der Eigeninitiative in der Gesundheitsvorsorge.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich umfassend über Gesundheitsverhalten informieren möchten. Sie eignet sich besonders für akademische Zwecke, z.B. für Studierende im Gesundheitswesen.
- Arbeit zitieren
- Heidi Christina Kohlstock (Autor:in), 2004, Gesundheitsverhalten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27135