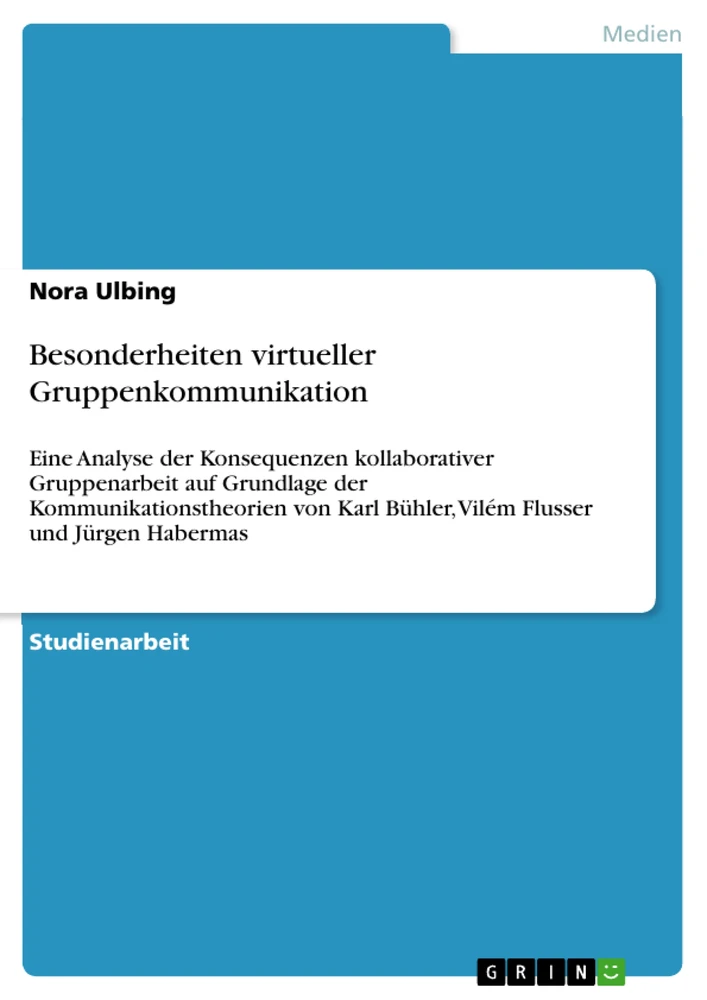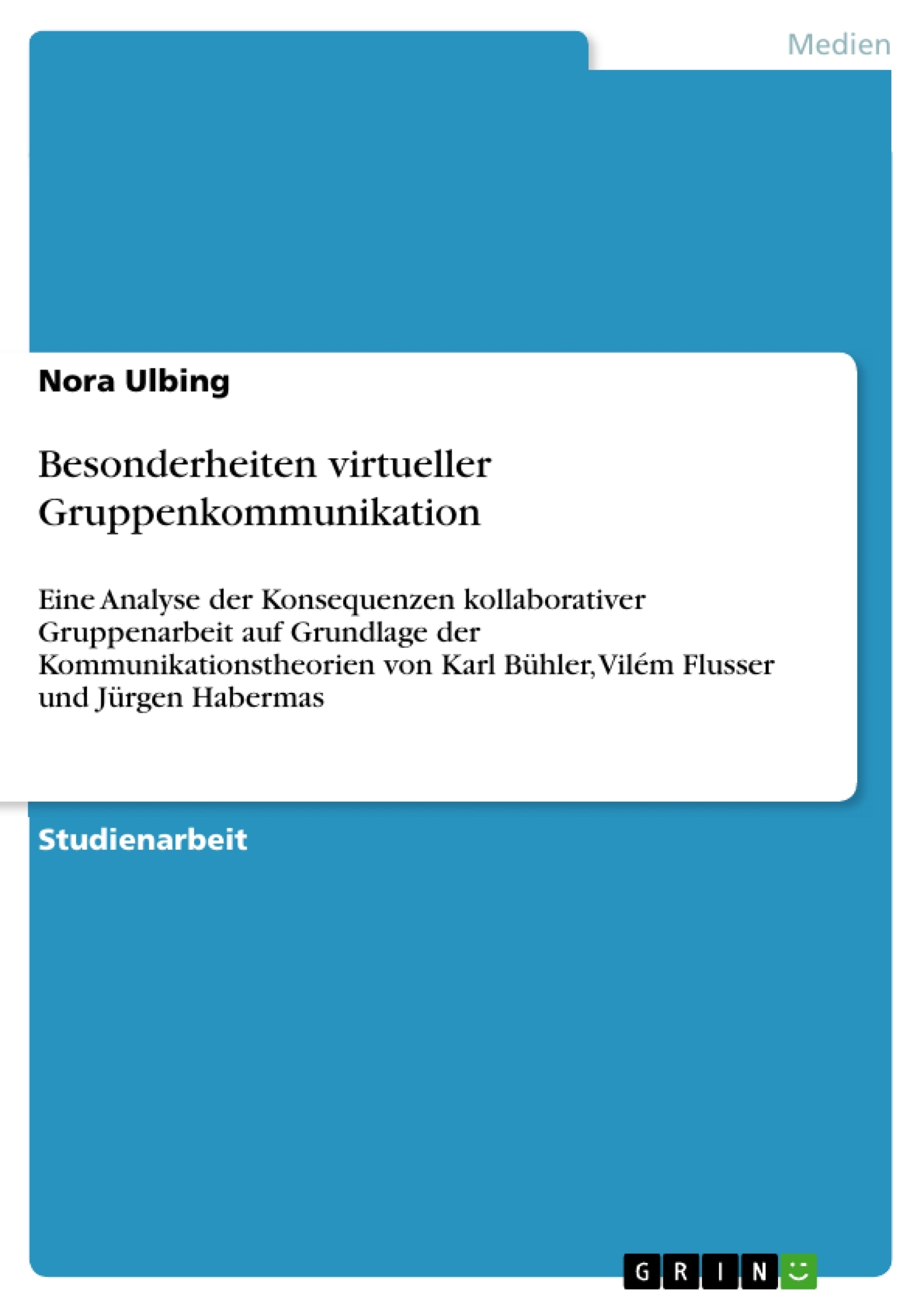Von der Tafel über den Overhead-Projektor bis hin zur Wissensvermittlung durch das Bildungsfernsehen in den 1970er Jahren, führte die technische Entwicklung in den letzten Jahren dazu, dass Gegenstand und Mittel, Massenmedien und Einzelmedien zusammengewachsen sind (Nuissl, 1996, S. 7). Den genannten primären Visualisierungsmöglichkeiten der Vergangenheit folgte schließlich das Internet mit seinem enormen Informationsangebot und zahlreichen Kommunikationsmöglichkeiten. Bezüglich der Zukunft von Kommunikationstheorie erläutert McQuail (1999, p. 11) „New communication technology is making more things possible, new knowledge and culture accessible, and it is increasing the speed, power and efficiency of all organised activities.“ Nicht nur die Kommunikationstheorie hat sich demnach verändert, auch die Unterstützung der Didaktik durch Medien hat sich in den letzten 20 Jahren auf rasante Art und Weise entwickelt (Boos, 2009, S. 89). Kommunikation mittels Neuen Medien wird demzufolge für die Lehre zu immer größerer Bedeutung. Somit bietet sich Lernenden gegenwärtig der Zugang in der virtuellen Welt der Medien, der Welt von Bildern und Informationen (Nuissl, 1996, S. 7), die Möglichkeit Wissen modern und innovativ zu erwerben. E-Learning hat im Hochschulsektor und Fernstudium in den vergangenen zehn Jahren eine enorme Entwicklung erfahren und ist im Mainstream angekommen (Zawacki-Richter, 2011, S. 5). Auch wenn der Einsatz von Multimedia zu einer Erhöhung der Qualität der Lehre führen kann, bringt nach Boos (2009, S. 90) der bloße Einsatz und die Verfügbarkeit von Multimedia und e-Learning noch keine didaktische Innovation. Ebenso vertritt Brandhofer (2012, S. 141) den Standpunkt das Technik alleine keinen pädagogischen Erfolg garantieren kann. „Das Lehren und Lernen über die Distanz erfordert grundsätzlich eine konzeptionelle Vorstellung davon, wie trotz fehlender räumlicher und sozialer Nähe gelehrt und gelernt werden kann“ (Dieckmann & Lehmann, 2011, S. 45). Neben einem fundierten Konzept sind Struktur und Dialog der Lernumgebung sowie eine aktive Beteiligung der Studierenden gemäß Dieckmann und Lehmann (2011, S. 45) unabdingbar für erfolgreiches Lernen im virtuellen Raum. Lernen als Individuum versus lernen in der Gruppe - Soziale Interaktion und Kommunikation sind maßgeblich für Lehr- und Lernkontexte. Sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich sind Gruppenentscheidungen wesentlich, da diese eine größere Wissensbasis aufweisen als ...
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Computervermittelte Kommunikation (cvK) in virtuellen Lernumgebungen
- 2.1 Kollaborative und kooperative Gruppenarbeit
- 2.2 Synchrone und asynchrone Kommunikation
- 2.3 Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL)
- 2.4 Selbstgesteuertes Lernen im Kontext virtueller Gruppenarbeit
- 2.5 Besonderheiten virtueller Gruppenkommunikation
- 3 Kommunikationstheorien im Kontext kollaborativer Gruppenarbeit
- 3.1 Die Funktionen der Sprache - Karl Bühlers Organon-Modell
- 3.2 Kommunikologie nach Vilém Flusser
- 3.3 Die Theorie des kommunikativen Handelns - Jürgen Habermas
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Besonderheiten virtueller Gruppenkommunikation im Kontext kollaborativer Lernprozesse. Sie untersucht die Konsequenzen kollaborativer Gruppenarbeit in virtuellen Lernumgebungen unter Berücksichtigung relevanter Kommunikationstheorien. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tiefergehendes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen der computervermittelten Kommunikation im Bildungskontext zu entwickeln.
- Computervermittelte Kommunikation (CvK) in virtuellen Lernumgebungen
- Kollaborative und kooperative Gruppenarbeit im virtuellen Raum
- Anwendbarkeit von Kommunikationstheorien (Bühler, Flusser, Habermas) auf virtuelle Gruppenarbeit
- Besonderheiten und Herausforderungen virtueller Gruppenkommunikation
- Selbstgesteuertes Lernen im Kontext virtueller Gruppenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung skizziert den Wandel der Wissensvermittlung von traditionellen Methoden hin zu computervermittelter Kommunikation und E-Learning. Sie betont die zunehmende Bedeutung neuer Medien für die Lehre und die Notwendigkeit eines fundierten didaktischen Konzepts für erfolgreiches Lernen im virtuellen Raum. Der Fokus liegt auf der Bedeutung sozialer Interaktion und Gruppenarbeit im Lernprozess und führt zur zentralen Forschungsfrage der Arbeit: Wie funktioniert kollaborative und kooperative Gruppenarbeit in virtuellen Lernumgebungen und welche Besonderheiten kennzeichnen diese Kommunikationsform?
2 Computervermittelte Kommunikation (cvK) in virtuellen Lernumgebungen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über computervermittelte Kommunikation in virtuellen Lernumgebungen. Es differenziert zwischen kollaborativer und kooperativer Gruppenarbeit sowie synchroner und asynchroner Kommunikation. Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) und selbstgesteuertes Lernen werden erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der spezifischen Eigenschaften und Herausforderungen der virtuellen Gruppenkommunikation, wobei die Komplexität dieser Kommunikationsform hervorgehoben wird und die Frage nach notwendigen Kriterien und Kompetenzen für eine erfolgreiche virtuelle Zusammenarbeit aufgeworfen wird.
3 Kommunikationstheorien im Kontext kollaborativer Gruppenarbeit: Dieses Kapitel analysiert drei zentrale Kommunikationstheorien – Bühlers Organon-Modell, Flussers Kommunikologie und Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns – im Hinblick auf ihre Relevanz für die virtuelle Gruppenarbeit. Es wird auf die jeweiligen Grundannahmen und Konzepte eingegangen und deren Anwendung auf den Kontext der computervermittelten Kommunikation diskutiert, um ein neues Verständnis von Kommunikation in virtuellen Lernumgebungen zu entwickeln. Die Analyse der unterschiedlichen theoretischen Perspektiven dient dazu, die Besonderheiten und Herausforderungen virtueller Gruppenkommunikation aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Virtuelle Gruppenkommunikation, Kollaborative Gruppenarbeit, Computervermittelte Kommunikation (CvK), E-Learning, Kommunikationstheorien, Bühler, Flusser, Habermas, Selbstgesteuertes Lernen, Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL), Synchrone und Asynchrone Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Virtuelle Gruppenkommunikation in kollaborativen Lernprozessen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert die Besonderheiten virtueller Gruppenkommunikation im Kontext kollaborativer Lernprozesse. Sie untersucht die Konsequenzen kollaborativer Gruppenarbeit in virtuellen Lernumgebungen unter Berücksichtigung relevanter Kommunikationstheorien. Ziel ist ein tiefergehendes Verständnis der Herausforderungen und Chancen computervermittelter Kommunikation im Bildungskontext.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt computervermittelte Kommunikation (CvK) in virtuellen Lernumgebungen, kollaborative und kooperative Gruppenarbeit im virtuellen Raum, die Anwendbarkeit von Kommunikationstheorien (Bühler, Flusser, Habermas) auf virtuelle Gruppenarbeit, Besonderheiten und Herausforderungen virtueller Gruppenkommunikation sowie selbstgesteuertes Lernen im Kontext virtueller Gruppenarbeit.
Welche Kommunikationstheorien werden untersucht?
Die Hausarbeit analysiert drei zentrale Kommunikationstheorien: Bühlers Organon-Modell, Flussers Kommunikologie und Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns. Diese werden auf ihre Relevanz für virtuelle Gruppenarbeit untersucht und deren Anwendung auf computervermittelte Kommunikation diskutiert.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über computervermittelte Kommunikation in virtuellen Lernumgebungen, ein Kapitel zur Anwendung von Kommunikationstheorien auf kollaborative Gruppenarbeit und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über die jeweiligen Themen.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit liefert ein vertieftes Verständnis der Besonderheiten und Herausforderungen virtueller Gruppenkommunikation. Sie zeigt die Anwendbarkeit verschiedener Kommunikationstheorien auf diesen Kontext und beleuchtet die Bedeutung von selbstgesteuertem Lernen in virtuellen Gruppenarbeitsprozessen. Die genauen Ergebnisse sind im Detail in den Kapiteln der Arbeit dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Virtuelle Gruppenkommunikation, Kollaborative Gruppenarbeit, Computervermittelte Kommunikation (CvK), E-Learning, Kommunikationstheorien, Bühler, Flusser, Habermas, Selbstgesteuertes Lernen, Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL), Synchrone und Asynchrone Kommunikation.
Welche Art von Gruppenarbeit wird betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen kollaborativer und kooperativer Gruppenarbeit und untersucht die Besonderheiten beider Formen im virtuellen Raum. Dabei wird auch auf die Herausforderungen und Chancen dieser Arbeitsweisen eingegangen.
Welche Rolle spielt das selbstgesteuerte Lernen?
Selbstgesteuertes Lernen wird als wichtiger Aspekt der virtuellen Gruppenarbeit betrachtet. Die Arbeit untersucht, wie Selbststeuerung im Kontext virtueller Zusammenarbeit funktioniert und welche Rolle sie für den Erfolg spielt.
Welche Arten von Kommunikation werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation im Kontext virtueller Gruppenarbeit und analysiert die Vor- und Nachteile beider Formen.
- Arbeit zitieren
- BEd Nora Ulbing (Autor:in), 2014, Besonderheiten virtueller Gruppenkommunikation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271585