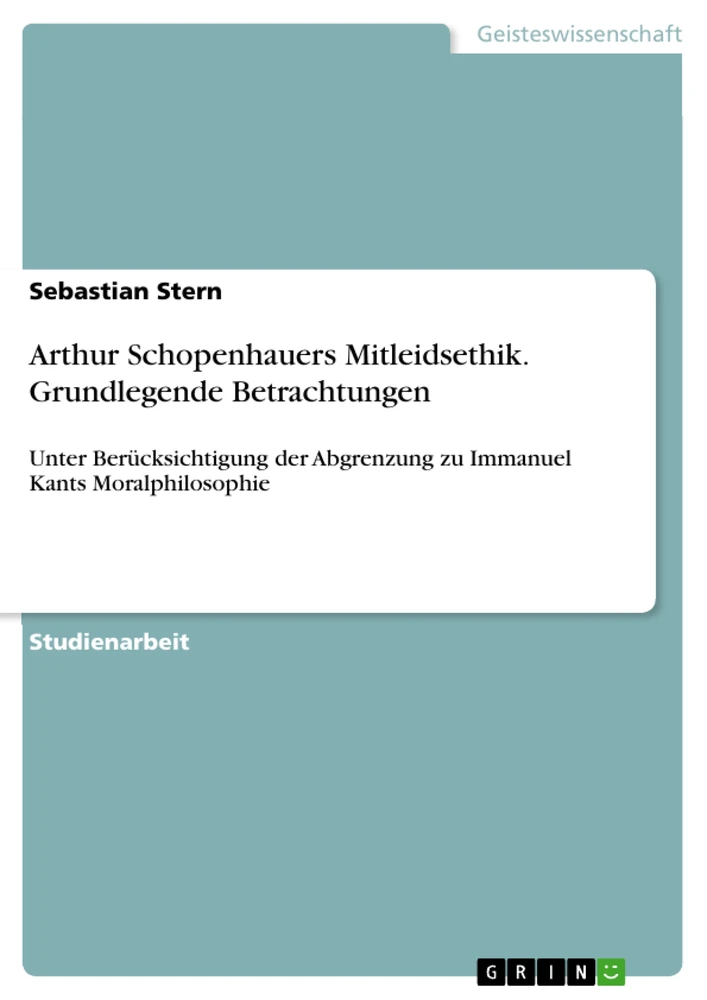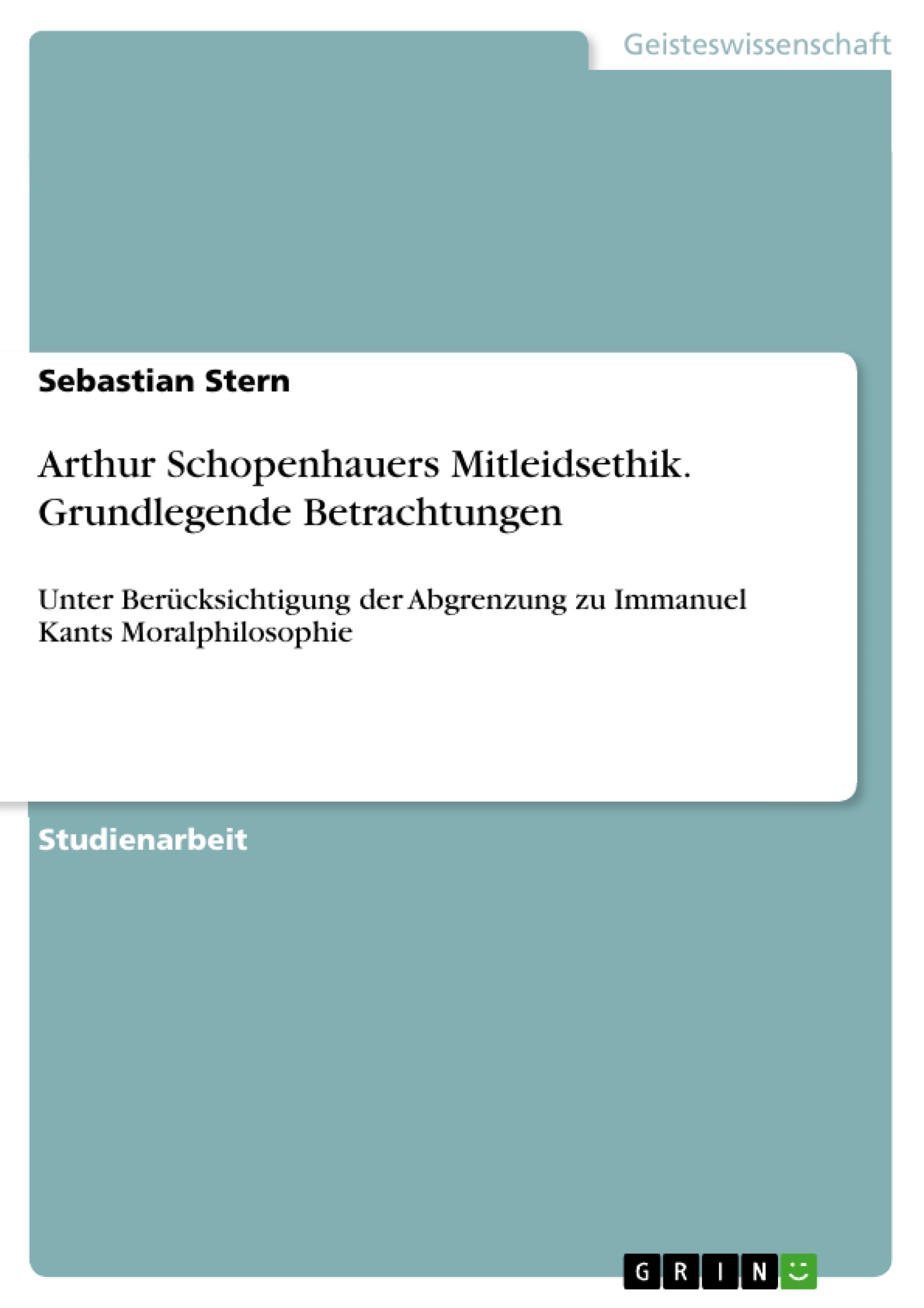Die Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit besteht darin, grundlegende Betrachtungen zu Arthur Schopenhauers Mitleidsethik vorzunehmen. Arthur Schopenhauers Kritik an Immanuel Kants Moralphilosophie bildet einen großen Teil dieser Arbeit, da der Autor das Herausstellen der Unterschiede beider Ethiken als äußerst relevant ansieht, um Arthur Schopenhauers Mitleidsethik verstehen zu können. Schopenhauer selbst geht, in seiner Schrift „Über die Grundlage der Moral“ (1840), ausführlich auf die Unterschiede beider Konzepte ein.
Um den ethischen Entwurf Schopenhauers verstehen zu können, erscheint es dem Autor weiterhin als relevant, die Erkenntnistheorie und die Metaphysik Schopenhauers, zumindest in ihren gröbsten Zügen, zu beleuchten, da diese – laut Schopenhauer - das Fundament seiner Ethik bilden. Daher werden sowohl erkenntnistheoretische als auch metaphysische Aspekte der eigentlichen Aufgabenstellung vorangestellt.
In diesem Zuge wird Schopenhauers als Dissertation verfasstes Werk „Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde“ (1813) knapp dargestellt, um die Motive menschlichen Handelns zu verdeutlichen.
Die Begriffe des Verstandes und der Vernunft bedürfen ebenfalls einer Explikation, da diese, obwohl sie in der Tradition des subjektiven Idealismus stehen, von Schopenhauer neu definiert werden.
Auf die Darstellung der Erkenntnistheorie folgt eine Ausführung über Schopenhauers Metaphysik, die in erster Linie den Willen als die allem zugrunde liegende treibende Kraft des Daseins – als das Ding an sich – ausmacht. Dieser Wille entpuppt sich im weiteren Verlauf als das Ur-Übel in der Welt, welches der vorgestellten Existenz eine absolute Sinnlosigkeit verleiht.
Im zweiten Teil dieser Arbeit werden die Kernelemente und -aussagen der Mitleidsethik dargelegt. Zentrale Gesichtspunkte sind hierbei die drei Grundtriebfedern menschlichen Handelns – Egoismus, Bosheit und Mitleid – anhand derer Schopenhauer die charakterlichen Ausprägungen in der Welt erklärt und deren Konsequenzen er für eine sinnvolle Lebensgestaltung aufzeigt. Des weiteren wird die Bedeutung des Mitleids als Zugang zur menschlichen Erkenntnis verdeutlicht und darüber hinaus erläutert, wie diese Erkenntnis zur Erlösung von allem menschlichen Leiden führen kann. Es wird jedoch klar herausgestellt, dass das Mitleid nicht als Mittel zur Verbesserung der Welt anzusehen ist, sondern als Zugang zur Negation des Willens.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Bemerkungen
- Philosophische Grundannahmen Schopenhauers
- Erkenntnistheoretische und metaphysische Aspekte
- Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde
- Der Verstand und die Vernunft
- Die Metaphysik Schopenhauers
- Der Wille als Ursprung allen Leidens
- Schopenhauers Ethik
- Der Egoismus
- Die Bosheit
- Die Charakteristik einer moralischen Handlung
- Das Mitleid
- Überwindung des Willens durch das Mitleid
- Metaphysischer Erklärungsversuch der schopenhauerschen Ethik
- Schopenhauers Kritik an Kants Ethik
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Arthur Schopenhauers Mitleidsethik und untersucht ihre grundlegenden Elemente. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kritik an Immanuel Kants Moralphilosophie und der Hervorhebung der Unterschiede zwischen beiden Ethiken. Darüber hinaus werden Schopenhauers Erkenntnistheorie und Metaphysik beleuchtet, um die Fundamente seiner Ethik zu verstehen.
- Schopenhauers Kritik an Kants Moralphilosophie
- Analyse der Mitleidsethik
- Erkenntnistheoretische und metaphysische Grundlagen von Schopenhauers Philosophie
- Der Wille als Ursprung von Leid und seine Überwindung durch das Mitleid
- Die Bedeutung des Mitleids für eine sinnvolle Lebensgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in Schopenhauers philosophische Grundannahmen und beleuchtet seine Skepsis hinsichtlich der Möglichkeit, das Dasein aus seinen letzten Gründen heraus zu erklären. Im zweiten Kapitel werden Schopenhauers Erkenntnistheorie und Metaphysik erläutert, wobei der Wille als das Ding an sich und Ursprung allen Leidens vorgestellt wird. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Kernelementen der Mitleidsethik: Egoismus, Bosheit und Mitleid. Hier werden die charakterlichen Ausprägungen in der Welt und deren Konsequenzen für eine sinnvolle Lebensgestaltung betrachtet. Außerdem wird die Bedeutung des Mitleids als Zugang zur menschlichen Erkenntnis und seine Rolle bei der Überwindung des Willens erläutert. Abschließend wird Schopenhauers Kritik an Kants Moralphilosophie analysiert, wobei die Hauptunterschiede beider Entwürfe, wie beispielsweise der rein deskriptive Charakter der Schopenhauerschen Ethik im Vergleich zu Kants imperativer "Sollens-Ethik", herausgestellt werden.
Schlüsselwörter
Schopenhauers Mitleidsethik, Erkenntnistheorie, Metaphysik, Wille, Leid, Egoismus, Bosheit, Mitleid, Überwindung des Willens, Kant, Moralphilosophie, kategorischer Imperativ, "Sollens-Ethik", "Ding an sich", subjektiver Idealismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Fundament von Schopenhauers Ethik?
Das Fundament bilden seine Erkenntnistheorie und Metaphysik, insbesondere die Lehre vom "Willen" als dem Ding an sich.
Welche drei Grundtriebfedern menschlichen Handelns nennt Schopenhauer?
Schopenhauer unterscheidet zwischen Egoismus, Bosheit und Mitleid.
Wie unterscheidet sich Schopenhauers Ethik von der Kants?
Während Kant eine imperative "Sollens-Ethik" (kategorischer Imperativ) vertritt, ist Schopenhauers Ethik rein deskriptiv und basiert auf dem Mitleid als empirischem Phänomen.
Was ist der "Wille" bei Schopenhauer?
Der Wille ist die allem zugrunde liegende, blinde und triebhafte Kraft des Daseins, die Schopenhauer als Ursprung allen Leidens ansieht.
Kann Mitleid die Welt verbessern?
Laut Schopenhauer ist Mitleid nicht primär ein Mittel zur Weltverbesserung, sondern ein Zugang zur Erkenntnis und letztlich zur Negation des leidvollen Willens.
Was ist die "vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde"?
Es ist Schopenhauers Dissertation, in der er die logischen Strukturen unserer Erkenntnis und die Motive menschlichen Handelns analysiert.
- Quote paper
- Sebastian Stern (Author), 2014, Arthur Schopenhauers Mitleidsethik. Grundlegende Betrachtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271601