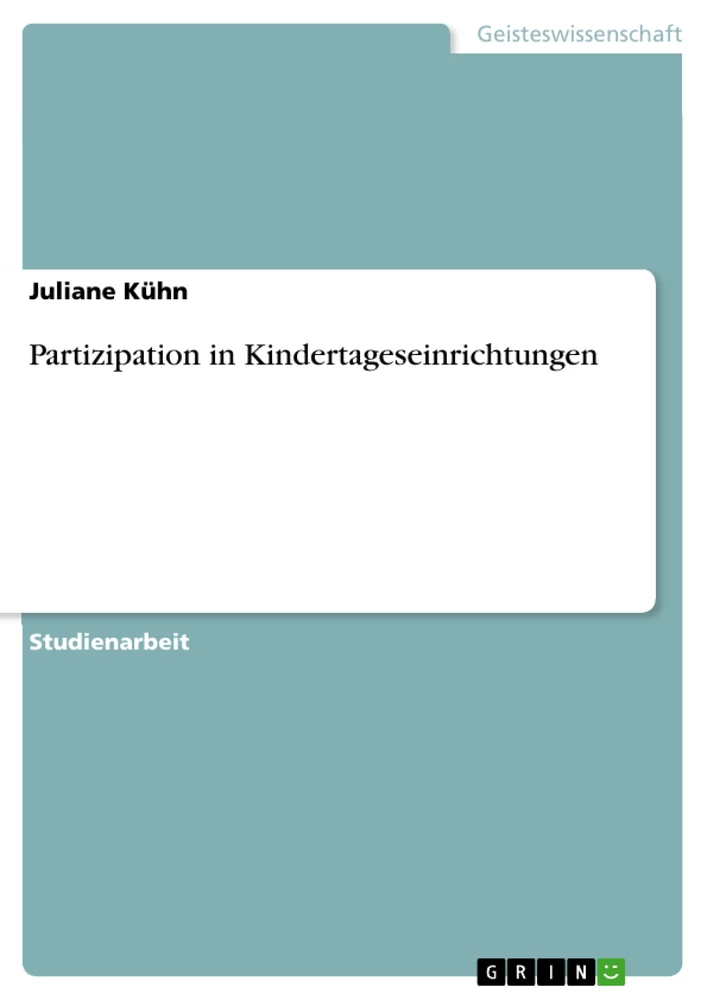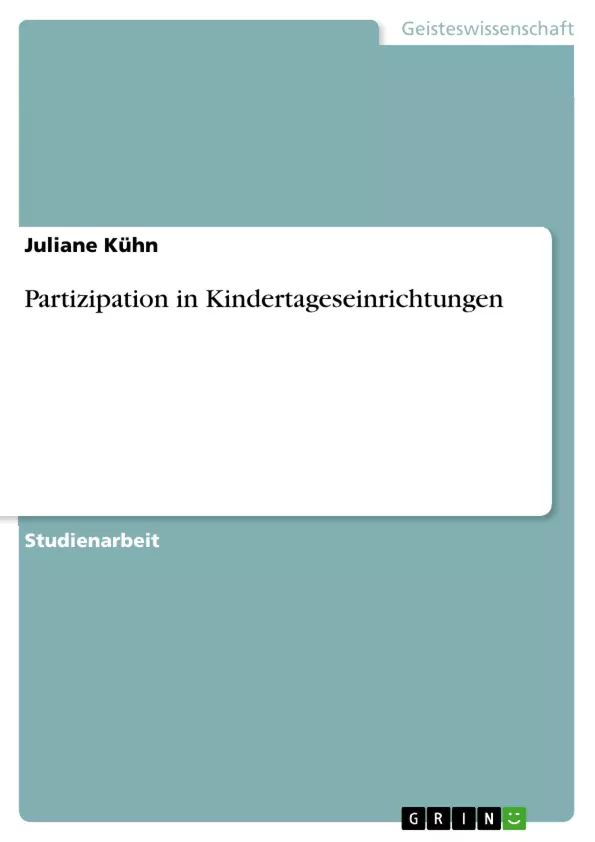Partizipation ist in den letzten Jahren ein immer relevanteres Thema in Politik und Medien geworden. In sozialen Einrichtungen wird immer mehr diskutiert, wie Adressaten mehr an den Prozessen beteiligt werden können und wie Partizipation praktisch umgesetzt werden kann.
Auch im Bereich der frühkindlichen Bildung sollen Kinder aktiv ihre Umwelt mitge-stalten und über relevante Entscheidungen, die ihren Alltag betreffen, mitentscheiden dürfen. In diesem Zuge wird oft diskutiert, inwiefern Kinder schon kompetent genug sind, um aktiv partizipieren zu können oder wie groß der Partizipationsspielraum sich gestalten lässt. Fehlen ihnen nicht die Erfahrungen und die Weitsicht der Erwachsenen? Wie kann Partizipation in Kindertageseinrichtungen aussehen und wo gibt es Grenzen?
Diese Fragen sollen in der vorliegenden Hausarbeit diskutiert und beantwortet werden. Zunächst soll kurz der Begriff ‚Partizipation‘ definiert werden und recht¬liche Grundlagen beschrieben werden. Des Weiteren soll die Bedeutung von Partizipation für Kinder dargelegt werden.
Im nächsten Kapitel sollen das Menschenbild, die Grundhaltung und dialogische Fähigkeiten der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen als Voraussetzungen für eine gelingende Partizipation beschrieben werden. Den Hauptteil der Arbeit nehmen Methoden und Beispiele für Partizipation in Kindertageseinrichtungen ein. In der Zusammenfassung und im Ausblick werden die Grenzen von Partizipation diskutiert.
Die Arbeit ist dabei sehr an der Praxis orientiert und soll beleuchten, wie Partizipation exemplarisch am Beispiel der Kindertageseinrichtung umgesetzt werden kann.
Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über die Möglichkeiten von Partizipation in Kindertageseinrichtungen zu geben und darzustellen, warum Partizipation so relevant für Kinder ist. Die Arbeit bezieht sich dabei ausschließlich auf die Bundesrepublik Deutschland und den gängigen kulturellen und rechtlichen Gegebenheiten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretischer Überblick
2.1. Definition von Partizipation
2.2. Rechtliche Regelungen
2.3. Relevanz der Partizipation für Kinder
3. Voraussetzungen für eine gelingende Partizipation
3.1. Menschenbild und Grundhaltung
3.2. Dialog
4. Beispiele und Methoden für Partizipation in Kindertageseinrichtungen
4.1. Mitentscheiden im Alltag
4.2. Kinderrat/Kinderkonferenz
4.3. Projektarbeit
4.4. Weitere Methoden
5. Zusammenfassung und Ausblick
5.1. Grenzen
5.2. Zusammenfassung
5.3. Ausblick
6. Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Juliane Kühn (Author), 2014, Partizipation in Kindertageseinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271670