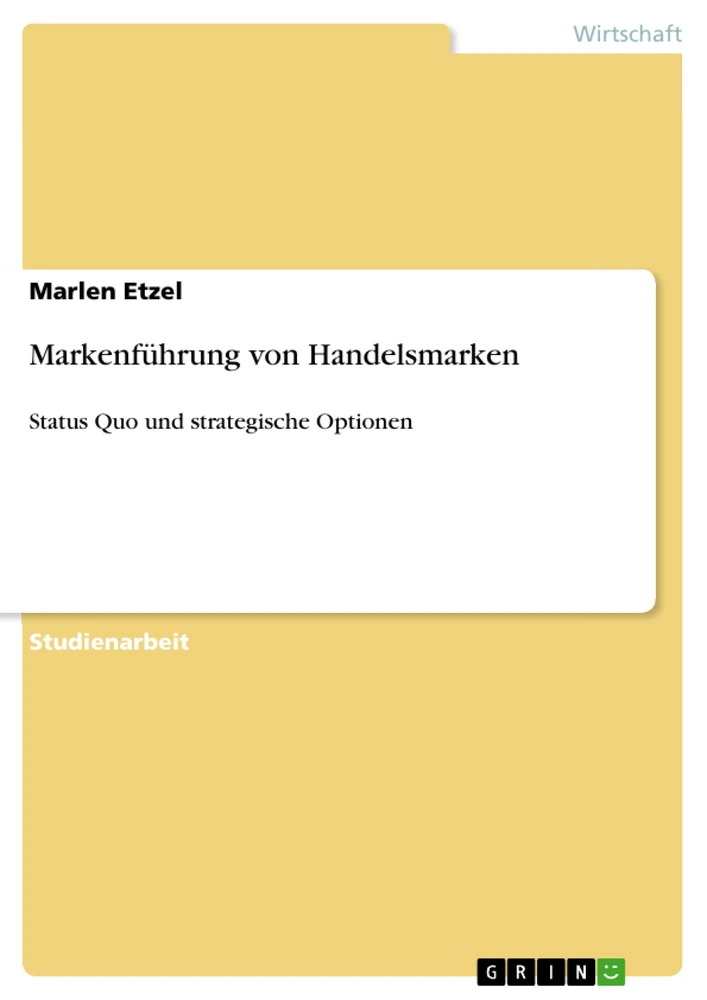„Die Billig-Idee braucht neue Impulse!“ verkündet die GfK in ihrem CosumerScan. Die Handelsmarke, die von den Discountern zur Blüte getriebenen wurde, benötigt neue Anstöße in ihrer Weiterentwicklung. Das Mengenwachstum von Gütern des täglichen Bedarfs stagniert und Umsatzwachstum im Lebensmitteleinzelhandel wird nur noch durch höhere Preise generiert. Und genau dort tritt die Markenführung der Handelsmarken in Kraft. Durch professionell geführte Handelsmarken können sich Einkaufsstätten vom Wettbewerb differenzieren, um den Kampf um den Kunden zu gewinnen. Die Markenführung kann auf einer soliden Basis aufbauen: Ein Drittel der Verbraucher sind der Ansicht, dass viele Handelsmarken eine bessere Qualität haben als Herstellermarken. Zusätzlich wäre jeder vierte Verbraucher bereit, für eine Handelsmarke denselben oder sogar einen höheren Preis, als für vergleichbare Herstellermarken zu zahlen. Allmählich erwacht der Handel aus seinem Schneewittchenschlaf und stellt sich dieser Nachfrage. Vielmehr noch, der Handel begibt sich in das terra incognita der vertikalen Integration, um möglichst viel Einfluss entlang der Wertschöpfungskette nehmen zu können. Handelsmarken sind längst keine reinen Imitate von erfolgreichen Herstellermarken mehr, sondern qualitativ hochwertige, eigene starke Marken, die besonders und speziell betreut werden müssen.
Diese Entwicklung zeigt die Wichtigkeit der professionellen Markenführung und wirft die Frage auf, wie ein Unternehmen Handelsmarken am profitabelsten führen kann. Die vorliegende Arbeit soll die Möglichkeiten darstellen, in welchem strategischen Rahmen sich die Handelsunternehmen bewegen können, um das Potenzial der Handelsmarken voll auszuschöpfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aktualität des Themas
- Zielsetzung und Aufbau
- Grundlagen der Handelsmarkenführung
- Marken- und Handelsmarkenbegriff
- Markenführung von Handelsmarken
- Ziele und Funktionen der Handelsmarkenführung
- Handelsmarkenführung: Entwicklung und Status quo
- Der Entwicklungsprozess
- Aktueller Stellenwert der Handelsmarkenführung
- Strategische Optionen der Handelsmarkenführung
- Umfang der Handelsmarkenführung
- Wahl des Handelsmarkentyps
- Handelsmarkenführungsstrategien
- Fallbeispiel REWE Feine Welt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die verschiedenen Möglichkeiten der Markenführung von Handelsmarken zu beleuchten und ein tieferes Verständnis für die Zielsetzung und Funktionen dieser Strategie zu vermitteln. Dabei wird der Fokus auf die strategischen Optionen gelegt, die Handelsunternehmen zur Verfügung stehen, um das Potenzial von Handelsmarken voll auszuschöpfen.
- Entwicklung und Status quo der Handelsmarkenführung
- Ziele und Funktionen der Markenführung von Handelsmarken
- Strategische Optionen der Handelsmarkenführung
- Praxisbeispiele und Fallstudien
- Potenzial und Herausforderungen der Handelsmarkenführung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die aktuelle Bedeutung der Handelsmarken und die Notwendigkeit einer professionellen Markenführung in einem wettbewerbsintensiven Markt.
- Grundlagen der Handelsmarkenführung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Marke und der Handelsmarke und untersucht die Ziele und Funktionen der Markenführung von Handelsmarken.
- Handelsmarkenführung: Entwicklung und Status quo: Dieses Kapitel zeichnet den Entwicklungsprozess der Handelsmarken nach und analysiert den aktuellen Stellenwert der Handelsmarkenführung.
- Strategische Optionen der Handelsmarkenführung: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen strategischen Optionen der Handelsmarkenführung, wie beispielsweise dem Umfang der Handelsmarkenführung, der Wahl des Handelsmarkentyps und der Auswahl geeigneter Handelsmarkenführungsstrategien.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Handelsmarkenführung, Markenstrategie, Markenmanagement, Markenentwicklung, Markenpositionierung, Handelsmarkenpolitik, Strategische Optionen, Fallbeispiel REWE Feine Welt.
Häufig gestellte Fragen
Wie haben sich Handelsmarken entwickelt?
Handelsmarken haben sich von reinen Billig-Imitaten zu qualitativ hochwertigen Eigenmarken entwickelt, die teilweise denselben Status wie Herstellermarken genießen.
Welche strategischen Ziele verfolgt die Handelsmarkenführung?
Ziele sind die Differenzierung vom Wettbewerb, die Steigerung der Kundenbindung und die Erhöhung der Profitabilität durch vertikale Integration.
Was ist das Fallbeispiel "REWE Feine Welt"?
Es dient als Beispiel für eine Premium-Handelsmarke, die durch professionelle Markenführung eine hohe Wertschätzung und Qualität signalisiert.
Sind Verbraucher bereit, für Handelsmarken mehr zu bezahlen?
Laut Studien wäre jeder vierte Verbraucher bereit, für eine starke Handelsmarke denselben oder sogar einen höheren Preis als für eine Herstellermarke zu zahlen.
Was bedeutet vertikale Integration im Handel?
Es bedeutet, dass Handelsunternehmen verstärkt Einfluss auf die gesamte Wertschöpfungskette (Produktion bis Verkauf) nehmen, um Qualität und Kosten besser zu kontrollieren.
- Citation du texte
- Marlen Etzel (Auteur), 2013, Markenführung von Handelsmarken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271795