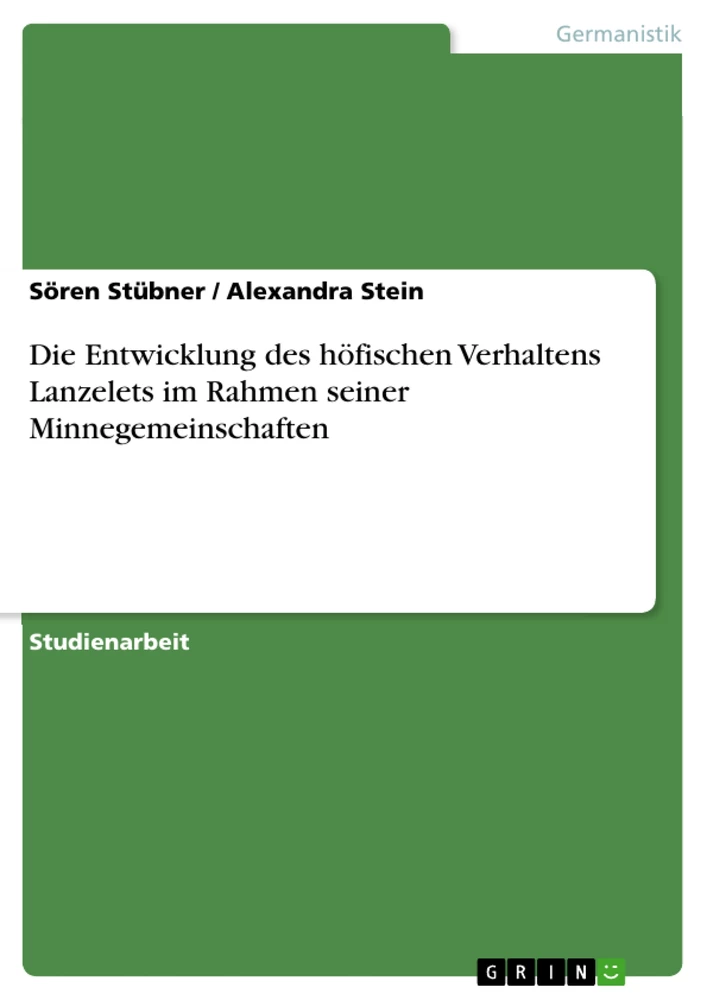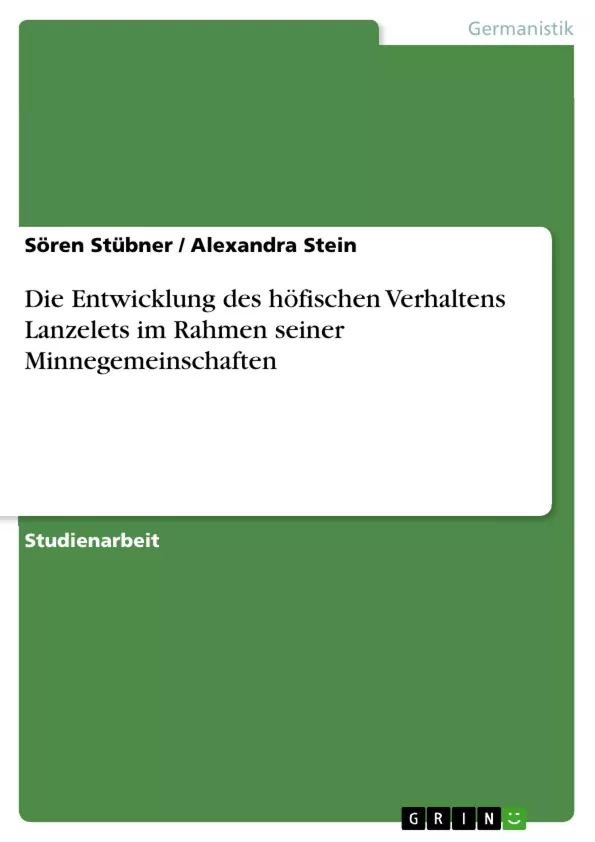Bei Ulrichs von Zatzikhoven Lanzelet handelt es sich um ein stark kritisiertes und diskutiertes Stück Artusdichtung, das frühestens 1194 entstand und auf einer altfranzösischen Quelle basiert. Zatzikhoven wird allgemein gleichgesetzt mit dem Autor, da er dieses welshez bouch ins Deutsche übersetzte. Über seine Person ist bisher wenig bekannt. Seine erste Erwähnung fand er in einer Urkunde von St. Galler 1214, in der er als ein Dorfpfarrer von Lommis bei Zezikon bezeichnet wird.
Nach einer Ausführung über den aktuellen Forschungsgegenstand folgt eine prägnante Begriffsklärung über die Thematik des höfischen Verhaltens sowie eine Darstellung einiger grundlegender Informationen über die Erziehung Lanzelets im Reich der merfeine, die dem Rezipienten als Ausgangspunkt für die darauffolgende detaillierte Analyse der einzelnen Minneszenen dienen soll. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Untersuchung sich nicht auf die Funktion der einzelnen Episoden im gesamten Werk bezieht, sondern spezifisch die Entwicklung des höfischen Verhalten Lanzelets in Bezug zu dessen Minneszenen eruiert. Es wird ein Vergleich angestrebt, der den Beginn der Reise des Helden mit dem Verlassen des Feenreichs bis zu der Minnegemeinschaft mit der Königin von Plûrîs einbezieht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsgegenstand
- Begriffsklärung höfisches Verhalten
- Lanzelets Erziehung im Reich der meffeine
- Die Entwicklung des höfischen Verhaltens Lanzelets in Beziehung zu seinen Minnegemeinschaften
- Galagandreiztochter
- Korrelation von éventiure und minne
- Minnedame im Kontext der adäquaten Ehefrau
- Erzählerhinweise hinsichtlich der Minnedame
- Ade
- Korrelation von éventiure und minne
- Minnedame im Kontext der adäquaten Ehefrau
- Erzählerhinweise hinsichtlich der Minnedame
- Ibiis
- Korrelation von éventiure und minne
- Minnedame im Kontext der adäquaten Ehefrau
- Erzählerhinweise hinsichtlich der Minnedame
- Zwischenfazit
- Königin von Plüris
- Korrelation von éventiure und minne
- Minnedame im Kontext der adäquaten Ehefrau
- Erzählerhinweise hinsichtlich der Minnedame
- Schlussfolgerung
- Galagandreiztochter
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Entwicklung des höfischen Verhaltens des Protagonisten Lanzelet in Ulrich von Zatzikhovens gleichnamigem Werk. Die Analyse fokussiert dabei auf die Beziehung zwischen Lanzelets Minnegemeinschaften und seinem ritterlichen Verhalten. Ziel ist es, zu ergründen, ob Lanzelet im Verlauf der Erzählung sein höfisches Verhalten vervollkommnet oder ob die Idealisierung, die der Erzähler zu Beginn des Romans vermittelt, gerechtfertigt ist.
- Die Rolle der Erziehung im Reich der meffeine für die Entwicklung des höfischen Verhaltens Lanzelets
- Die Korrelation von éventiure und minne in den einzelnen Minneszenen
- Die Analyse der Minnedamen im Kontext der adäquaten Ehefrau
- Die Bedeutung der Erzählerhinweise hinsichtlich der Minnedamen für die Beurteilung des höfischen Verhaltens Lanzelets
- Die Frage, ob Lanzelets höfisches Verhalten im Verlauf der Minnegemeinschaften eine Steigerung erfährt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand und die Begriffsklärung des höfischen Verhaltens vor. Dabei wird auf die umstrittene Position des Lanzelet innerhalb der Artusliteratur eingegangen und die Bedeutung der Erziehung Lanzelets im Reich der meffeine für seine Entwicklung hervorgehoben.
Im zweiten Kapitel wird Lanzelets Erziehung im Reich der meffeine analysiert. Dabei wird deutlich, dass Lanzelet zwar in höfischen Tugenden und Umgangsformen unterrichtet wurde, aber in Bezug auf Ritterlichkeit und Zweikampf defizitär blieb. Diese Defizite werden in den folgenden Kapiteln im Kontext der einzelnen Minneszenen beleuchtet.
Kapitel drei analysiert die Entwicklung des höfischen Verhaltens Lanzelets in Beziehung zu seinen Minnegemeinschaften. Die Analyse fokussiert dabei auf die Korrelation von éventiure und minne, die Rolle der Minnedamen im Kontext der adäquaten Ehefrau und die Erzählerhinweise hinsichtlich der Minnedamen. Die Analyse zeigt, dass Lanzelet im Verlauf seiner Minnegemeinschaften eine deutliche Entwicklung durchläuft, die sich in der Steigerung seiner ritterlichen Tugenden, der Wahl seiner Minnedamen und der Art und Weise der Darstellung durch den Erzähler widerspiegelt.
Das Kapitel über die Galagandreiztochter beleuchtet die erste Minnegemeinschaft Lanzelets, die durch eine Umkehrung des typischen Voraussetzung-Folge-Verhältnisses von éventiure und minne gekennzeichnet ist. Lanzelet erfüllt keine Minnevoraussetzungen und geht auf die Bitten der jungen Frau ein, ohne dass eine Werbungsphase stattfindet. Die darauffolgende Aventiure erfolgt zeitlich nach der Minneszene und widerspricht dem typischen Modell des Artusromans.
Die Minneepisode mit Ade zeigt eine Steigerung hinsichtlich der Korrelation von éventiure und minne. Die Aventiure und die Minnebeziehung verlaufen parallel, wobei Ade den Helden bereits vor dem Kampf mit den Burgbewohnern um Minne bittet. Lanzelet meistert den Dreikampf gegen den Riesen, die Löwen und den Burgherrn ohne regelwidrig vorzugehen und zeigt eine Entwicklung vom Messer zum Schwert, die als höfischer Norm angenähelt betrachtet werden kann.
Das Kapitel über Ibiis analysiert die dritte Minnegemeinschaft Lanzelets, die erstmals dem typischen Schema des Artusromans entspricht. Die Aventiure geht der Minne voraus, wobei Lanzelet die Möglichkeit zur Minne erhält, ohne die dafür notwendige Aventiure zu bestreiten. Lanzelet lehnt diese Gelegenheit ab, was von höfischer site und ritterlichem Verhalten zeugt.
Das Zwischenfazit fasst die Ergebnisse der Kapitel über die einzelnen Minneszenen zusammen und zeigt, dass Lanzelets höfisches Verhalten im Verlauf der Minnegemeinschaften eine Steigerung erfährt. Diese Steigerung lässt sich anhand der Korrelation von éventiure und minne, der Wahl der Minnedamen und der Erzählerhinweise hinsichtlich der Minnedamen nachvollziehen.
Das Kapitel über die Königin von Plüris analysiert die vierte und letzte Minnegemeinschaft Lanzelets. Die Entstehung des Minneverhältnisses verläuft gemäß der höfischen site, indem die Aventiure der Minne vorausgeht. Die Aventiure wird in Form einer Tjost gehalten, wobei Lanzelet gegen 100 Ritter antreten muss. Die Minnedame in dieser Episode ist jedoch keine adäquate Ehefrau, da die Minnegemeinschaft aus einer Zwangsehe entsteht, in der Lanzelet von der Königin in Gefangenschaft gehalten wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen höfisches Verhalten, Minne, éventiure, Artusroman, Ritterlichkeit, Lanzelet, Ulrich von Zatzikhoven, Erziehung, meffeine, Galagandreiztochter, Ade, Ibiis, Königin von Plüris, Tugend, Steigerung, Gradation, höfische Konventionen, Artuswürdigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist der Autor des "Lanzelet"?
Das Werk stammt von Ulrich von Zatzikhoven, einem Dorfpfarrer, der eine altfranzösische Quelle ins Deutsche übersetzte.
Wie wurde Lanzelet erzogen?
Er wuchs im Reich der Meermone (merfeine) auf, wo er zwar in höfischen Sitten unterrichtet wurde, aber Defizite in der ritterlichen Kampfkunst hatte.
Welche Rolle spielen die Minnegemeinschaften für Lanzelets Entwicklung?
Durch die Beziehungen zu Frauen wie Ade, Ibiis und der Königin von Plüris vervollkommnet Lanzelet schrittweise sein höfisches und ritterliches Verhalten.
Was ist die Korrelation von Aventiure und Minne?
In einem idealen Artusroman geht die ritterliche Tat (Aventiure) der Liebe (Minne) voraus. Die Arbeit untersucht, wie Lanzelet dieses Schema im Laufe der Zeit erfüllt.
Gilt Lanzelet als vorbildlicher Ritter?
Die Arbeit hinterfragt kritisch, ob Lanzelet von Beginn an ideal ist oder ob er erst durch seine Erfahrungen die volle „Artuswürdigkeit“ erlangt.
- Quote paper
- Sören Stübner (Author), Alexandra Stein (Author), 2011, Die Entwicklung des höfischen Verhaltens Lanzelets im Rahmen seiner Minnegemeinschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271890